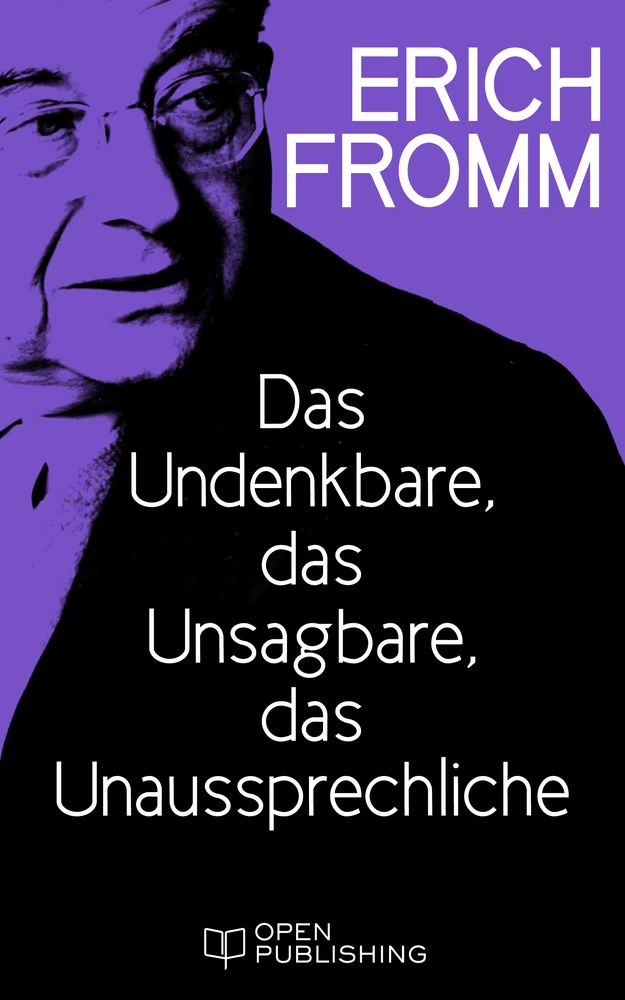Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Das Undenkbare, das Unsagbare, das Unaussprechliche
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Das Undenkbare, das Unsagbare, das Unaussprechliche
Erich Fromm
(1978b)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk[1]
Erstveröffentlichung unter dem Titel Das Undenkbare, das Unsagbare, das Unaussprechliche in Psychologie heute, Weinheim (Julius Beltz Verlag), Band 5 (November 1978), S. 23-31.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der vom Herausgeber überarbeiteten Fassung im (virtuellen) Band 10 der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, S. 301-311.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1978 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2016 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2016 by Rainer Funk.
In diesem Beitrag möchte ich auf den Unterschied zwischen den Begriffen des Undenkbaren, des Unsagbaren und des Unaussprechlichen aufmerksam machen: das Undenkbare, das nicht gedacht werden kann, das Unsagbare, das gedacht, aber nicht gesagt werden kann, und das Unaussprechliche, das zwar gesagt werden kann, das aber tabu ist. Worin unterscheiden sich diese Begriffe?
Das Undenkbare
Zunächst einmal das Undenkbare – also etwas, das nicht gedacht werden kann. Ich spreche jetzt vom Undenkbaren nicht im philosophischen oder logischen Sinn; vielmehr spreche ich hier im empirischen Sinn von dem, was in einer ganz bestimmten Gesellschaft nicht gedacht werden kann. Denn wir wissen sehr wohl, dass das, was in einer Gesellschaft undenkbar ist, in einer anderen überhaupt nicht undenkbar ist. Dafür gibt es viele Beispiele. Allgemein kann man sagen, das Undenkbare kann nicht gedacht werden, weil es außerhalb aller äußeren oder inneren Erfahrungen liegt, die in einer Gesellschaft gemacht werden können. Ich möchte einige Beispiele machen für das, was undenkbar ist.
In der neolithischen Gesellschaft, etwa um das Jahr 8 000 v. Chr., ist die Idee des Privateigentums undenkbar. Dass jemand etwas hat, was nur ihm gehört und also „privat“ ist, das heißt, dass er das, was ihm gehört, von einem anderen wegnehmen kann – dieser Begriff des Eigentums im Sinne des Privateigentums existiert in der neolithischen Gesellschaft nicht. Ein solches Verständnis und ein solcher Begriff fehlen auch in vielen noch heute existierenden Gesellschaften wie zum Beispiel bei den Pueblo-Indianern in Nordamerika. Der Begriff existiert nicht; er kann nicht gedacht und natürlich auch nicht gesagt werden, weil die Institution des Privateigentums erst mit einer bestimmten Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung aufkommt.[2]
Das gilt natürlich noch viel mehr für ein [X-302] Wort wie „Kapital“. „Kapital“ ist ein ganz moderner Begriff, wenn auch die Sache, die er bezeichnet, in gewisser Weise schon in der römischen Antike da ist. Er bezeichnet Werte und Güter, die zur Erzeugung anderer Güter mit einem Profit für den Erzeugenden gebraucht werden können. Der Begriff „Kapital“ ist also ein ganz neues Wort, das einer vergleichsweise jungen Form gesellschaftlichen Lebens zugehört.
In der Früh- und Vorgeschichte gibt es den Begriff des „Habens“ überhaupt noch nicht in dem Sinne, dass ich etwas habe, was nur mir gehört, auf dessen Besitz ich stolz bin, mit dem ich machen kann, was ich will, das ich sogar zerstören kann, was ökonomisch zwar unsinnig, aber dennoch Realität ist. Es ist bekannt, dass das Wort „haben“ in vielen Sprachen überhaupt nicht existiert. Wenn Sie zum Beispiel die semitischen Sprachen nehmen, so gibt es dort kein Wort für „ich habe“. Außerdem lässt sich feststellen, dass in keiner Sprache das Wort „haben“ am Anfang da war und dann wieder verloren ging. Vielmehr gilt umgekehrt: Nicht in allen, aber bei einer großen Reihe von Sprachen gibt es am Anfang das Wort „haben“ nicht, und erst langsam kommt mit der zunehmenden Bedeutung des Privateigentums die Vorstellung, das Gefühl, das Wort „ich habe etwas“ auf, um auszudrücken: Ich habe vollständige Kontrolle, ich habe das vollständige Verfügungsrecht, nicht nur über Dinge, sondern auch über Menschen. So wird im Römischen Recht der Mann zum Besitzer seiner Frau und seiner Kinder.
Inzwischen scheint manches anders zu werden, aber die Männer sitzen noch immer auf dem Thron. Sieht man genauer hin, kann man ein leichtes „Zittern“ bei den Männern bemerken; doch aus ihrer Rolle als diejenigen, die haben, die besitzen, die kontrollieren – und das ist alles eins –, aus dieser Rolle sind sie keineswegs schon verdrängt, auch wenn das optimistische Vertreter der Frauenrechte manchmal behaupten. Das ist Siegesruf auf Vorschuss.
Ein anderer Begriff, der in gewissen historischen Zeiten undenkbar ist, ist der Begriff der „Ausbeutung“. Auch hier gilt, dass er in der Vorgeschichte des Menschen, also speziell im Neolithikum, ein vollkommen sinnloses Wort gewesen wäre, weil die Sache noch nicht existierte. Eine Frau und ein Mann, die den ganzen Tag gearbeitet haben, konnten gerade so viel – heute würde man sagen – verdienen (aber das hat man damals nicht so genannt, der Verdienst ist eine sehr moderne Vorstellung), gerade so viel zusammenscharren, wie sie brauchten, um einigermaßen leben zu können. Erst als man durch verschiedene Methoden ein größeres Surplus erarbeitet hatte, fing man mit der Ausbeutung an, wobei das „Man“ ein bisschen euphemistisch ausgedrückt ist, denn genau gesagt, haben die Männer angefangen, die Frauen auszubeuten.
Das ist der erste Fall von Ausbeutung des Menschen und der Beginn der patriarchalen Gesellschaft. Warum die Männer dies konnten, schreiben sie heute ihrer Tüchtigkeit zu; manche sagen gar: „Die Männer sind eben physisch stärker.“ Dass es damit [X-303] nicht so weit her ist, zeigt sich zum Beispiel darin, dass Frauen physisch Arbeiten leisten, vor denen mancher Mann zurückschrecken würde.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121897
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie das Unbewusste das Verdrängte