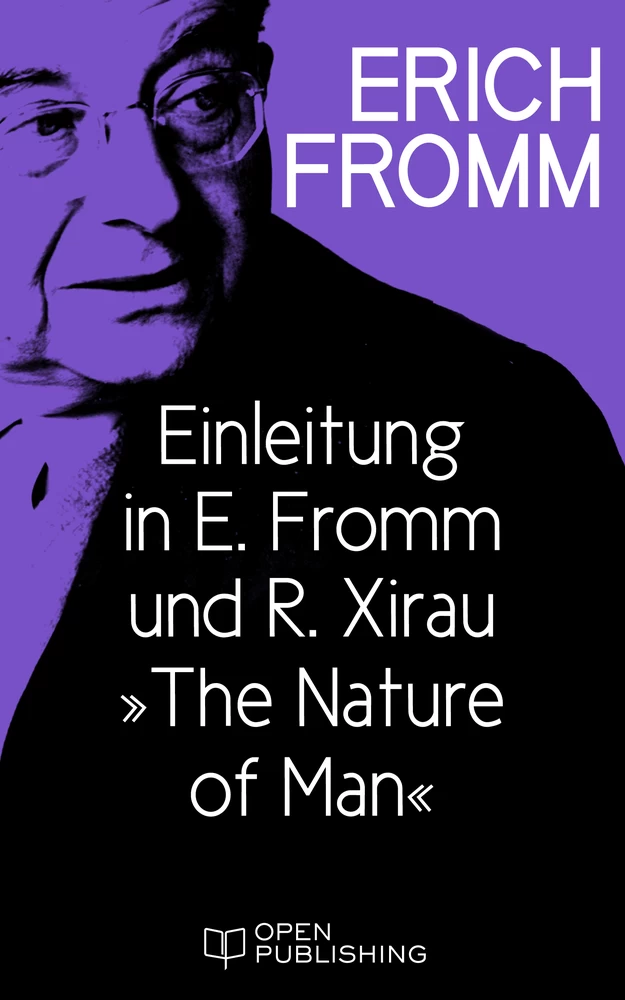Zusammenfassung
Der zweite Teil der sehr dicht gearbeiteten ‚Einleitung‘ gliedert sich in drei Abschnitte: Philosophisch-anthropologischen Überlegungen zur Frage der Freiheit folgen Ausführungen zur Frommschen Kommunikationstheorie, um abschließend der Wirklichkeit dessen nachzudenken, was „Geist“ meint, und zwar in der Konfrontation von Körper und Geist und in der von Bewusstsein und Geist angesichts des Unbewussten.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung in E. Fromm und R. Xirau „The Nature of Man“
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Einleitung in E. Fromm und R. Xirau „The Nature of Man“
(Introduction in E. Fromm and R. Xirau „The Nature of Man“)
Erich Fromm
(1968g)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk[1]
Aus dem Amerikanischen von Liselotte und Ernst Mickel.
Erstveröffentlichung 1968 unter dem Titel Introduction in der von Erich Fromm und Ramón Xirau herausgegebenen Anthologie The Nature of Man. Readings selected, New York (The Macmillan Company), S. 3-24. Eine erste, von Liselotte und Ernst Mickel besorgte deutsche Übersetzung erschien 1981 unter dem Titel Einleitung in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zehn Bänden, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt), GA IX, S. 375-391.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, GA IX, S. 375-391.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1968 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2016 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2016 by Rainer Funk.
Für die meisten Denker des griechischen Altertums, des Mittelalters, bis hin zur Zeit Kants war es selbstverständlich, dass es so etwas wie eine „Natur des Menschen“ gibt, also etwas, das – philosophisch gesprochen – das „Wesen“ des Menschen ausmacht. Zwar gab es unterschiedliche Ansichten darüber, was zu diesem „Wesen“ gehört, doch war man sich darüber einig, dass es ein „Wesen“ gibt, das heißt etwas, was den Menschen zum Menschen macht.
Vor einhundert Jahren, oder sogar schon früher, begann man, diese herkömmliche Ansicht in Frage zu stellen. Ein Grund hierfür war die intensivere Erforschung der menschlichen Geschichte. Die Untersuchungen zur Entwicklung der Menschheit zeigten, dass sich der Mensch unserer Epoche so sehr vom Menschen früherer Zeiten unterschied, dass die Annahme, es gäbe eine sich durch alle historischen Epochen durchhaltende „Natur des Menschen“, unrealistisch wurde. Die historischen Forschungen wurden in unserem Jahrhundert vor allem durch kulturanthropologische Untersuchungen vertieft. Die Erforschung der sogenannten primitiven Völker hat eine solche Vielfalt unterschiedlicher Sitten, Werte, Empfindungen und Gedanken ans Licht gebracht, dass viele Anthropologen zu der Auffassung gelangten, der Mensch werde als ein unbeschriebenes Blatt Papier geboren, auf das die jeweilige Kultur ihren Text schreibe. Zu den Auswirkungen der Untersuchungen zur Geschichte und zur Kulturanthropologie kam der Einfluss der Evolutionstheorie. Auch sie erschütterte den Glauben an eine allgemeine „Natur des Menschen“. Jean-Baptiste de Lamarck und Charles Darwin vor allem, aber auch andere Biologen haben nachgewiesen, dass alle Lebewesen evolutionäre Veränderungen erfahren. Schließlich konnte die moderne Physik zeigen, dass auch die physikalische Welt Evolutionen und Veränderungen unterliegt. Es ist keine bloße Metapher, wenn wir sagen, dass die Totalität der Welt eine Totalität in Bewegung ist, die sich – wie Alfred North Whitehead sagen würde – in einem Zustand des „Prozesses“ befindet.
Noch ein anderer Faktor trug zu der Tendenz bei, das Vorhandensein einer festgelegten menschlichen Natur, eines Wesens des Menschen zu verneinen: Der Begriff der [IX-376] menschlichen Natur wurde so oft missbraucht und als Schild benutzt, hinter dem die schlimmsten Ungerechtigkeiten begangen wurden, dass wir bei seiner Erwähnung geneigt sind, seinen moralischen Wert ernsthaft zu bezweifeln, ja sogar ihn für sinnlos zu halten. Unter Berufung auf die Natur des Menschen haben Plato, Aristoteles und die meisten Denker bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein die Sklaverei verteidigt. (Ausnahmen waren bei den Griechen die Stoiker, welche von der Gleichheit aller Menschen überzeugt waren, sowie in der Renaissance Humanisten wie Erasmus von Rotterdam, Thomas Morus oder Juan Luis Vives.) Unter Berufung auf eine solche „Natur des Menschen“ entstanden der Nationalismus und der Rassismus. Und unter Berufung auf die angebliche Überlegenheit der arischen Natur haben die Nationalsozialisten mehr als sechs Millionen Menschen umgebracht. Unter Berufung auf einen bestimmten abstrakten Begriff von menschlicher Natur fühlt sich der Weiße dem Farbigen, der Mächtige dem Hilflosen und der Starke dem Schwachen überlegen. Der Begriff der „menschlichen Natur“ musste bis in unsere Tage nur allzu oft für die Zwecke von Staat und Gesellschaft herhalten.
Muss man deshalb zu dem Schluss kommen, dass es so etwas wie eine menschliche Natur nicht gibt? Eine solche Annahme dürfte ebenso viele Gefahren in sich bergen wie der Begriff einer eindeutig festgelegten Natur. Wenn es kein allen Menschen gemeinsames Wesen gäbe, könnte es auch keine Einheit der Menschen, keine für alle Menschen gültigen Werte und Normen geben, ja, es gäbe keine Wissenschaft der Psychologie oder Anthropologie, die den Menschen zum Erkenntnisobjekt hat. Finden wir uns demnach nicht in der Zwickmühle zwischen zwei nicht wünschenswerten, ja gefährlichen Annahmen: zwischen der reaktionären Ansicht, welche eine genau festgelegte, unveränderliche menschliche Natur annimmt, und der relativistischen, welche zu dem Schluss führt, dass der Mensch mit anderen Menschen nur seine anatomischen und physiologischen Attribute teilt?
Vielleicht hilft es uns weiter, wenn wir zwischen dem Begriff der Natur oder des Wesens des Menschen und dem bestimmter Attribute unterscheiden, die allen Menschen gemeinsam sind und die trotzdem noch nicht allein den vollen Begriff der Natur oder des Wesens des Menschen ausmachen. Wir könnten sie als wesentliche Attribute bezeichnen, das heißt als Attribute, die zum Menschen als solchem gehören, und sie trotzdem vom „Wesen“ des Menschen unterscheiden, das alle diese Attribute und sogar noch mehr umfassen könnte und vielleicht zu definieren wäre als das, woraus sich die mannigfachen Attribute ergeben.
Das bekannteste unter diesen Attributen finden wir bei den griechischen Philosophen, bei den Denkern des Mittelalters und des achtzehnten Jahrhunderts und vor allem bei Kant: die Bestimmung des Menschen als eines mit Vernunft begabten Wesens (animal rationale). Diese Definition erschien als nicht hinterfragbar und selbstverständlich – bis zur Entdeckung der tiefen Irrationalität des Menschen. Diese hatten zwar Platon, die griechischen Dramatiker, Dante, Shakespeare, Dostojewski und viele andere bereits erkannt, doch erst Freud hat sie in den Mittelpunkt seiner empirischen, wissenschaftlichen Untersuchungen gestellt. Der Mensch mag wohl ein mit Vernunft begabtes Wesen sein, aber die Frage bleibt, welches Gewicht seine Irrationalität hat und wo deren Ursachen liegen.
Eine andere wichtige Bestimmung des [IX-377] Menschen lautet, er sei ein zoon politikon, ein soziales Wesen oder – genauer gesagt – ein Wesen, dessen Existenz unausweichlich an eine gesellschaftliche Organisation gebunden ist. Man kann zwar die Definition des Menschen als – soziales Wesen kaum bestreiten, doch ist sie ziemlich allgemein gehalten und sagt nur wenig über die Natur des Menschen aus, außer dass er – wie man es auch formulieren könnte – mehr ein Herdentier als ein Einzelwesen ist.
Eine weitere Definition lautet, dass der Mensch ein homo faber sei, ein Lebewesen, das etwas „fabrizieren“ kann. Auch diese Definition ist richtig und weist auf eine wichtige Eigenschaft hin, die den Menschen vom Tier unterscheidet, doch auch sie ist recht allgemein gehalten und bedarf weiterer Bestimmungen, um richtig verstanden zu werden. Denn auch das Tier „fabriziert“ etwas: Es gibt kaum ein besseres Beispiel als die Wachswaben, die die Bienen herstellen, um ihren Honig darin aufzubewahren. Es besteht aber – wie schon Marx dargelegt hat – ein großer Unterschied zwischen dem animal faber und dem homo faber. Das Tier produziert entsprechend einem instinktgesteuerten Verhaltensmuster, der Mensch hingegen nach einem Plan, den er sich zuvor zurechtgelegt hat. Noch etwas anderes unterscheidet den produzierenden Menschen vom produzierenden Tier: Der Mensch produziert mit Hilfe von Werkzeugen, die er kraft seines Verstandes als Erweiterung seiner eigenen Gliedmaßen herstellt, um seine Fähigkeit zur Produktion noch zu erhöhen. Im Verlaufe seiner Entwicklung hat der Mensch nicht nur Werkzeuge hergestellt, sondern auch die Energie (Dampf, Elektrizität, Öl, Atomenergie) so gebändigt, dass sie die tierische und menschliche Kraft ersetzen kann, die man früher noch für die Produktion einsetzte. Neuerdings – und das kennzeichnet die zweite industrielle Revolution – stellt der Mensch Apparate her, die nicht nur seine physische Energie ersetzen, sondern sogar (in Automation und Kybernetik) Denkfunktionen übernehmen.
Schließlich ist noch eine letzte, wichtige Bestimmung des Menschen zu nennen, die Ernst Cassirer und Philosophen, die sich mit den Symbolen beschäftigten, herausgestellt haben. Der Mensch ist ein Symbole schaffendes Wesen, und das wichtigste Symbol, das er geschaffen hat, ist das Wort. Mit Hilfe des Wortes kann er mit anderen Menschen seine Gedanken austauschen, wodurch der Denk- und Arbeitsprozess wesentlich erleichtert wird.
Diese Attribute des Menschen – seine Vernunft, seine Fähigkeit, etwas zu produzieren und eine gesellschaftliche Organisation aufzubauen, sowie die Fähigkeit Symbole zu schaffen – sind wesentlich, doch machen sie nicht die Totalität der menschlichen Natur aus. Es sind nur allgemeine menschliche Potenziale und noch nicht das, was man die „Natur des Menschen“ nennt. Auch wenn er alle diese Attribute besitzt, kann der Mensch frei oder determiniert, gut oder böse, von seiner Gier oder von Idealen bestimmt sein. Er kann sich Gesetze zu Beherrschung der Natur geben oder auch nicht. Und alle Menschen könnten neben den genannten Attributen noch eine ihnen gemeinsame Natur besitzen – oder auch nicht. Es kann allen Menschen gemeinsame Werte geben oder auch nicht. Wir stehen also immer noch vor dem eingangs gestellten Problem: Gibt es – neben gewissen allgemeinen Attributen – etwas, was man als „Natur des Menschen“ oder als das „Wesen des Menschen“ bezeichnen kann? Eine relativ neue Theorie scheint geeignet, die Lösung des Problems zu erleichtern, [IX-378] aber gleichzeitig auch wieder zu erschweren. Eine Reihe von Philosophen von Kierkegaard und Karl Marx bis hin zu William James, Henri Bergson und Teilhard de Chardin haben erkannt, dass der Mensch sich selber erzeugt, dass der Mensch der Urheber seiner Geschichte ist. In früheren Zeiten glaubte man, das Leben auf unserer Welt reiche von der Schöpfung bis zum Ende des Universums, und beim Menschen handele es sich um ein Wesen, das in die Welt hineingestellt wurde, um in irgendeinem Augenblick seines Lebens das Heil zu erlangen oder der Verdammnis anheimzufallen. Aber die Zeit spielt inzwischen in der Philosophie und Psychologie unserer Tage eine zentrale Rolle. Marx fasste die Geschichte als einen stetig ablaufenden Prozess auf, in dem der Mensch sich selbst als Individuum und als Spezies erschafft. James war der Ansicht, dass das Leben des Geistes der „Strom des Bewusstseins“ sei. Bergson glaubte, dass wir im tiefsten Grund unserer Seele „Dauer“, das heißt persönliche und nicht-übertragbare gelebte Zeit seien; die Existenzialisten ihrerseits haben uns gesagt, dass wir kein Wesen besäßen, sondern in erster Linie eine Existenz seien, das heißt, dass wir das seien, zu dem wir uns im Laufe unseres Lebens machen.
Wenn nun aber der Mensch historisch und zeitgebunden ist, wenn er sich selbst entwirft und macht in dem Maße, wie er sich mit der Zeit und innerhalb der Zeit verändert und modifiziert, dann dürfte es doch auf der Hand liegen, dass wir nicht länger von einer „Natur des Menschen“ und von einem „Wesen des Menschen“ reden können. Der Mensch ist dann kein mit Vernunft begabtes Wesen mehr – er wird erst dazu. Er ist nicht mehr sozial – er wird es erst. Er ist nicht mehr religiös – er wird es erst. Und wie steht es dann mit der menschlichen Natur? Können wir überhaupt noch davon sprechen?
Ich möchte eine Antwort darauf vorschlagen, die mir die der Wirklichkeit am meisten entsprechende Antwort auf die Frage nach der Natur des Menschen zu sein scheint. Sie ist auch geeignet, die durch die beiden extremen Positionen verursachten Schwierigkeiten zu überwinden – dass es nämlich eine festgelegte und unveränderliche Natur des Menschen gibt, oder aber dass es nichts gibt, was allen Menschen gemeinsam wäre, sieht man einmal von einigen wesentlichen Attributen ab. Ich möchte meinen Standpunkt mit der mathematischen Vorstellung von konstanten und variablen Größen erläutern. Seit es Menschen gibt, gibt es etwas im Menschen, was sich konstant gleich bleibt – eine Natur. Aber es gibt auch eine große Zahl variabler Faktoren, die den Menschen zu neuen Errungenschaften, zu Kreativität, Produktivität und zu Fortschritt befähigen (wobei ich unter Fortschritt hier nicht verstehe, dass man immer mehr haben kann, sondern ein ständiges Wachstum unseres Bewusstseins). Thomas von Aquin kam diesem Gedanken sehr nahe, als er den habitus, das heißt die Dynamik unseres Handelns, als nächstes Akzidenz der Substanz ansah. Für ihn war der habitus das, was zwar nicht unser ganzes Sein ausmacht, das dem aber, was wir in Wirklichkeit sind, am nächsten kommt. Spinozas Vorstellungen gingen in die gleiche Richtung. In seiner Ethik (Teil III, 6. Lehrsatz) formuliert er: „Ein jedes Ding strebt (conatur), soviel an ihm liegt, in seinem Sein zu beharren.“ Und im Vorwort zu Teil IV spricht er von einem „Modell der menschlichen Natur“, dem sich der Einzelne mehr oder weniger annähern könne.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121873
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie R. Xirau The Nature of Man Natur Transzendenz