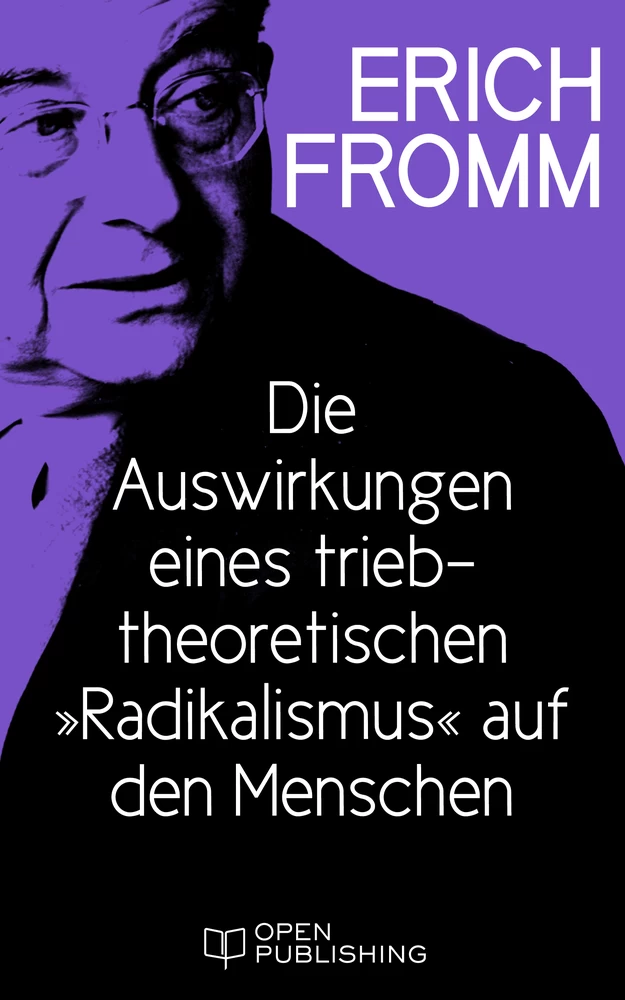Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Die Auswirkungen eines triebtheoretischen „Radikalismus“ auf den Menschen.Eine Antwort auf Herbert Marcuse
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Die Auswirkungen eines triebtheoretischen „Radikalismus“ auf den Menschen.
Eine Antwort auf Herbert Marcuse
(The Human Implications of Instinctivistic „Radicalism“. A Reply to Herbert Marcuse)
Erich Fromm
(1955b)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk[1]
Aus dem Amerikanischen von Liselotte und Ernst Mickel.
Erstveröffentlichung unter dem Titel The Human Implications of Instinctivistic „Radicalism“. A Reply to Herbert Marcuse in der Zeitschrift Dissent, New York 1955, S. 342-349, als Antwort auf die Veröffentlichung eines Kapitels von Herbert Marcuses Buch Eros and Civilization in der Zeitschrift Dissent. Eine erste, von Liselotte und Ernst Mickel besorgte Übersetzung ins Deutsche erfolgte 1980 in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zehn Bänden, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt), GA VIII, S. 113-120.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, GA VIII, S. 113-120.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1955 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2016 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2016 by Rainer Funk.
Ich freue mich, dass mir Gelegenheit gegeben wird, auf Herbert Marcuses Artikel Social Implications of Freudian Revisionism in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift zu antworten. Dies umso mehr, als Marcuse mich einen Vertreter der „revisionistischen“ Theorie nennt und mir vorwirft, ich hätte mich aus einem radikalen Denker und Gesellschaftskritiker in einen Fürsprecher der Anpassung an den Status quo verwandelt. Vor allem aber möchte ich Marcuse deshalb antworten, weil er einige der wichtigsten Probleme der psychoanalytischen Theorie und deren gesellschaftliche Auswirkungen berührt – Probleme, die für jeden von allgemeinem Interesse sind, der sich mit der heutigen Gesellschaft beschäftigt.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121835
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Herbert Marcuse Fromm-Marcuse-Kontroverse Triebtheorie