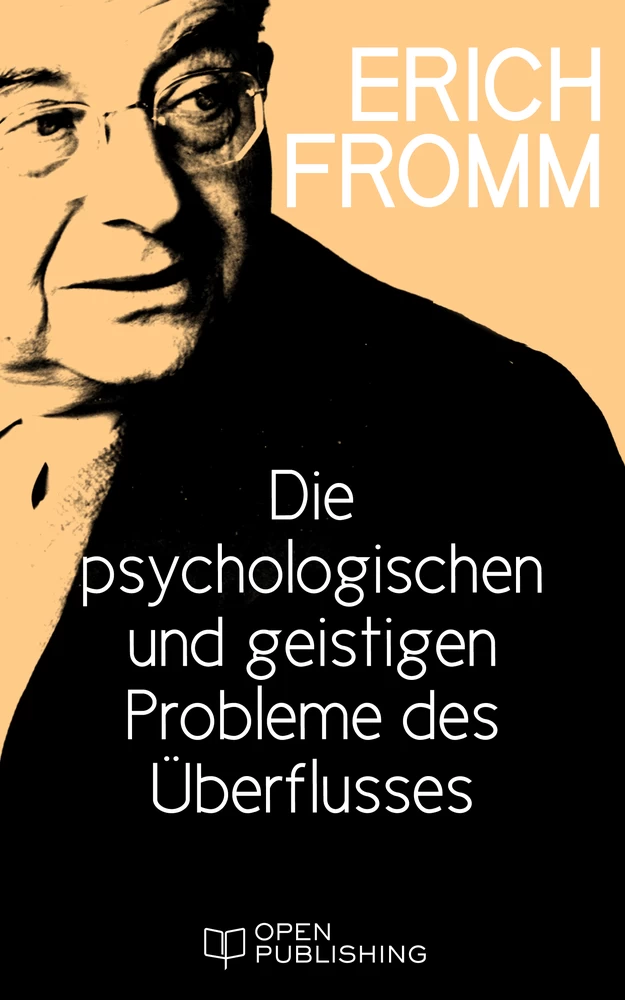Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Die psychologischen und geistigen Probleme des Überflusses
- Hinweise zur Übersetzung
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Die psychologischen und geistigen Probleme des Überflusses
Erich Fromm
(1970j)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk[1]
Zuerst als Vortrag in deutscher Sprache im Österreichischen Rundfunk gehalten. Erstsendung am 30. 12. 1966 im Studio Salzburg des ORF. – Erstveröffentlichung in O: Schatz (Hg.), Die erschreckende Zivilisation, Salzburger Humanismusgespräche, Wien 1970, S. 35-58 (Europa Verlag); leicht überarbeitet fand der Beitrag 1981 Eingang in die Erich Fromm Gesamtausgabe in zehn Bänden, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt), GA V, S. 317-328.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, GA V, S. 317-328.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1970 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2016 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2016 by Rainer Funk.
Gegenstand dieses Beitrages sind die psychologischen und geistigen Probleme der Überflussgesellschaft. Allein schon der Titel zeigt jedoch einige Schwierigkeiten an, die ich im Folgenden näher ausführen werde. Was verstehen wir unter „geistig“? Was „psychologisch“ ist, das wissen wir mehr oder weniger. Aber „geistig“ ist schon ein Wort, das nicht mehr ganz eindeutig bestimmbar ist und keinen ganz eindeutigen Sinn hat. Ich gebrauche es hier in jenem Sinn, den man auch mit dem Wort „religiös“ ausdrücken könnte, und den ich mit dem Symbol „X“ bezeichnen würde, weil das ein Symbol ist, das keine spezielle historische Referenz hat.[2] Wenn ich hier von den geistigen Problemen der Überflussgesellschaft rede, dann meine ich damit das, was man gewöhnlich „religiöse Probleme“ nennt und was ich persönlich lieber mit dem Wort „X-Probleme“ bezeichnen möchte.
Man kann vielleicht einwenden, ob man heute überhaupt von einer Überflussgesellschaft sprechen kann. Ist es nicht wahr, dass zwei Drittel der Menschheit nicht nur nicht im Überfluss leben, sondern in einer Armut, in der das Problem des Hungers noch immer das zentrale ist? Ist es nicht wahr, dass sogar im reichsten Land der Welt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung, sagen wir einmal grob gesprochen zwanzig Prozent, in Armut lebt, die zwar nicht zu vergleichen ist mit der Armut in Indien oder mit der Armut in Südamerika, die aber immerhin weit entfernt ist von dem, was man Überflussgesellschaft nennen kann?
Das alles ist in der Tat richtig, enthebt uns jedoch nicht der Notwendigkeit und der Berechtigung, von den Problemen einer Überflussgesellschaft zu sprechen, und zwar deshalb, weil sowohl in Amerika als auch in Europa große Schichten des mittleren Bürgertums bis hinein in die Arbeiterschaft tatsächlich schon beginnen, an der Überflussgesellschaft teilzunehmen. Der Trend als solcher steht wohl außer Frage, es sei denn, man hegt den nicht ganz unberechtigten Zweifel, ob die Menschheit imstande sein wird, in den nächsten fünf oder zehn oder zwanzig Jahren die Gefahr eines nuklearen Krieges zu bannen. Wenn das aber gelingt und diese Gefahr gebannt werden kann, dann besteht in der Tat wohl wenig Zweifel darüber, dass in zwanzig Jahren Amerika und vielleicht in dreißig oder vierzig Jahren auch Europa eine [V-318] automatisierte Gesellschaft haben wird, in der ein Überfluss an Gütern und speziell an Konsumgütern herrscht.
Aber es ist nicht nur deshalb nötig, von den Problemen der Überflussgesellschaft zu reden, weil wir schon am Anfang dieser Gesellschaft stehen, sondern weil in der Tat ein neues Menschenbild, eine neue Vision die Welt erobert, und zwar von Amerika und Europa bis zur Sowjetunion und bis zu den kleinsten, neuen Staaten in Afrika: das Ideal des konsumierenden Menschen. Hier handelt es sich um einen neuen Menschentyp, den homo consumens. Sicherlich gibt es noch immer den homo faber, obwohl dieser sich in der zweiten industriellen Revolution schon sehr von dem unterscheidet, was er vor der industriellen Revolution, auch vor der ersten, gewesen ist. Ob es den homo sapiens überhaupt noch gibt, mag bezweifelt werden, denn der homo sapiens gebraucht seine Vernunft als Mittel zum Überleben. In einer Situation, in der die Vernunft dazu benutzt wird, das Überleben in Frage zu stellen, in der die größten Kräfte der Vernunft dazu benutzt werden, um uns an den Rand der allgemeinen Zerstörung zu bringen, mag man in der Tat bezweifeln, ob der Mensch noch ein homo sapiens ist, oder ob er schon aufgehört hat, das zu sein. Was man wohl nicht bezweifeln kann, ist, dass der Mensch heute beginnt, ein homo consumens zu werden, ein totaler Konsument, und dass dieses Menschenbild fast den Charakter einer neuen religiösen Vision hat, in der der Himmel ein einziges großes Warenhaus ist, in dem sich jeder Mensch jeden Tag Neues kaufen kann, und zwar alles, was er will, und sogar noch ein bisschen mehr als sein Nachbar. Diese Vision des totalen Konsumenten ist in der Tat ein neues Menschenbild, das sich die Welt erobert, und zwar ganz ohne Unterschied bezüglich der politischen Organisation und Ideologie. Sie findet sich ebenso in den sogenannten kapitalistischen Ländern wie in den sogenannten sozialistischen Ländern. Der Unterschied ist nur der, dass sich vielleicht die sozialistischen Länder noch immer in der Illusion wiegen, dass das Glück vor der Tür steht, wenn das Versprechen des totalen Konsums nur einmal erfüllt sein wird, während in einem Land wie den Vereinigten Staaten, wo das „Glück“ dieses totalen Konsums für weite Schichten der Bevölkerung schon da ist, bereits manche Zweifel auftauchen, ob das Glück auf diese Weise überhaupt je gefunden werden kann.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121767
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie homo consumens Aktivität Überfluss