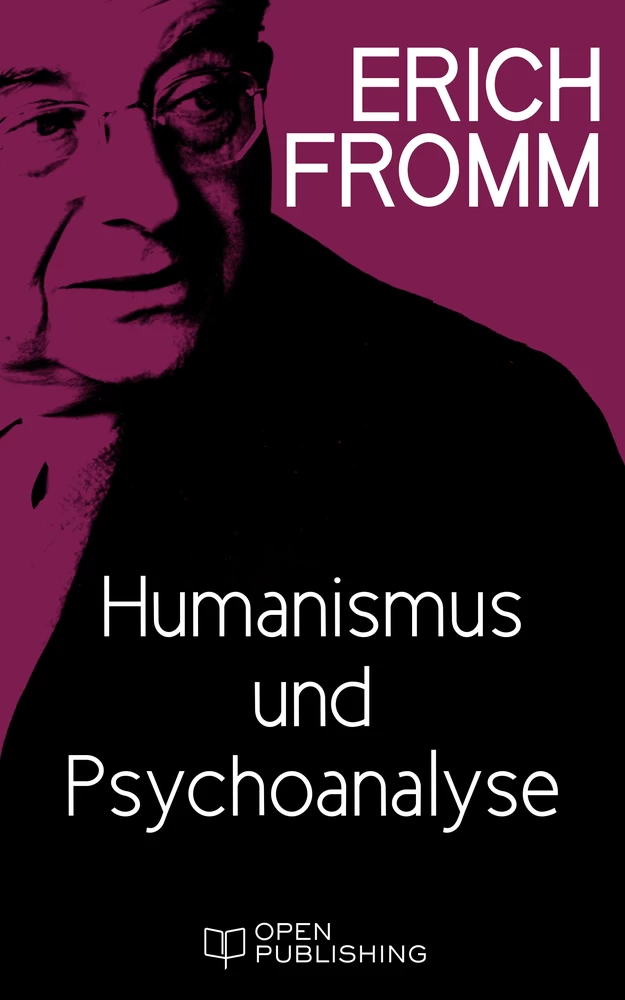Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Humanismus und Psychoanalyse
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Humanismus und Psychoanalyse
(Humanism and Psychoanalysis)
Erich Fromm
(1963f)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk[1]
Aus dem Amerikanischen von Liselotte und Ernst Mickel.
Erstveröffentlichung unter dem Titel Humanismo y Psicoanálisis in La Prensa Media Mexicana, México 28 (1963) S. 120-126; eine englische Fassung wurde unter dem Titel Humanism and Psychoanalysis erstmals in Contemporary Psychoanalysis, New York 1 (1964) S. 69-79, veröffentlicht. Eine deutsche Übersetzung besorgten Liselotte und Ernst Mickel für die Veröffentlichung in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zehn Bänden, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1981, GA IX, S. 3-11.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der Textfassung in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, GA IX, S. 3-11.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1963 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2016 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2016 by Rainer Funk.
Manchen Leser mag der Titel „Humanismus und Psychoanalyse“ überraschen. Er wird sich vielleicht fragen: Was hat eine philosophische Auffassung – der Humanismus – mit der Psychoanalyse zu tun, handelt es sich doch bei der Psychoanalyse um eine Therapie für seelische Erkrankungen? Diese Abhandlung verfolgt das Ziel, den engen Zusammenhang von Humanismus und Psychoanalyse aufzuzeigen. Hierzu erörtere ich einige wesentliche Merkmale beider Systeme.
Was ist Humanismus? Die herkömmliche Definition lautet, dass es sich dabei um eine Bewegung des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts handelt, die eine Rückkehr zum Studium der klassischen Antike, insbesondere der griechischen und römischen Literatur und Kunst bedeutete. Das ist zwar bis zu einem gewissen Grad richtig, doch ist diese Auffassung viel zu eng und oberflächlich. Vor allem ist der Humanismus nicht auf die Renaissance beschränkt, sondern setzte sich im Zeitalter der Aufklärung fort und lebt in der humanistischen Bewegung unserer Tage neu auf. Sodann war der Humanismus der Renaissance genau wie seine Fortsetzung im achtzehnten, neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert Ausdruck einer globalen Weltanschauung, welche – trotz vieler innerer Unterschiede – doch durch grundlegende Ideen und durch eine allen humanistischen Denkern gemeinsame humane Einstellung gekennzeichnet ist. Sowohl in seiner christlich-religiösen als auch in seiner säkularen, nicht-theistischen Ausprägung ist der Humanismus gekennzeichnet durch einen Glauben an den Menschen und dessen Fähigkeit, sich zu immer höheren Stufen weiterzuentwickeln, durch den Glauben an die Einheit der menschlichen Rasse, durch den Glauben an Toleranz und Frieden sowie an Vernunft und Liebe als jenen Kräften, die den Menschen in die Lage versetzen, sich selbst zu verwirklichen und das zu werden, was er sein kann.[2]
Untersuchen wir zunächst die Philosophie des Humanismus etwas genauer. Der wichtigste und grundlegende Gedanke des Humanismus ist die Idee, dass die Menschheit (humanitas[3]) keine Abstraktion, sondern eine Realität ist, so dass in jedem Individuum die ganze Menschheit enthalten ist. Jeder Einzelne repräsentiert die ganze Menschheit, und deshalb sind alle Menschen gleich – nicht was ihre Begabungen und Talente betrifft, sondern hinsichtlich ihrer grundlegenden menschlichen Qualitäten. [IX-004] Diese Idee von der Gleichheit aller Menschen wurzelt in der jüdisch-christlichen Tradition. Nach dem Alten Testament wurden nur ein Mann und eine Frau erschaffen, und zwar nach dem Bilde Gottes. Nach der Auslegung des Talmud will die Bibel damit sagen: Wer einen anderen Menschen zugrunde richtet, vernichtet gleichsam die ganze Welt, und wer einen anderen Menschen rettet, der hat gleichsam die ganze Menschheit gerettet. In der christlichen Überlieferung kommt die Idee der Einheit der Menschheit in der Gestalt Christi zum Ausdruck, der Gott und Mensch zugleich ist und der als Mensch kein Hebräer oder Grieche, sondern einfach nur Mensch, der Menschensohn, ist.
In eben dieser Tradition steht auch der Humanismus der Renaissance, sowohl in seinen religiösen als auch in seinen säkularen Formen. Nikolaus Cusanus, einer der wichtigsten Vertreter des christlichen Humanismus, lehrte, dass die grundlegende Vorstellung von der humanitas in Christus verkörpert sei. Das Menschsein (humanitas) Christi wird für ihn zu dem, was die Welt zusammenhält, „zum höchsten Beweis ihrer inneren Einheit“ (E. Cassirer, 1932, S. 183). Anders, jedoch im Grunde mit den Ideen von Cusanus verwandt, lauten die Vorstellungen von Spinoza und Leibniz. Für Leibniz steckt in
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121651
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Humanismus Unbewusstes Aufklärung Humanwissenschaft