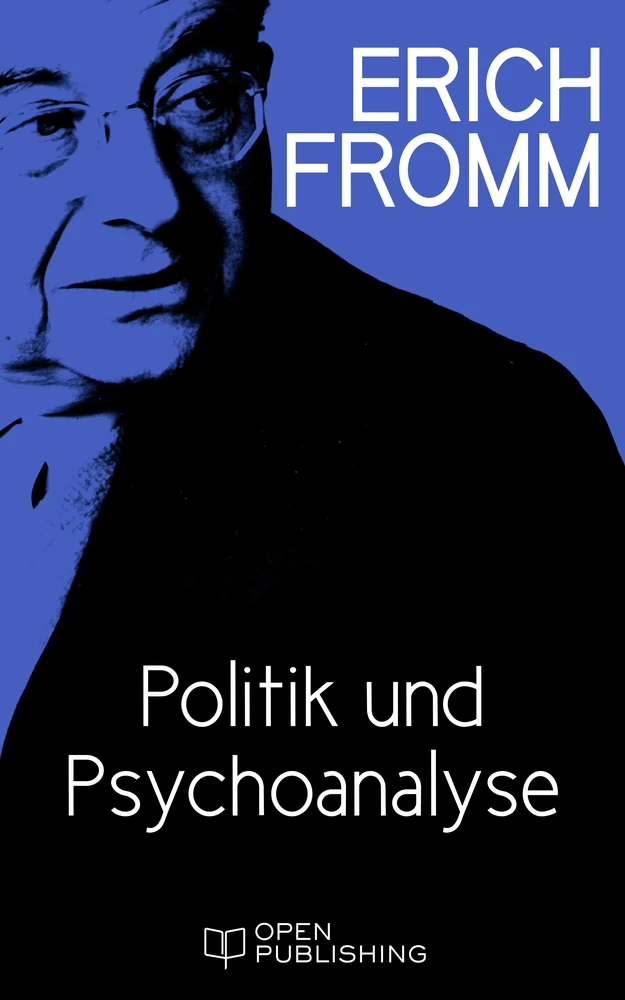Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Politik und Psychoanalyse
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Politik und Psychoanalyse
Erich Fromm
(1931b)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk[1]
Erstveröffentlichung unter dem TitelPolitik und Psychoanalyse, zuerst erschienen in: Psychoanalytische Bewegung>, Wien, 3 (1931) S. 440-447. Neu veröffentlicht 1980 in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zehn Bänden, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt), GA I, S. 31-36.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, GA I, S. 31-36.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1931 und 1980 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2016 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2016 by Rainer Funk.
Nachdem die Psychoanalyse den Schlüssel zum Verständnis des oft rätselhaften Handelns und Fühlens der Einzelpersönlichkeit geliefert hat, nachdem sie gezeigt hat, dass dieses irrationale Handeln und Erleben das Resultat bestimmter, dem Handelnden selbst oft unbewusster, aber ihn zwanghaft bestimmender Triebimpulse ist, lag es nahe, daran zu denken, dass die Psychoanalyse auch den Schlüssel zum Verständnis des oft ähnlich gelagerten gesellschaftlichen Handelns, des oft irrationalen politischen Geschehens liefern könne. Man ging mit Recht davon aus, dass die Gesellschaft aus lebendigen Individuen besteht, die keinen anderen psychologischen Gesetzmäßigkeiten unterliegen können, als sie die Analyse der Einzelpersönlichkeit aufgezeigt hat; man konnte leicht sehen, dass es unvernünftiges, triebbedingtes, zwanghaftes Handeln auch im gesellschaftlichen Leben gibt, und versuchte bald religiöse Rituale, Dogmen, Kriege, gewisse Volkssitten und eine Reihe anderer offenkundig irrational gefärbter gesellschaftlicher Erscheinungen zu analysieren. Ja, hie und da ging man sogar noch einen Schritt weiter. Man glaubte, dass nicht nur das gesellschaftliche Geschehen ebenso zu verstehen sein müsse, wie das individuell-neurotische, sondern dass auch die Schäden und Missstände der Gesellschaft ebenso auf analytischem Wege beseitigt werden könnten, wie das mit dem Symptom oder Charakterzug des einzelnen Neurotikers möglich ist, dass man etwa den ewigen Frieden durch Massenanalyse herbeiführen könne, indem die blinde Aggression der Menschen „weganalysiert“ wird. Gewiss eine verführerische Perspektive! Ob sie aber richtig ist und welche Rolle die analytische Anschauung im Verständnis gesellschaftlicher Vorgänge spielen kann, sollen die folgenden Ausführungen kurz beleuchten.
Erinnern wir uns einen Augenblick an die Methode des analytischen Verständnisses der Einzelpersönlichkeit. Sie lässt sich auf die einfache Formel bringen: Verständnis der Triebstruktur aus dem Lebensschicksal; hierbei ist nur zu ergänzen, dass insbesondere die Erlebnisse der frühkindlichen Periode eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der späteren Persönlichkeit spielen und ferner, dass die Konstitution des Individuums in einem bestimmten, von Freud als „Ergänzungsreihe“ verstandenen, Verhältnis zum Lebensschicksal steht und dass beide Faktoren, Konstitution und Erleben, die Triebstruktur bedingen. [I-032]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121460
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Gesellschaft historischer Materialismus Politik