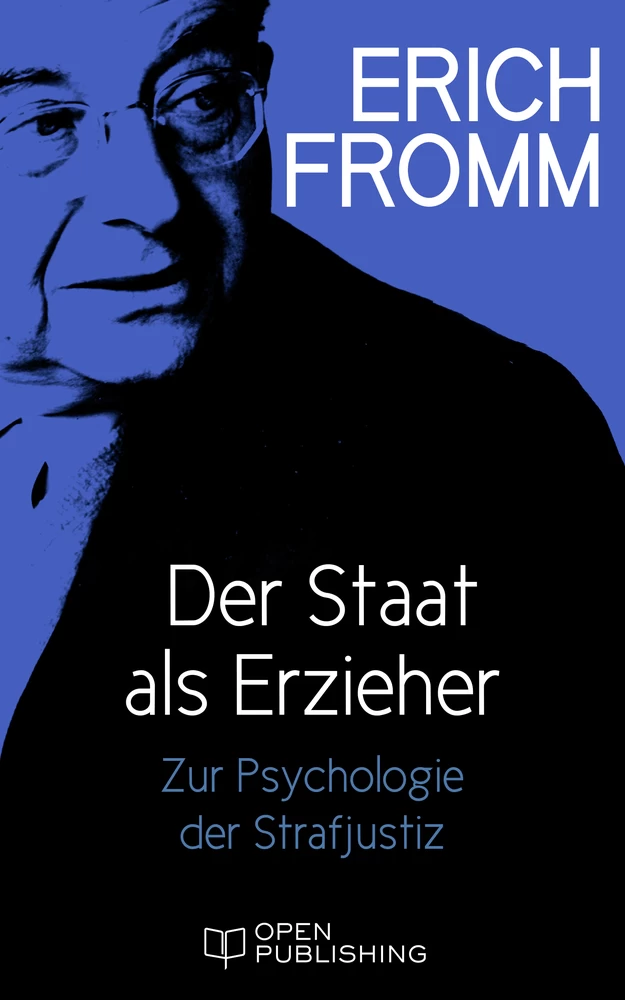Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Der Staat als Erzieher. Zur Psychologie der Strafjustiz
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Der Staat als Erzieher.
Zur Psychologie der Strafjustiz
Erich Fromm
(1930b)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk[1]
Erstveröffentlichung unter dem Titel Der Staat als Erzieher. Zur Psychologie der Strafjustiz, in: Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik, Wien, 4 (1930) S. 5-9. Wiederabgedruckt in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, Band I, S. 7-10.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, GA I, S. 7-10.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1930 und 1980 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2016 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2016 by Rainer Funk.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121453
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Strafjustiz Staat Autorität