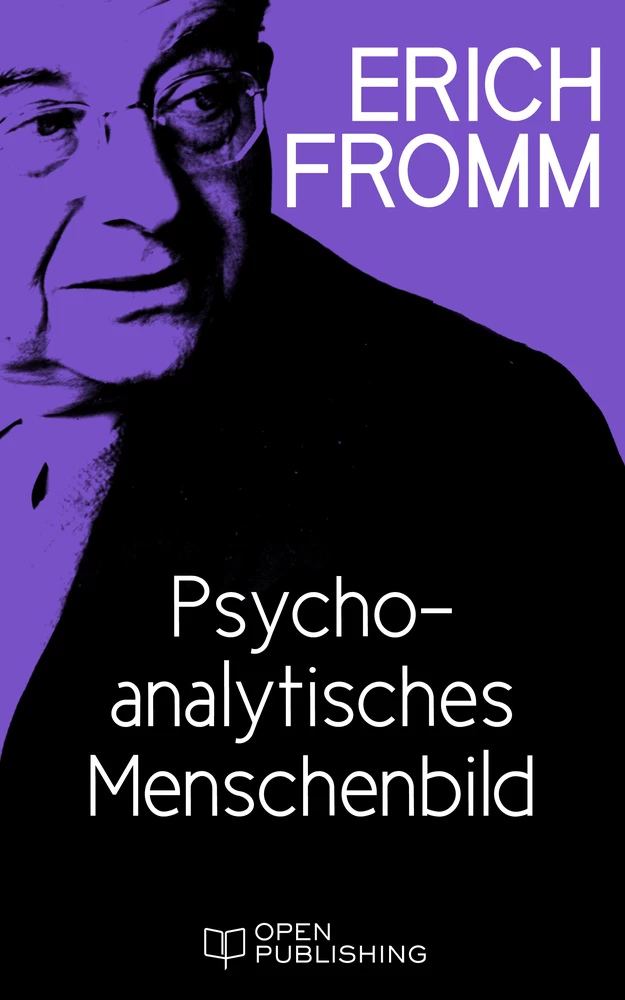Zusammenfassung
Ein besonderer Reiz der vorliegenden Sammlung besteht darin, dass die einzelnen Beiträge eindrücklich die Entwicklung des Frommschen Menschenbildes vor Augen führen – von der Auseinandersetzung mit dem Freudschen Menschenbild bis hin zu den differenzierten Aussagen in dem 1968 entstandenen Beitrag ‚Einleitung in E. Fromm und R. Xirau „The Nature of Man“‘.
Aus dem Inhalt
- Die gesellschaftliche Bedingtheit der psychoanalytischen Therapie
- Die Auswirkungen eines triebtheoretischen „Radikalismus“ auf den Menschen. Eine Antwort auf Herbert Marcuse
- Eine Erwiderung auf Herbert Marcuse
- Die philosophische Basis der Freudschen Psychoanalyse
- Die Grundpositionen der Psychoanalyse
- Einleitung in E. Fromm und R. Xirau „The Nature of Man“
- Mein eigenes psychoanalytisches Bild vom Menschen
- Das Undenkbare, das Unsagbare, das Unaussprechliche
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Psychoanalytisches Menschenbild
- Inhalt
- Die gesellschaftliche Bedingtheit der psychoanalytischen Therapie
- Die Auswirkungen eines triebtheoretischen „Radikalismus“ auf den Menschen. Eine Antwort auf Herbert Marcuse
- Eine Erwiderung auf Herbert Marcuse
- Die philosophische Basis der Freudschen Psychoanalyse
- Die Grundpositionen der Psychoanalyse
- Einleitung in E. Fromm und R. Xirau „The Nature of Man“
- Mein eigenes psychoanalytisches Bild vom Menschen
- Das Undenkbare, das Unsagbare, das Unaussprechliche
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Die gesellschaftliche Bedingtheit der psychoanalytischen Therapie
(1935a)[2]
Die psychoanalytische Therapie[3] beruht auf der Aufdeckung der zur Symptombildung oder zur Bildung neurotischer Charaktereigenschaften führenden unbewussten Strebungen. Die Symptome sind Ausdruck des Konflikts zwischen solchen unbewussten verdrängten und den sie verdrängenden Tendenzen. Die wichtigste Ursache der Verdrängung ist die Angst. Ursprünglich und zunächst einmal die Angst vor äußerer Gewalt, die aber, soll eine wirksame Verdrängung zustande kommen, ergänzt wird durch die Angst, Sympathie und Liebe derjenigen zu verlieren, die man respektiert und bewundert, und endlich durch die Angst vor dem Verlust des Respekts vor sich selbst (vgl. Studien über Autorität und Familie. Sozialpsychologischer Teil, 1936a, GA I, S. 139-187).
Allerdings ist auch die Angst vor dem Verlust der Liebe einer bewunderten Person gewöhnlich noch nicht ausreichend, um die Verdrängung derjenigen Impulse und Phantasien zu bewirken, die den Verlust dieser Liebe verursachen können. Verdrängungen pflegen erst einzutreten, wenn der Impuls nicht nur von einer einzelnen Person, oder auch von mehreren Individuen verurteilt wird, sondern wenn er in der gesellschaftlichen Gruppe, der der Betreffende angehört, verpönt ist. In diesem Fall gesellt sich zur Androhung äußerer Strafen, zum Verlust der Liebe seitens der für den Betreffenden wichtigsten Person, noch die Gefahr der Isolierung und des Verlustes des gesellschaftlichen Rückhalts. Es scheint, dass diese Gefahr bei den meisten Menschen mehr Angst auslöst als die vorher erwähnte und dass diese gesellschaftliche Isolierung die wichtigste Quelle für die Verdrängung ist.[4] [I-116]
Ist ein Impuls verdrängt, so ist er damit noch nicht vernichtet. Er ist nur aus dem Bewusstsein entfernt, hat aber nichts von seiner ihm ursprünglich innewohnenden Energie verloren. Er hat vielmehr die Tendenz, ins Bewusstsein zurückzukehren, und es bedarf einer Kraft, die ihn ständig daran verhindert. Freud gebraucht, um dies zu demonstrieren, ein sehr anschauliches Bild. Er vergleicht die verdrängten Regungen mit einem unerwünschten Gast, den man zu Hause herausgeworfen hat, der aber immer wieder versucht zurückzukehren. Man muss einen Diener an der Türe aufstellen, der ihn am erneuten Eindringen hindert. Wenn in einer Analyse versucht wird, die verdrängten Regungen ins Bewusstsein zurückzubringen, so macht sich diese, das Verdrängte am Zurückkehren hindernde Kraft sehr deutlich bemerkbar; Freud hat ihr den Namen „Widerstand“ gegeben. Dieser Widerstand kann sich in vielen Formen äußern. Seine einfachste ist die, dass, sobald der Analysand gleichsam in die Nähe des verdrängten Materials gerät, ihm überhaupt nichts einfällt, oder dass ihm sehr viele Dinge einfallen, die vom verdrängten Gegenstand abführen, oder dass er wütend auf den Analytiker ist und beginnt, die ganze Methode als unsinnig abzulehnen, oder dass er körperliche Symptome entwickelt, die ihn hindern, in die Analyse zu kommen, und ihn davor schützen, das verdrängte Material zu berühren. Der Widerstand ist so ein im Laufe der Analyse mit Notwendigkeit auftretendes Problem. Wollte man ihn vermeiden, so wäre dies gleichbedeutend mit dem Verzicht auf die Bewusstmachung des verdrängten Materials überhaupt. Dies wird tatsächlich von den meisten nicht-psychoanalytischen psychotherapeutischen Methoden versucht. Es ist zunächst der kürzere Weg, aber der Preis, der dafür bezahlt wird, ist der Verzicht auf die tiefgreifende Änderung in der seelischen Struktur. Der Widerstand ist geradezu das zuverlässigste Signal dafür, dass man verdrängtes Material berührt und sich nicht nur an der seelischen Oberfläche bewegt.
Die Feststellung der Notwendigkeit des Widerstandes besagt aber nicht, dass es für die Analyse umso besser sei, je stärker der Widerstand ist. Im Gegenteil. Wenn der Widerstand, aus welchen Gründen auch immer, ein bestimmtes Maß überschreitet, wird die Analyse der von ihm beschützten unbewussten Regungen überhaupt unmöglich, während umgekehrt die Analyse umso rascher fortschreitet und umso rascher erfolgreich beendet ist, je schneller es gelingt, durch den Widerstand hindurch zum unbewussten Material vorzustoßen. Erfolg und Dauer der Analyse sind davon abhängig, ob und wie rasch diese Durchstoßung der Widerstände gelingt, und die Frage, welches die Faktoren sind, von denen die Stärke des Widerstandes abhängt, ist deshalb gleichbedeutend mit der Frage nach den Erfolgschancen der analytischen Therapie. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss hier bemerkt werden, dass es sich bei dem Widerstand, von dem wir hier sprechen, nicht um die Hemmungen handelt, die einen Patienten davon zurückhalten, einen bestimmten Einfall, den er hat, zu sagen. Auch solche Ängste spielen natürlich in der Analyse eine große Rolle, aber es ist im Prinzip eine Sache des Willens, sie zu überwinden. Wovon hier gesprochen wird, sind [I-117] die Tendenzen, die einen Menschen daran hindern, dass die verdrängten Gedanken, d.h. solche Gedanken, die zunächst einmal gar nicht in seinem Bewusstsein sind, ins Bewusstsein kommen.
Wovon hängt die Stärke des Widerstandes ab? Die Antwort auf diese Frage im Sinne Freuds wäre, etwas vereinfacht ausgedrückt: Die Stärke des Widerstandes ist proportional zur Stärke der Verdrängung, und die Stärke der Verdrängung wiederum hängt von der Stärke der Angst ab, die ursprünglich die Ursache der Verdrängung gewesen ist. Ob diese Ängste sich im Verlauf des Lebens verstärken oder abschwächen, hängt von den Lebensschicksalen ab, die der Kindheit folgen. Wie dem auch immer sei, wenn der Erwachsene eine Analyse beginnt, bringt er ein bestimmtes Maß an Angst, Verdrängungsenergie und Widerstand mit, und die Dauer wie überhaupt die Chancen des Erfolges der Analyse hängen von der Stärke des mitgebrachten Widerstandes ab. Er überträgt die mitgebrachte Angst auf die Person des Analytikers, und man kann deshalb in gewissem Sinne mit Recht sagen, die Stärke des Widerstandes hängt von der in der Übertragung entwickelten Angst vor dem Analytiker ab.
Hier taucht allerdings die Frage auf, wie es denn überhaupt möglich sein soll, dass der Patient in Gegenwart eines anderen ihm fremden Menschen Ängste überwindet, die bisher mit Bezug auf alle andern Menschen so stark waren, dass sie die Verdrängung aufrechterhielten. Die besonderen Gefühle, die dies in der Analyse möglich machen, sind leicht einzusehen. Zunächst findet nur eine allmähliche Annäherung an das verdrängte Material statt, man stößt nicht unmittelbar auf den Kern der Verdrängungen, sondern analysiert Schritt für Schritt die die zentrale Verdrängungsposition schützenden psychischen Schichten. Weiterhin hat ein Teil der Gründe für die Angst, die zur Verdrängung geführt hat, nur in einer bestimmten vergangenen Situation bestanden, sie sind in der Gegenwart gleichsam anachronistisch, und die Ängste, wenn sie nur bewusst gemacht werden, erscheinen spukhaft und verschwinden. Weiterhin kann der Analytiker anhand des ihm gebotenen Materials, speziell der Träume und Fehlleistungen und Zusammenhänge der Einfälle, das Vorhandensein bestimmter unbewusster Regungen dem Analysanden so wahrscheinlich machen, dass er sich dessen Vernunft als aktiven wirksamen Bundesgenossen bei der Aufdeckung des Verdrängten erwirbt. Hierzu kommt ferner das Leiden des Patienten, das sich oft als ein genügend starker Motor erweist, um den Widerstand zu überwinden. Ein anderer Faktor, an den man in diesem Zusammenhang häufig denkt, nämlich die in der Analyse auftretende Verliebtheit des Patienten in den Analytiker, ist von recht zweifelhaftem Wert für die Überwindung des Widerstandes. Sie wirkt zwar in der Richtung, dass der Patient sich dem Analytiker ganz eröffnen, gleichsam ganz hingeben will, und damit im Sinne der Überwindung des Widerstandes. Gleichzeitig aber wirkt sie auch in der entgegengesetzten Richtung, indem sie den Wunsch verursacht, in den Augen des Analytikers möglichst liebenswert und fehlerfrei dazustehen. Wenn die Verliebtheit die Form annimmt, dass der Analytiker zum Ideal, zum „Über-Ich“ des Analysanden wird, kann sie eine besonders schwere Hinderung in der Analyse darstellen.
Zu allen oben genannten Bedingungen für die Möglichkeiten der Überwindung des Widerstandes kommt noch die, dass der Analytiker eine freundliche, objektive und nicht verurteilende Haltung einnimmt. Vorausgesetzt, der Analytiker erfüllt diese [I-118] letzte Forderung, dann sieht es so aus, als ob die Stärke des Widerstandes ausschließlich von der Kindheitssituation und kaum von dem jetzt gegebenen, wirklichen Verhältnis zwischen Analytiker und Patient bestimmt ist. Dies ist auch der Standpunkt, der im Großen und Ganzen von Freud und manchen seiner Schüler vertreten wird. Sie sind geneigt, die Realität der Person des Analytikers, wenn nur gewisse allgemeine und recht formale Bedingungen erfüllt sind, für ziemlich unwichtig und alles, was sich an Reaktionen dem Analytiker gegenüber abspielt, für „Übertragung“, d.h. für Wiederholung von ursprünglich anderen Menschen geltenden Reaktionen zu halten. Diese Unterschätzung der Realität des Analytikers, also etwa seines Persönlichkeitstyps, Geschlechts, Alters und so fort, ist nur ein Ausdruck einer allgemeineren Voreingenommenheit Freuds gegen die Bedeutung der aktuellen Situation im Verhältnis zu den Kindheitserlebnissen. Wenn diese auch gewiss eine besondere und die Zukunft weitgehend determinierende Rolle spielen, und zwar bei dem durch den Mangel an seelischer Anpassungsfähigkeit charakterisierten Neurotiker noch mehr als beim Gesunden, so sind doch keineswegs die Erfahrungen des späteren Lebens einfach Wiederholungen und ohne Einfluss auf die Entwicklung der Triebstruktur.
Was spielt sich zwischen dem Analytiker und dem Patienten ab? Der Patient hat aus Angst vor Strafe, Liebesverlust, Isolierung, gewisse Triebregungen verdrängt. Die Verdrängung ist missglückt und hat zu neurotischen Symptomen geführt. Er kommt in die Analyse, deren Ziel es ist, das Verdrängte ins Bewusstsein zu heben. Die Angst, die ursprünglich zur Verdrängung geführt hat, wird auf den Analytiker übertragen. Aber diese mitgebrachte Angst wird stärker oder schwächer, je nach der Persönlichkeit und dem Verhalten des Analytikers. Im extremen Fall, wo der Analytiker eine verurteilende, feindliche Stellung den verdrängten Regungen gegenüber einnimmt, kann man wohl kaum überhaupt erwarten, dass der Patient imstande ist, durch den Widerstand zum Verdrängten durchzustoßen. Wenn der Patient, und mag es auch nur dunkel und instinktiv sein, fühlt, dass der Analytiker die gleiche verurteilende Einstellung zur Verletzung gesellschaftlicher Tabus hat wie die anderen Menschen, mit denen er in seiner Kindheit und später zusammengetroffen ist, dann wird in der aktuellen analytischen Situation der ursprüngliche Widerstand nicht nur übertragen, sondern neu produziert. Je weniger, umgekehrt, der Analytiker eine verurteilende Haltung hat und je mehr er andererseits das Glück des Patienten in einer unbedingten, durch nichts zu erschütternden Weise bejaht, desto mehr wird sich der mitgebrachte Widerstand abschwächen, und desto rascher kann man zum Verdrängten vorstoßen. Dabei ist das, was der Analytiker sagt oder was er bewusst denkt, von untergeordneter Bedeutung gegenüber dem, was in ihm unbewusst vorgeht und was das Unbewusste des Patienten errät und versteht. Die Frage nach der tatsächlichen bewussten und mehr noch nach der unbewussten Einstellung des Analytikers zu den gesellschaftlichen Tabus, deren Schutz in Vergeltungsdrohungen besteht, die zu den nun aufzuhebenden Verdrängungen geführt haben, ist deshalb von entscheidender Bedeutung für die Möglichkeit des therapeutischen Erfolges sowie für die Dauer der Analyse.
Wir sagten schon, dass Freud dem aktuellen Verhalten und besonderen Charakter des Analytikers relativ wenig Bedeutung zugemessen hat. Dies ist umso merkwürdiger, als die analytische Situation, so wie sie Freud geschaffen hat, in unserer Kultur, und [I-119] vielleicht überhaupt, ganz ungewöhnlich und unerhört ist. Es gibt keine auch nur annäherungsweise ähnliche Situation, in der ein Mensch einem anderen nicht nur rückhaltlos „beichtet“, d.h. ihm alles sagt, was er an sich verurteilt, sondern darüber hinaus noch jene flüchtigen Einfälle mitteilt, die absurd und lächerlich erscheinen, und wo er sich verpflichtet, auch alle jene Dinge zu sagen, die er jetzt noch gar nicht weiß, die ihm aber noch einfallen könnten, ja, wo er dem anderen auch alle Meinungen und Gefühle, die er über ihn hat, unverfälscht mitteilt und zum Gegenstand leidenschaftsloser Untersuchung macht. Diese Situation radikaler Offenheit und Wahrhaftigkeit geschaffen zu haben, ist sicher eine der großartigsten Leistungen von Freud. In seinen eigenen Äußerungen schimmert aber wenig von dem Bewusstsein der Ungewöhnlichkeit dieser Situation durch. Gewiss spricht er einmal davon, dass „die psychoanalytische Behandlung auf Wahrhaftigkeit aufgebaut“ und dass darin „ein gutes Stück ihrer erziehlichen Wirkung und ihres ethischen Wertes“ liege (S. Freud, 1915a, S. 312). Im Großen und Ganzen fasst er aber die Situation als eine medizinisch-therapeutische Prozedur auf, so wie sie sich ja auch tatsächlich aus der Hypnose entwickelt hatte. Was er über das Verhalten des Analytikers zum Patienten sagt, geht kaum über diesen technischen Aspekt hinaus und berührt selten die neuartige menschliche Seite der Situation. Der Analytiker soll von „gleichschwebender Aufmerksamkeit sein“, soll sich dem Patienten gegenüber „Indifferenz“ (S. Freud, 1915a, S. 313) und „Gefühlskälte“ (S. Freud, 1912e, S. 381) erwerben, er soll sich von „therapeutischem Ehrgeiz freihalten“ (a.a.O.) und es unter allen Umständen vermeiden, dem Liebesverlangen des Patienten nachzugeben. Er soll für den Patienten „undurchsichtig“ (S. Freud, 1912e, S. 384) sein, gleichsam glatt wie eine Spiegelfläche. Der Analytiker soll dem Patienten nicht sein Ideal aufdrängen, sondern „tolerant“ sein gegen die Schwäche des Kranken und „sich bescheiden, auch einem nicht Vollwertigen ein Stück Leistungs- und Genussfähigkeit wiedergewonnen zu haben“ (S. Freud, 1912e, S. 385). Andere Ratschläge zur Technik beziehen sich auf Fragen des äußeren Arrangements der Situation. Der Patient soll auf einem Diwan gelagert sein und der Analytiker so hinter ihm sitzen, dass er vom Patienten nicht gesehen wird. Der Patient soll nicht ohne Honorar analysiert werden und seine Stunde auch dann bezahlen müssen, wenn er sie durch Krankheit oder aus einem andern Grunde versäumt. Alles in allem entspricht das, was Freud an Ratschlägen über das Verhalten zum Patienten gibt, weit mehr dem, was ein Chirurg über die Lagerung des Patienten, Sterilisierung der Instrumente usw. zu sagen hätte, als der großartigen neuen menschlichen Situation, wie sie in dem Verhältnis Analytiker-Patient angelegt ist. Ja, Freud gibt ausdrücklich den Chirurgen als Vorbild an. „Ich kann“, sagt er, „den Kollegen nicht dringend genug empfehlen, sich während der psychoanalytischen Behandlung den Chirurgen zum Vorbild zu nehmen, der alle seine Affekte und selbst sein menschliches Mitleid beiseite drängt und seinen geistigen Kräften ein einziges Ziel setzt: die Operation so kunstgerecht als möglich zu vollziehen“ (S. Freud, 1912e, S. 381).
Nur in zwei Punkten geht Freud über das rein Technisch-Medizinische in positivem Sinn hinaus. Einmal darin, dass er, wenn auch nicht von Anfang an, gefordert hat, der Analytiker selbst solle analysiert sein, um so nicht nur die theoretisch bessere Einsicht in die Vorgänge im Unbewussten zu erhalten, sondern auch um sich seiner eigenen „blinden Flecke“ bewusst zu sein und seine [I-120] eigenen affektiven Reaktionen kontrollieren zu können. Die andere über das rein Technische hinausgehende Forderung Freuds ist die, dass der Analytiker allem gegenüber, was der Patient vorbringt, nicht werten, sondern eine objektiv vorurteilslose, neutrale, nachsichtige Haltung haben solle. Freud bezeichnet selbst wiederholt die hier gemeinte Haltung mit „Toleranz“. So sagt er etwa: „Als Arzt muss man vor allem tolerant sein gegen die Schwäche des Kranken“ (S. Freud, 1912e, S. 385), oder „das grobsinnliche Verlangen der Patientin (...) ruft alle Toleranz auf, um es als natürliches Phänomen gelten zu lassen“ (S. Freud, 1915a, S. 319). Oder er spricht von der „Toleranz der Gesellschaft, die sich im Gefolge der psychoanalytischen Aufklärung unabwendbar einstellt“ (S. Freud, 1910d, S. 114). Toleranz gegenüber dem Patienten ist tatsächlich die einzig positive Empfehlung, die Freud für das Verhalten des Analytikers neben der negativen, wie Gefühlskälte und Indifferenz, gibt.
Ein besseres Verständnis für das, was bei Freud Toleranz bedeutet, gewinnt man bei einem auch nur flüchtigen Überblick über den geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergrund der Toleranzidee. Die Toleranz hat zwei Seiten, die etwa in folgenden Maximen ihren Ausdruck gefunden haben: „Tout comprendre c’est tout pardonner“ und „Man soll jeden nach seiner Fasson selig werden lassen“. Die erste Maxime bezieht sich mehr auf die Milde des Urteils. Man soll nachsichtig sein, die Schwäche eines Menschen entschuldigen, nicht den Stab über ihn brechen, kurz gesagt, auch dem Schlimmsten gegenüber noch verzeihen. Die zweite Maxime drückt mehr jene Seite der Toleranz aus, bei der es darauf ankommt, alle Wertungen überhaupt zu vermeiden. Wertung selbst gilt schon als intolerant und einseitig. Ob jemand an Gott oder an Buddha glaubt, ob er für Diktatur oder Demokratie ist, oder was immer die verschiedensten Weltanschauungen und Wertsysteme sein mögen, alle sind nur Spielarten des menschlichen Denkens, und keine darf den Anspruch erheben, der anderen überlegen zu sein. Bis ins Achtzehnte Jahrhundert hinein hatte die Forderung der Toleranz einen kämpferischen Sinn. Sie war gegen Staat und Kirche gerichtet, die den Menschen verboten, gewisse Dinge zu glauben oder gar zu äußern. Der Kampf für Toleranz war ein Kampf gegen Unterdrückung und Knebelung des Menschen. Er wurde von den Vertretern des aufsteigenden Bürgertums geführt, das gegen die politischen und wirtschaftlichen Fesseln des absolutistischen Staates kämpfte. Mit dem Sieg des Bürgertums und seiner Etablierung als herrschender Klasse verschob sich die Bedeutung der Toleranz. Aus einem Kampfruf gegen die Unterdrückung und für die Freiheit, wurde Toleranz mehr und mehr der Ausdruck eines intellektuellen und moralischen laissez faire. Das Verhältnis von Menschen, die sich als Käufer und Verkäufer auf dem freien Markt treffen, setzte diese Art Toleranz voraus; die Individuen mussten sich unabhängig von ihren subjektiven Meinungen und Wertmaßstäben als abstrakt gleich wertvoll anerkennen, sie mussten Wertungen für etwas Privates und in die Beurteilung eines Menschen nicht Einzugehendes ansehen. Toleranz wurde ein Relativismus von Werten, die selbst zum privaten und niemand anderen etwas angehenden Besitz des Individuums erklärt wurden. Im Bewusstsein ging die Duldung unbegrenzt weit. In Wirklichkeit hatte sie ihre klaren, wenn auch unausgesprochenen Grenzen dort, wo die Grundlage der bestehenden Ordnung bedroht war. Dies gilt nicht nur für direkte Bedrohungen politischer oder sozialer Art, sondern auch für die [I-121] Verletzung jener fundamentalen Tabus, die zum „Kitt“ der Gesellschaft gehören und für den Bestand einer auf Klassengegensätzen aufgebauten Gesellschaft unerlässlich sind. Die unerbittliche Strenge gegen jeden Übertreiber dieser Tabus kann in Zeiten, wo die Herrschaft des Bürgertums relativ gesichert und stabil ist, aus dem Bewusstsein weitgehend verschwinden. Sie bleibt aber nichtsdestoweniger im Unbewussten erhalten und kommt sofort an die Oberfläche, wenn vitale persönliche oder gesellschaftliche Interessen ernsthaft in Frage stehen. Die liberalistische Toleranz, wie sie sich im Neunzehnten Jahrhundert entwickelt hat, ist in sich widerspruchsvoll: Im Bewusstsein der Menschen herrscht ein Relativismus gegenüber allen Werten überhaupt, im Unbewussten eine nicht minder strenge Verurteilung aller Tabuverletzungen.
Diese Problematik des Toleranzbegriffes zeigt sich bereits in klassischen Äußerungen zu Beginn der bürgerlichen Periode. Mirabeau wendet sich gegen den Begriff der Toleranz mit einer Polemik gegen den Artikel 10 der Erklärung der Menschenrechte von 1789, der die Toleranz proklamierte, indem er sagt: „Ich will keine Toleranz predigen. Die unbeschränkteste Religionsfreiheit ist in meinen Augen ein so heiliges Recht, dass das Wort Toleranz, mit dem sie ausgedrückt werden soll, mir in einer Art selbst tyrannisch erscheint, denn das Vorhandensein einer Autorität, die die Macht zur Toleranz hat, ist ein Attentat auf die Denkfreiheit, da sie das, was sie duldet, auch ebenso gut nicht dulden könnte“ (zit. nach A. Aulard, 1924, S. 36).
Mirabeaus radikale Formulierung verdeckt noch den Tatbestand, dass sich die liberalistische Toleranz nur auf das Denken und Reden, nicht aber auf das Handeln bezieht, vielmehr hier sehr schnell ihre Grenze findet. Diese Grenze der bürgerlichen Toleranzidee kommt bei Kant deutlich zum Ausdruck. Was Kant als Freiheit in der Gesellschaft fordert, ist wesentlich die Freiheit des Gelehrten, als Gelehrter zu schreiben und zu sagen, was er denkt. Ihr entspricht die unbedingte Gehorsamspflicht des Bürgers gegen die gesetzgebende Obrigkeit. „Nun ist zu manchen Geschäften, die in das Interesse des gemeinen Wesens laufen, ein gewisser Mechanismus notwendig, vermittelst dessen einige Glieder des gemeinen Wesens sich bloß passiv verhalten müssen, um durch eine künstliche Einhelligkeit von der Regierung zu öffentlichen Zwecken gerichtet oder wenigstens von der Zerstörung dieser Zwecke abgehalten zu werden. Hier ist es nun freilich nicht erlaubt zu räsonieren; sondern man muss gehorchen“ (I. Kant, 1913, S. 171).
Den Wertrelativismus dieser Toleranzidee zeigt ein Erlass des Nationalkonvents von 1793:
Der Nationalkonvent (...) hindert Euch nicht in Euren Meinungen, stellt Euch keine Gewissensfragen, und das erste Gesetz, das er im Namen des Volkes erlassen hat, dessen Organ er ist, enthält in aller Form die Anerkennung der freien Übung aller Kulte. Übt also unbesorgt die Bräuche, die Ihr für gut haltet. Dienet dem Schöpfer der Natur auf Eure Weise. Juden, Christen, Mohammedaner, Schüler des Konfuzius oder Anbeter des großen Lama, Ihr seid in den Augen eines freien Volkes alle gleich. (Zit. nach A. Aulard, 1924, S. 390.)
Den hervorragendsten Ausdruck fand die liberale Toleranz in den verschiedenen bürgerlichen Reformbestrebungen. In der Strafrechtsreform war sie bestrebt, den Kriminellen zu erklären, zu entschuldigen und seine Behandlung in den Strafanstalten zu verbessern. Man verstand manche der psychologischen und sozialen [I-122] Bedingungen seines Handelns und betrachtete ihn als einen Menschen, der ja eigentlich „gar nicht so schlimm“ ist, dessen Handlungen man irgendwie verstehen kann und über den man deshalb nicht den Stab brechen soll. Aber bei aller Milde und Toleranz dem Verbrecher gegenüber kam die bürgerliche Strafrechtsreform doch nie dazu, den Begriff des Verbrechens prinzipiell aufzuheben. Auch der liberalste Strafrechtsreformer hätte es, wenn auch unter allen möglichen Rationalisierungen, abgelehnt, einen „Verbrecher“ zum Schwiegersohn zu haben, wollte seine Tochter einen Defraudanten heiraten, der im Gefängnis gesessen hat. Nicht wesentlich anders ist es mit der Schulreform. Man erlaubte den Kindern der bessergestellten gesellschaftlichen Schichten ein größeres Maß an Freiheit, verzichtete auf Strafen oder spezielle religiöse Unterweisung, aber keineswegs darauf, ihren Charakter im Sinne der grundlegenden Erfordernisse ihrer Klasse zu formen. Streben nach Erfolg, Pflichterfüllung, Respekt vor den Tatsachen, waren unabdingbare Erziehungsziele, auch wenn man in vielen einzelnen, aber nicht fundamentalen Dingen ein großes Maß an Freiheit erlaubte.
Die psychoanalytische Situation ist ein anderer Ausdruck der bürgerlich-liberalistischen Toleranz. Hier soll ein Mensch einem anderen gegenüber solche Gedanken und Impulse zum Ausdruck bringen, die im schroffsten Gegensatz zu den gesellschaftlichen Tabus stehen, und der andere soll nicht entrüstet auffahren, keinen moralisierenden Standpunkt einnehmen, sondern objektiv und freundlich bleiben, kurz auf jede beurteilende Einstellung verzichten. Diese Haltung ist nur denkbar auf dem Boden jener allgemeinen Toleranz, wie sie sich im wachsenden Maße im großstädtischen Bürgertum ausgebildet hat, und tatsächlich sind die Psychoanalytiker fast ausschließlich Angehörige des großstädtisch-liberalen Bürgertums, dessen Vertreter wir auch in allen Reformbewegungen treffen. Auch die Toleranz des Psychoanalytikers hat die zwei Seiten, von denen oben gesprochen wurde: Einerseits wertet er nicht, steht allen Erscheinungen objektiv und neutral gegenüber, andererseits aber teilt er, wie jedes andere Mitglied seiner Klasse, den Respekt vor den fundamentalen gesellschaftlichen Tabus und empfindet dieselbe Abneigung gegen jeden, der sie verletzt. Es wird ihm gewiss besonders leicht, diese Abneigung aus seinem Bewusstsein zu bannen. Zunächst einmal deshalb, weil ihm gar nichts anderes übrigbleibt, wenn er überhaupt eine Praxis ausüben will. Dann aber, weil ein kranker, leidender Mensch zu ihm kommt, der gleichsam mit seiner Neurose die Strafe für seine unsozialen Tendenzen schon erlitten hat. Da nun die verurteilende Einstellung, die auch bei Freud keineswegs fehlt, im wesentlichen unbewusst ist, so ist es schwierig, ihr Vorhandensein nachzuweisen. Die wichtigste Quelle für diesen Nachweis ist das Studium der Persönlichkeit des Analytikers selbst. Ein solcher Versuch ist an dieser Stelle nicht möglich. Immerhin aber erlauben auch die Schriften Freuds eine gewisse Einsicht in den hinter der Toleranz versteckten Respekt vor den gesellschaftlichen Tabus des Bürgertums.
Da Freud in der Verdrängung sexueller Impulse die wichtigste Ursache der neurotischen Erkrankung gesehen hat, ist es der beste Ausgangspunkt, seine Stellung zur bürgerlichen Sexualmoral bzw. zu ihrer Verletzung zu studieren. Gewiss hat Freud eine kritische Stellung zur bürgerlichen Sexualmoral eingenommen. Er hat ferner den Mut gehabt nachzuweisen, dass sexuelle Impulse auch da eine Rolle spielen, wo man [I-123] bisher ganz andere „ideale“ Motive gesehen hatte, und selbst da, wo – wie beim kleinen Kinde – die Annahme sexueller Motive geradezu ein Sakrileg bedeutete. Seine nicht-liberalen Gegner haben ihm dieser Haltung wegen den Vorwurf der Pansexualität gemacht, ja man hat gesagt, er sei der typische Vertreter einer libertinistischen dekadenten Gesellschaftsschicht. Wie steht es aber in Wirklichkeit mit Freuds Haltung zur Sexualmoral? Gewiss ist er tolerant, und gewiss hat er an der bürgerlichen Sexualmoral die Kritik geübt, dass ihre allzu große Strenge häufig zu neurotischen Erkrankungen führt. Aber selbst wo die Kritik an der bürgerlichen Sexualmoral zum Gegenstand wird, in der Arbeit Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität (1908d) kommt zum Ausdruck, dass seine Haltung kritisch, aber keineswegs prinzipiell von derjenigen seiner Klasse verschieden ist. Freud unterscheidet in diesem Aufsatz drei Kulturstufen:
eine erste, auf welcher die Betätigung des Sexualtriebes auch über die Ziele der Fortpflanzung hinaus frei ist; eine zweite, auf welcher alles im Sexualtrieb unterdrückt ist bis auf das, was der Fortpflanzung dient, und eine dritte, auf welcher nur die legitime Fortpflanzung als Sexualziel zugelassen wird. Dieser dritten Stufe entspricht unsere gegenwärtige, „kulturelle“ Sexualmoral. (S. Freud, 1908d, S. 152.)
Er stellt die Frage:
Erstens, welche Aufgabe die Kulturforderung der dritten Stufe an den einzelnen stellt; zweitens, ob die zugelassene legitime Sexualbefriedigung eine annehmbare Entschädigung für den sonstigen Verzicht zu bieten vermag; drittens, in welchem Verhältnis die etwaigen Schädigungen durch diesen Verzicht zu dessen kulturellen Ausnützungen stehen. (S. Freud, 1908d, S. 156.)
Auf diese erste Frage antwortet Freud: „Was unsere dritte Kulturstufe von dem einzelnen fordert, ist die Abstinenz bis zur Ehe für beide Geschlechter, die lebenslange Abstinenz für alle solche, die keine legitime Ehe eingehen“ (S. Freud, 1908d, S. 156). „Die Mehrzahl der unsere Gesellschaft zusammensetzenden Personen“ sei „der Aufgabe der Abstinenz konstitutionell nicht gewachsen“, den meisten gelingt die Sublimierung ihrer Sexualität nicht; sie „werden neurotisch oder kommen sonst zu Schaden“ (S. Freud, 1908d, S. 156).
Auf die Frage, ob der Sexualverkehr in legitimer Ehe eine volle Entschädigung für die Einschränkung vor der Ehe bieten kann, gibt Freud eine verneinende, aber recht merkwürdige Antwort. Er weist darauf hin, dass unsere kulturelle Sexualmoral
auch den sexuellen Verkehr in der Ehe selbst beschränkt, indem sie den Eheleuten den Zwang auferlegt, sich mit einer meist sehr geringen Anzahl von Kinderzeugungen zu begnügen. Infolge dieser Rücksicht gibt es befriedigenden sexuellen Verkehr in der Ehe nur durch einige Jahre, natürlich noch mit Abzug der zur Schonung der Frau aus hygienischen Gründen erforderten Zeiten. Nach diesen drei, vier oder fünf Jahren versagt die Ehe, insofern sie die Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse versprochen hat, denn alle Mittel, die sich bisher zur Verhütung der Konzeption ergeben haben, verkümmern den sexuellen Genuss, stören die feinere Empfindlichkeit beider Teile oder wirken selbst direkt krankmachend. (S. Freud, 1908d, S. 157.)
Freud geht hier weit über das hinaus, was er eigentlich sagen will. Seine Absicht ist ja nach seinen eigenen Worten bloß die Kritik an der Sexualmoral der dritten Stufe, der Monogamie. Er will zeigen, dass die Monogamie keine genügende Sexualbefriedigung zulässt, die Nervosität steigert, und dass deshalb Grund vorliegt, eine Milderung unserer Sexualmoral ins Auge zu fassen. Er begründet aber die Kritik an der Monogamie mit Argumenten [I-124] – nämlich der Schädlichkeit der konzeptionsverhütenden Mittel und der Unmöglichkeit unbeschränkter Kinderzahl –, die ganz in der gleichen Weise auch für eine von der heutigen abweichende „reformierte“ Sexualmoral gelten würden, also speziell für eine Moral, die den vor- und außerehelichen Sexualverkehr erlaubt. Diese „Fehlleistung“ darf man wohl so interpretieren, dass darin jene unbewusste, tief skeptische Haltung zum Ausdruck kommt, die er zur Möglichkeit eines befriedigenden Sexuallebens überhaupt hat. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn man berücksichtigt, dass, wäre ihm entscheidend an der Schaffung von Verhältnissen gelegen, die volle Sexualbefriedigung zulassen, er im Rahmen seiner Argumentation den größten Nachdruck auf die Möglichkeit der Verbesserung der Methoden zur Konzeptionsverhütung gelegt hätte, statt sich mit der bloßen Feststellung ihres bisherigen Versagens zu begnügen. Die gleiche skeptische Haltung drückt sich in seiner Beantwortung der dritten Frage aus. Er erklärt sich „für unfähig, Gewinn und Verlust hier richtig gegeneinander abzuwägen“ (S. Freud, 1908d, S. 159), gibt aber immerhin zu bedenken, dass die Abstinenz im allgemeinen der Entwicklung eines energischen aktiven Charakters hinderlich ist und leicht zur Ausbildung sexueller Anomalitäten führt. „Man darf wohl die Frage aufwerfen“, so schließt er diesen Aufsatz,
ob unsere „kulturelle“ Sexualmoral der Opfer wert ist, welche sie uns auferlegt, zumal, wenn man sich vom Hedonismus nicht genug freigemacht hat, um nicht ein gewisses Maß von individueller Befriedigung unter die Ziele unserer Kulturentwicklung aufzunehmen. Es ist gewiss nicht Sache des Arztes, selbst mit Reformvorschlägen hervorzutreten; ich meinte aber, ich könnte die Dringlichkeit solcher unterstützen, wenn ich die von Ehrenfels’sche Darstellung der Schädigungen durch unsere „kulturelle“ Sexualmoral um den Hinweis auf deren Bedeutung für die Ausbreitung der modernen Nervosität erweitere. (S. Freud, 1908d, S. 167.)
Selbst in diesem Aufsatz, der die für Freud radikalste Kritik an der bürgerlichen Sexualmoral darstellt, ist er ein typischer Reformer. Er weist auf die Gefahren hin, die die strikte Sexualmoral mit sich bringt, plädiert für gewisse Erleichterungen, zeigt aber in der tief skeptischen Haltung gegenüber der Möglichkeit adäquater Sexualbefriedigung überhaupt, dass seine Kritik in keiner Weise prinzipiell ist. Zeigt er in diesem Aufsatz immerhin noch Züge eines Kritikers, so nimmt er in dem vier Jahre später geschriebenen Aufsatz Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens (S. Freud, 1912d), eindeutig eine Stellung zugunsten der von ihm so genannten „kulturellen“ Sexualmoral ein. Er sagt (S. 87 f.):
Angesichts der in der heutigen Kulturwelt so lebhaften Bestrebungen nach einer Reform des Sexuallebens ist es nicht überflüssig, daran zu erinnern, dass die psychoanalytische Forschung Tendenzen so wenig kennt wie irgendeine andere. Sie will nichts anderes als Zusammenhänge aufdecken, indem sie Offenkundiges auf Verborgenes zurückführt. Es soll ihr dann recht sein, wenn die Reformen sich ihrer Ermittlungen bedienen, um Vorteilhafteres an Stelle des Schädlichen zu setzen. Sie kann aber nicht vorhersagen, ob andere Institutionen nicht andere, vielleicht schwerere Opfer zur Folge haben müssten.
Die Tatsache, dass die kulturelle Zügelung des Liebeslebens eine allgemeinste Erniedrigung der Sexualobjekte mit sich bringt, mag uns veranlassen, unseren Blick [I-125] von den Objekten weg auf die Triebe selbst zu lenken. Der Schaden der anfänglichen Versagung des Sexualgenusses äußert sich darin, dass dessen spätere Freigebung in der Ehe nicht mehr voll befriedigend wirkt. Aber auch die uneingeschränkte Sexualfreiheit von Anfang an führt zu keinem besseren Ergebnis. Es ist leicht festzustellen, dass der psychische Wert des Liebesbedürfnisses sofort sinkt, sobald ihm die Befriedigung bequem gemacht wird. Es bedarf eines Hindernisses, um die Libido in die Höhe zu treiben, und wo die natürlichen Widerstände gegen die Befriedigung nicht ausreichen, haben die Menschen zu allen Zeiten konventionelle eingeschaltet, um die Liebe genießen zu können. Dies gilt für Individuen wie für Völker. In Zeiten, in denen die Liebesbefriedigung keine Schwierigkeiten fand, wie etwa während des Niederganges der antiken Kultur, wurde die Liebe wertlos, das Leben leer, und es bedurfte starker Reaktionsbildungen, um die unentbehrlichen Affektwerte wiederherzustellen. In diesem Zusammenhang kann man behaupten, dass die asketische Strömung des Christentums für die Liebe psychische Wertungen geschaffen hat, die ihr das heidnische Altertum nie verleihen konnte. Zur höchsten Bedeutung gelangte sie bei den asketischen Mönchen, deren Leben fast allein von dem Kampfe gegen die libidinöse Versuchung ausgefüllt war.
Hier wird ein Freud deutlich, der die konventionellen Anschauungen über die Sexualmoral in vollem Maße teilt. Was in dem vorher erwähnten Aufsatz nur zwischen den Zeilen und unbeabsichtigt zum Ausdruck kam, wird hier offen und explizit ausgedrückt.
Dass Freud im Grunde die herrschenden Anschauungen über die Sexualmoral teilt, kommt auch in seinen Theorien über die Entwicklung der Kultur und über die Sublimierung zum Ausdruck. Für ihn ist die Kulturentwicklung der Menschheit bedingt durch einen fortschreitenden Prozess der Triebunterdrückung und Verdrängung. Nicht nur die sogenannten prägenitalen Triebe müssen unterdrückt werden, sondern auch ein Teil der genitalen Sexualität muss den verdrängenden Kräften zum Opfer fallen, damit kulturelle Leistungen möglich sind. Freud kommt zu folgendem, wenn auch mit Einschränkungen versehenen Schluss:
So müsste man sich denn vielleicht mit dem Gedanken befreunden, dass eine Ausgleichung der Ansprüche des Sexualtriebes mit den Anforderungen der Kultur überhaupt nicht möglich ist, dass Verzicht und Leiden sowie in weitester Ferne die Gefahr des Erlöschens des Menschengeschlechts infolge seiner Kulturentwicklung nicht abgewendet werden können. Diese trübe Prognose ruht allerdings auf der einzigen Vermutung, dass die kulturelle Unbefriedigung die notwendige Folge gewisser Besonderheiten ist, welche der Sexualtrieb unter dem Drucke der Kultur angenommen hat. Die nämliche Unfähigkeit des Sexualtriebes, völlige Befriedigung zu ergeben, sobald er den ersten Anforderungen der Kultur unterlegen ist, wird aber zur Quelle der großartigsten Kulturleistungen, welche durch immer weitergehende Sublimierungen seiner Triebkomponenten bewerkstelligt werden. Denn welches Motiv hätten die Menschen, sexuelle Triebkräfte anderen Verwendungen zuzuführen, wenn sich aus denselben bei irgendeiner Verteilung volle Lustbefriedigung ergeben hätte? Sie kämen von dieser Lust nicht wieder los und brächten keinen weiteren Fortschritt zustande. So scheint es, dass sie durch die [I-126] unausgleichbare Differenz zwischen den Anforderungen der beiden Triebe – des sexuellen und des egoistischen – zu immer höheren Leistungen befähigt werden, allerdings unter einer beständigen Gefährdung, welcher die Schwächeren gegenwärtig in der Form der Neurose unterliegen. (S. Freud, 1912d, S. 91.)
Die Alternative, die Freud für die Entwicklung der Menschheit aufstellt, ist, etwas zugespitzt ausgedrückt, die zwischen Kultur und Sexualbefriedigung. Je weiter die Kultur fortschreitet, je höher sie sich entwickelt, desto mehr müssen die Menschen ihre Sexualität unterdrücken, bis, wie Freud einmal meint, die Kulturentwicklung mit Notwendigkeit zum Aussterben der Menschheit führt. Es soll hier nicht die Richtigkeit dieser Theorie einer Prüfung unterzogen werden. Es ist aber klar, dass angesichts der selbstverständlich positiven Bewertung der Kultur eine solche Alternative der Sexualität das Stigma des Kulturfeindlichen und damit Negativen verleiht.
Die Freudsche Theorie von der Sublimierung enthält im Grunde dieselbe skeptische, wenn nicht negative Haltung zur sexuellen Befriedigung. Freud versteht unter Sublimierung die Umwandlung sexueller Energien in solche für kulturelle Leistungen, und für ihn bedeutet Sublimierung eine „Gabe“, welche die, denen sie eigen ist, davor schützt, unter der Verdrängung ihrer Sexualität neurotisch zu erkranken. Er spricht davon, zur Sublimierung bedürfe es des „Talents“ (S. Freud, 1912e, S. 385). Frauen hätten dieses Talent seltener als Männer (vgl. S. Freud, 1908d, S. 157 f.), und von vielen Neurotikern könnte man sagen, „dass sie überhaupt nicht erkrankt wären, wenn sie die Kunst, ihre Triebe zu sublimieren, besessen hätten“ (S. Freud, 1912e, S. 385). Man soll aber in dieser Hinsicht keinen „erzieherischen Ehrgeiz“ (S. Freud, 1912e, S. 385) haben, der sowenig zweckmäßig sei wie der therapeutische. „Das Bestreben, die analytische Behandlung regelmäßig zur Triebsublimierung zu verwenden, ist zwar immer lobenswert, aber keineswegs in allen Fällen empfehlenswert“ (S. Freud, 1912e, S. 385). Auch hier finden wir eine ähnliche Alternative wie die soeben angedeutete zwischen Kultur und Sexualbefriedigung. Der Mensch, der das Talent zur Sublimierung nicht in genügender Weise besitzt, muss sich entscheiden zwischen einer genügenden Sexualbefriedigung und der Neurose, und Freud ist geneigt, unter diesen Umständen die sexuelle Befriedigung vorzuziehen. Aber die Sublimierung wie die Kultur stehen in einem starren Gegensatz zur Sexualität und sind, wertmäßig gesehen, für Freud zweifellos das Höhere und Überlegene. Freud zeigt hier eine Toleranz, die in manchem an die der katholischen Kirche erinnert. Da so viele Menschen die Gabe zur Sublimierung nicht besitzen und an der Verdrängung ihrer Sexualität erkranken, so soll man ihnen eben ein etwas größeres Maß an sexueller Freiheit geben. Damit schränkt man allerdings die kulturelle Möglichkeit ein, aber im Gegensatz zwischen Kultur und Neurose gibt es keine befriedigende Lösung, und die Einsicht in die menschliche Schwäche muss zu einer nachsichtigen und verzeihenden Haltung führen. Gerade diese Skepsis gibt Freuds Toleranz eine besondere Note. Man verzichtet auf Wertungen, weil man im Grunde an den Menschen und dem Unglück ihrer Verhältnisse doch nichts ändern kann und man sich begnügen muss, die schlimmsten Schäden wiedergutzumachen. Hier liegt auch ein Grund, warum Freud und manche seiner Schüler der Analyse eine übertriebene Bedeutung für die Gesellschaft zusprechen. Sie glauben, die Neurose sei bedingt durch den grundsätzlichen Konflikt zwischen der Kultur [I-127] und den Ansprüchen des Trieblebens, und da man durch keine mögliche Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse diesen Konflikt beseitigen könne, sei das einzige und beste, was übrigbliebe, die Opfer der Kultur analytisch zu heilen.
Freuds Haltung äußert sich auch in einer Reihe von Redewendungen deutlich viktorianischer Art. So nennt er das grobsinnliche Verlangen einer Patientin dem Analytiker gegenüber „abstoßend“ und muss alle Toleranz aufrufen, „um es als natürliches Phänomen gelten zu lassen“ (S. Freud, 1915a, S. 319). Oder er spricht in den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie von den „abscheulichsten Perversionen“ und dem „greulichen Erfolg“ (S. Freud, 1905d, S. 61) der zur Perversion führenden Triebregungen. Manche der Perversionen nennt er „unmoralisch“, und das „unkultivierte Durchschnittsweib“ bezeichnet er voller Abscheu als zur Perversität neigend, eine Anlage, „die von der prostituierten Dirne berufsmäßig ausgebeutet“ werde (S. Freud, 1905d, S. 92). Allerdings fügt er an dieser Stelle hinzu, die Anlage zur Perversion sei das allgemein „Menschliche und Ursprüngliche“, aber dies scheint im Grunde nur wieder ein Zeichen von Menschenverachtung, eine Art psychologischen rationalisierten Dogmas von der Erbsünde zu sein. Die eben zitierte Äußerung über die Frau führt uns zu Freuds entwertender, feindseliger Haltung zur Frau, die nur ein anderer Ausdruck seiner genuss- und sexualfeindlichen Einstellung ist. Die Frau sei weniger zur Sublimierung fähig, habe kein so starkes Über-Ich wie der Mann, neige zur Perversion und sei intellektuell minderwertig, und dies alles in erster Linie nicht aus gesellschaftlichen Gründen, sondern aus anatomisch-biologischen, der Ermangelung des männlichen Geschlechtsorgans, das sie ihr ganzes Leben in den verschiedensten Gestalten als Mann, Kind oder Besitz ersatzweise sich anzueignen versuche.
Wir haben aus zwei Gründen die Haltung Freuds zur Sexualität als Beispiel seiner „Toleranz“ herausgegriffen. Einmal, weil nach seiner eigenen Auffassung die verdrängten sexuellen Regungen zum wichtigsten Verdrängungsmaterial gehören, und zweitens, weil über die Haltung Freuds zur Sexualmoral noch die ausführlichsten Äußerungen vorliegen. Wie sehr er die konventionellen gesellschaftlichen Tabus, die er selbst bewusst in so entschiedener und theoretisch fruchtbarer Weise kritisiert hat, unbewusst anerkennt, tritt jedoch auch an anderen Stellen der psychoanalytischen Technik in Erscheinung. Freud setzt als Ziel der analytischen Theorie die Herstellung der „Arbeits- und Genussfähigkeit“ eines Menschen. Diese Arbeits- und Genussfähigkeit wird im wesentlichen als eine biologische Größe gesehen, vergleichbar etwa der Gehfähigkeit eines Menschen, dessen verletztes Bein der Arzt wiederherzustellen hat. In Wirklichkeit aber verbirgt sich hinter dieser biologischen Kategorie ein klarer gesellschaftlicher Inhalt. Arbeits- und genussfähig sein, heißt sich verhalten, wie es der bürgerlichen Norm entspricht, heißt die Ideale der herrschenden Gesellschaft erfüllen und ihre Tabus respektieren. Der Analytiker selbst stellt in diesem Sinn ein Vorbild dar. Er ist der erfolgreiche berufstätige Bürger, und als solcher tritt er dem Patienten gegenüber. Wie sehr Freud bis in jede Einzelheit das kapitalistische Verhalten als das natürliche, gesunde, vom Analytiker zu fordernde ansieht, zeigt eine kleine, aber sehr bezeichnende Einzelheit aus seinen Ratschlägen zur Technik. Wie oben angedeutet, rät er dem Analytiker zu verlangen, dass der Patient auch dann die ihm verabredungsgemäß gehörenden Stunden bezahle, wenn er durch Krankheit [I-128] oder andere Dinge daran gehindert sei, zur Analyse zu kommen. Er begründet dies zum Teil damit, dass sich der Widerstand häufig in vorübergehenden Erkrankungen oder anderen zufälligen Verhinderungen äußere und dass bei diesem Arrangement solche „Schulkrankheiten“ seltener vorkommen. Dies ist sicher richtig, aber es ist nicht die einzige Begründung, die er gibt. Die andere lautet, dass, wenn der Patient die ausfallende Stunde nicht bezahle, die materielle Existenz des Analytikers durch eine Häufung solcher Ausfälle gefährdet werde. Dass der Analytiker durch das Ausbleiben des Patienten freie Zeit für sich gewinnt, zählt nicht. Hätte man durch das Ausbleiben eines Patienten freie Zeit, so wäre dies eine Muße, sagt Freud, „deren man sich als Erwerbender zu schämen hätte“ (S. Freud, 1913c, S. 459). Das Gefühl, dass es eine Schande bedeutet, freie, nicht erwerblich ausgenutzte Zeit zu besitzen, und dass die maximale Ausnutzung der Zeit zum Gelderwerb eine selbstverständliche Forderung sei, ist kennzeichnend für den kapitalistischen Charakter in seiner ausgeprägtesten Form. Freud sieht diese Haltung als eine menschlich natürliche an, die auch für den Analytiker zu fordern sei. Alle Abweichungen von dieser Norm gelten als „neurotisch“. Wenn etwa jemand einer radikalen Partei angehört, gleichviel welcher, so beweist er damit, dass er seinen aus dem Ödipuskomplex stammenden Vaterhass noch nicht überwunden hat, wenn jemand eine nach Alter oder sozialer Schicht der bürgerlichen Norm nicht entsprechende Ehe eingeht, oder sich mit Bezug auf Beruf und Karriere nicht in der gesellschaftlich üblichen Weise verhält, ja sogar wenn er der Freudschen Theorie widerspricht, so beweist er eben damit, dass er unanalysierte Komplexe hat und „Widerstände“, wenn er dieser Diagnose des Analytikers widerspricht. Es wird hier gewiss nicht bestritten, dass das von der Norm abweichende Verhalten triebhafte und oft unbewusste Quellen haben kann, aber das Gleiche gilt auch für das „normale“ Verhalten. Häufig liegen gewiss auch hinter diesen Verhaltensweisen neurotische Wurzeln, aber das Wesentliche ist, dass es für Freud von vorneherein feststeht, dass das, was der bürgerlichen Norm widerspricht, „neurotisch“ ist. Freud und ein Teil seiner Schüler verwenden da psychologische Fachausdrücke, wo andere Mitglieder der gleichen Gesellschaftsschicht ungeschminkt werten. „Neurotisch“, „infantil“, „unanalysiert“ heißt in dieser Sprache schlecht und minderwertig, „Widerstand“ heißt hartnäckige Verstocktheit, „Genesungswille“ heißt Reue und Wunsch, sich zu bessern. Es ist nur ein besonders prägnantes Beispiel für den eben geschilderten Tatbestand, wenn vor einigen Jahren ein Wiener Analytiker, Eduard Hitschmann, Leiter des Ambulatoriums der Wiener Psychologischen Vereinigung, seinen Ansichten über die Ehe dahingehend Ausdruck gab, dass ein Junggeselle ein gesellschaftlicher Schädling sei, ein Mensch, der pflichtvergessen ein ständiger Bedroher fremder Ehen und damit der ganzen Gesellschaft sei. Diese von Kanzeln und Rednerpulten häufig zu hörenden Ansichten waren aber nicht als moralische Wertungen vorgetragen, sondern als wissenschaftliche Feststellungen, und der erwähnte Aufsatz trug den Titel Der unbekannte Neurotiker.[5]
Nicht anders verhält es sich mit dem in den letzten Jahren in der analytischen Theorie und Praxis populär gewordenen „Strafbedürfnis“. Die Annahme, dass es ein den Triebbedürfnissen analoges biologisch bedingtes Strafbedürfnis gebe, ist nur ein anderer Ausdruck dafür, die Tabus der jeweiligen Gesellschaft für ewige und ihre [I-129] Verletzungen für notwendig zu sühnende zu halten. Indem Freud die moralischen Forderungen im Über-Ich repräsentiert sein lässt, das er aus den von ihm für biologisch gegebenen „Ödipuskomplex“ ableitet, hat er eine neue psychologische Rationalisierung für eine absolut gedachte Moral geliefert.
Zu dieser allgemeinen Identifizierung mit den Tabus der bürgerlichen Gesellschaft kommt noch ein besonderes Moment. Die bürgerliche Gesellschaft ist durch ihren patriarchalen oder patrizentrischen Charakter gekennzeichnet. (Vgl. zum Folgenden Die sozialpsychologische Bedeutung der Mutterrechtstheorie, 1934a, GA I, S. 85-109.) Die patrizentrische Einstellung sieht als Sinn des Lebens nicht das Glück des Menschen, sondern Pflichterfüllung und Unterordnung unter eine Autorität. Der Anspruch auf Glück und Liebe ist nicht unbedingt; er ist bedingt vom Maß der Pflichterfüllung und Unterwerfung und bedarf auch in dem geringen zugelassenen Maß einer Rechtfertigung durch Leistung und Erfolg. Freud ist ein klassischer Vertreter des patrizentrischen Charaktertyps. Ohne dass wir an diesem Ort darauf im einzelnen eingehen können, sei nur auf folgende Punkte hingewiesen. Einen Ausdruck dieser Haltung sehen wir in dem Umstand, dass die meisten seiner kulturtheoretischen Lehren in einseitiger Weise von dem Konflikt zwischen Vater und Sohn aus konstruiert sind; einen anderen in seiner versteckten Glücks- und Genussfeindlichkeit, von der oben ausführlicher die Rede war; einen weiteren in der Tatsache, dass in seiner ganzen Theorie Liebe und Zärtlichkeit nur als den sexuellen Genuss begleitende Gefühle bzw. als gehemmte Sexualität vorkommen, dass aber eine unabhängig von sexuellen Interessen existierende Menschenliebe nicht Gegenstand seiner Psychologie ist; endlich in seinem persönlichen Verhalten zu seinen Schülern, denen nur die Wahl zwischen völliger Unterordnung oder der Erwartung rücksichtsloser Bekämpfung durch den Lehrer bleibt, was auch seine materiellen Konsequenzen hat.
Das Problem des patrizentrischen Charakters des Analytikers ist von entscheidender Bedeutung für die analytische Therapie. Der Patient braucht vielleicht nichts nötiger für seine Genesung als eine unbedingte Bejahung seiner Ansprüche auf Lebensglück. Er muss bei seiner Behandlung fühlen, dass der Analytiker die menschliche Forderung auf Glück als unabdingbar und unbedingt bejaht. Gerade der in der bürgerlichen Familie durchschnittlich herrschende Mangel einer solchen unbedingten Bejahung, die Grausamkeit, mit der „Feinde“ oder „Misserfolg“ gleichgesetzt werden und beide als gerechte Strafe auch nur eines Fehltritts angesehen werden, gehören wohl zu den wichtigsten Bedingungen der neurotischen Erkrankungen. Soll einem in dieser Atmosphäre erkrankten Menschen geholfen werden, in dem unbewussten Sektor seiner Triebwelt Klarheit zu schaffen, so bedarf es einer Umgebung, in welcher er der unbedingten, durch nichts zu erschütternden Bejahung seiner Glücksansprüche sicher ist, ja, da der Neurotiker meistens gar nicht wagt, sie zu stellen, einer Haltung des Analytikers, die ihn dazu ermutigt. Die patrizentrische Haltung lässt eine solche Atmosphäre nicht aufkommen. Aus ihr ergibt sich eine analytische Situation, deren unausgesprochenen oder zum Teil unbewussten Kern man karikierend etwa folgendermaßen ausdrücken kann:
Hier kommst du, Patient, mit allen deinen Sünden. Du bist schlecht gewesen, und deshalb leidest du. Aber man kann dich entschuldigen. Die wichtigsten Gründe für deine Verfehlungen liegen in Ereignissen deiner Kindheit, für die du nicht verantwortlich zu machen bist. Zudem willst du dich ja bessern und zeigst [I-130] es, indem du zur Analyse kommst und dich meinen Anordnungen fügst. Wenn du dich aber nicht fügst, nicht einsiehst, dass ich mit dem, was ich von dir verlange oder über dich sage, recht habe, dann ist dir nicht zu helfen, und der letzte Ausweg aus deinem Leiden versperrt.
Es lässt sich nicht leugnen, dass nicht selten der Mangel an Unterwerfung im Analytiker des patrizentrischen Charaktertyps eine, wenn auch oft unbewusste, Feindseligkeit gegen den Patienten erweckt und dass diese Feindseligkeit nicht nur jeden therapeutischen Erfolg unmöglich macht, sondern eine ernsthafte Gefahr für die seelische Gesundheit des Patienten darstellt. Die eben skizzierte patrizentrisch autoritäre Haltung des Analytikers ist auch bei Freud als solche nicht bewusst; sie ist vielmehr verdeckt durch die typisch liberalistische Tendenz, jeden nach seiner Fasson selig werden zu lassen. Wir finden Äußerungen von Freud wie die, „man soll den Patienten nicht zu seinem Leibgut machen“. Für die Wirkung aber, die die Haltung des Analytikers auf den Patienten hat, ist nicht die bewusste Einstellung des Analytikers das Entscheidende, sondern die unbewusst autoritäre patrizentrische Haltung, die gewöhnlich hinter der „Toleranz“ versteckt ist.[6]
Neben dem von uns bisher beschrittenen Weg, aus den Äußerungen Freuds unmittelbar einen gewissen Einblick in seine Haltung dem Patienten gegenüber zu gewinnen, gibt es noch einen indirekten, nämlich das Studium der zum Teil verstärkten Gegensätze innerhalb der psychoanalytischen Bewegung zwischen Freud und seinem engsten Kreis einerseits und den „oppositionellen“ Analytikern andererseits.[7]
Typische Repräsentanten dieser oppositionellen Haltung sind zwei kürzlich verstorbene Analytiker, die trotz aller sonstigen Verschiedenheit in den hier zur Diskussion stehenden Punkten viel Gemeinsames aufweisen: Georg Groddeck und Sándor Ferenczi.
Groddeck, eine Persönlichkeit von genialer psychologischer Intuition, war ein Verächter der Wissenschaft. Er gehört seiner Denkart nach zu den romantischen Vorläufern der Psychoanalyse wie Carus und Bachofen, mit denen er auch die rückschrittliche Haltung in gesellschaftlichen Fragen teilt. Über die hier zur Rede stehenden Fragen hat er sich in systematisch-theoretischer Form kaum geäußert. Man ist gezwungen, sich an seine halb wissenschaftlichen, halb novellistischen Bücher und an persönliche Eindrücke zu halten. Man erkennt sofort die völlig andere Haltung, die hier zur Sexualmoral und zu allen anderen Tabus der bürgerlichen Gesellschaft herrscht, eine Haltung, die bei ihm, ähnlich wie die Kritik der französischen Gegenrevolutionäre an einzelnen Seiten des Bürgertums, aus einer feudalen Einstellung hervorging. Hier spricht ein Mann, der in jedem Satz zeigt, dass für ihn die Sexualität wie alles Triebhafte überhaupt keine Spur des Sündhaften oder Verbotenen an sich [I-131] hat. Bei ihm fehlt die versteckte Prüderie, die für Freud so typisch ist. Seine Haltung zum Patienten war nicht weich, aber voller Humanität und echter Freundlichkeit. Für ihn war der Patient der Mittelpunkt, und der Analytiker hatte ihm zu dienen. Infolge des Mangels an rationaler und wissenschaftlicher Neigung und Disziplin gibt es keine, die Bedeutung seiner Persönlichkeit auch nur annähernd wiedergebende literarische Hinterlassenschaft. Seine Wirksamkeit war vor allem eine persönliche, und die Entwicklung von Ferenczi, auf dessen Kontroverse mit Freud wir jetzt ausführlicher eingehen, ist nur durch den starken Einfluss, den Groddeck auf ihn ausgeübt hat, zu verstehen.
Ferenczi war voll produktiver Phantasie, gütig, dabei aber im Gegensatz zu Groddeck weich und ängstlich. Sein Leben stand unter dem Einfluss Freuds und Groddecks, und es fehlte ihm die Kraft, zwischen beiden zu wählen. In den letzten Jahren seines Lebens entfernte er sich mehr und mehr von Freud, dessen Eigenart diese theoretische Differenz für einen Menschen wie Ferenczi zur persönlichen Tragödie werden ließ. Er wagte nie, sich in offenen Gegensatz zu Freud zu stellen, und je mehr er erkannte, dass ihn seine Anschauung über die Mängel der Freudschen Technik in einen persönlichen Gegensatz zu diesem führen musste, desto schwieriger wurde seine persönliche Situation. Gerade die Ängstlichkeit Ferenczis, Freud offen entgegenzutreten, bewirkte es, dass er den Gegensatz zwischen Versicherungen der Loyalität versteckt hat. Demjenigen, der mit der analytischen Literatur nicht näher vertraut ist, mag es bei der Lektüre der Ferenczischen Arbeiten kaum verständlich erscheinen, dass die winzigen Nuancen, in denen Ferenczi seine Abweichung von Freud ausdrückte, den Inhalt eines Konflikts bilden könnten. Es scheint auch merkwürdig, dass Dinge wie die Forderung, man solle dem Patienten gegenüber ein gewisses Maß an Liebe zeigen, die beinahe selbstverständlich klingen, den Grund zu einem Gegensatz gebildet haben sollen. Aber gerade die Selbstverständlichkeit der Ferenczischen Forderungen und die Geringfügigkeit der in der Diskussion zum Ausdruck gekommenen Differenzen ist geeignet, die Eigenart der Freudschen Position besonders deutlich zum Ausdruck kommen zu lassen.
In einem Vortrag auf dem 10. Internationalen Psychoanalytischen Kongress am 3. 9. 1927 wies Ferenczi darauf hin, wie entscheidend wichtig es sei, dass der Patient sich der unbedingten Sympathie des Analytikers sicher fühle. Er sagt:
Eine recht schwierige, allerdings interessante Aufgabe, die meines Erachtens in jedem einzelnen Falle zu bewältigen ist, ist die stufenweise Abtragung jener Widerstände, die in dem mehr oder minder bewussten Zweifel an der Verlässlichkeit des Analytikers bestehen. Unter Verlässlichkeit muss man aber eine Vertrauenswürdigkeit unter allen Umständen verstehen, insbesondere das unerschütterliche Wohlwollen des Analytikers dem Patienten gegenüber, mag sich letzterer in seinem Benehmen und in seinen Äußerungen noch so ungebührlich gebärden. Man könnte tatsächlich von einem unbewussten Versuch des Patienten reden, die Tragfestigkeit der Geduld des Analytikers bezüglich dieses Punktes konsequent auf die verschiedenste Art auf die Probe zu stellen, und dies nicht nur einmal, sondern zu ungezählten Malen. Die Patienten beobachten dabei die Reaktionsweise des Arztes, mag sie sich in Rede, Geste oder in Stillschweigen manifestieren, aufs [I-132] allerscharfsinnigste. Sie analysieren ihn oft mit großem Geschick. Sie entdecken die leisesten Anzeichen unbewusster Regungen im Analytiker, der diese Analysenversuche mit unerschütterlicher Geduld zu ertragen hat; eine oft fast übermenschliche Leistung, die aber die Mühe in jedem Falle lohnt. Denn: ist es dem Patienten nicht gelungen, den Analytiker bei irgendeiner Unwahrheit oder Entstellung zu ertappen, und kommt der Patient allmählich zur Erkenntnis, dass es wirklich möglich ist, die Objektivität auch dem schlimmsten Kinde gegenüber zu bewahren, lässt sich also beim Arzt keine Tendenz zur Selbstüberhebung feststellen (bei aller Anstrengung, Anzeichen davon zu provozieren), und muss der Patient zugeben, dass der Arzt willig auch Irrtümer und Unbedachtsamkeiten seinerseits erkennt, die er gelegentlich begeht, so kann man nicht selten eine mehr oder minder rasche Veränderung im Verhalten des Kranken als Lohn für die nicht geringe Mühe einheimsen. (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 232 f.)
In unserem Zusammenhang wichtig ist eine weitere Äußerung Ferenczis in diesem Vortrag. Er sagt, dass nur dann eine Analyse erfolgreich beendet werden kann, wenn der Patient seine Angst vor dem Analytiker verloren hat und ihm gegenüber „Gefühle der Gleichberechtigung“ (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 234) erlangt hat. Aus der gleichen Haltung stammt seine Forderung, den Weisungen des Analytikers an einen Patienten müsse „der Charakter des Befehls“ (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 234) genommen werden, und seine Ansicht, die Beendigung der Analyse dürfe dem Patienten nicht vom Analytiker gegen dessen Willen aufgezwungen werden.
In einem im gleichen Jahre veröffentlichten anderen Vortrag führt Ferenczi diesen Gedanken fort, wenn er über die Haltung des Analytikers folgendes sagt:
Nichts ist schädlicher in der Analyse als das schulmeisterliche oder auch nur autoritative Auftreten des Arztes. Alle unsere Deutungen müssen eher den Charakter eines Vorschlages denn einer sicheren Behauptung haben, und dies nicht nur, damit wir den Patienten nicht reizen, sondern weil wir uns tatsächlich auch irren können... Die Bescheidenheit des Analytikers sei also nicht eine eingelernte Pose, sondern der Ausdruck der Einsicht in die Begrenztheit unseres Wissens. (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 243 f.)
Im Verfolg dieses Gedankenganges fordert er „mehr als christliche Demut“ dem Patienten gegenüber und meint, dass diese zu den schwierigsten Aufgaben der psychoanalytischen Praxis gehöre.
Bringen wir sie aber zustande, so mag uns die Korrektur auch in den verzweifeltsten Fällen gelingen. Ich muss nochmals betonen, dass auch hier nur die wirkliche Gefühlseinstellung hilft; eine nur gemachte Pose wird vom scharfsinnigen Patienten mit Leichtigkeit entlarvt. (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 245.)
Wichtig für Ferenczis Gegensatz zu Freud und allen seinen Versuchen, „das Über-Ich“ zu einer dem „Es“ ebenbürtigen, biologisch bedingten Instanz zumachen, ist die im gleichen Aufsatz vorgetragene Ansicht über das Schicksal des „Über-Ichs“ in der Analyse.
An vielen Orten wurde, unter anderen auch von mir, darauf hingewiesen, dass der Heilungsvorgang zu einem großen Teil darin besteht, dass der Patient den Analytiker (den neuen Vater) an die Stelle des in seinem Über-Ich so breiten Raum einnehmenden wirklichen Vaters setzt und nunmehr mit diesem analytischen Über-Ich weiterlebt. Ich leugne nun nicht, dass dieser Prozess in allen Fällen wirklich vor sich geht, gebe auch zu, dass diese Substitution bedeutende therapeutische Erfolge [I-133] mit sich bringen kann, möchte aber hinzufügen, dass eine wirkliche Charakteranalyse, wenigstens vorübergehend, mit jeder Art von Über-Ich, also auch mit dem des Analytikers, aufzuräumen hat. Schließlich muss ja der Patient von aller gefühlsmäßigen Bindung, soweit sie über die Vernunft und die eigenen libidinösen Tendenzen hinausgeht, frei werden. Nur diese Art Abbau des Über-Ichs überhaupt kann eine radikale Heilung herbeiführen; Erfolge, die nur in der Substitution des einen Über-Ich durch ein anderes bestehen, müssen noch als Übertragungserfolge bezeichnet werden; dem Endzweck der Therapie, auch die Übertragung loszuwerden, werden sie gewiss nicht gerecht. (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 247 f.)
Seine Ängstlichkeit hat Ferenczi verhindert, das Problem in prinzipieller Weise weiter zu verfolgen, und ihn bei einer Kompromissphrase wie „wenigstens vorübergehend“ haltmachen lassen.
Trotzdem ist der Gegensatz zur Freudschen Position deutlich genug. Als positive Eigenschaft des Analytikers fordert er in diesem Aufsatz „Takt“ und „Güte“, und er nennt als Beispiel dafür, wie diese Eigenschaft zum Ausdruck kommen müsse, die Fähigkeit zu erkennen, „wann das Schweigen (des Analytikers) ein unnützes Quälen des Patienten ist“ (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 239).
Zwei Jahre später verfolgt Ferenczi den gleichen Gedankengang in einem auf dem 11. Internationalen Psychoanalytischen Kongress gehaltenen Vortrag über Fortschritte der psychoanalytischen Technik (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 257-273).
Hier wagt er schon eine direktere, wenn auch immer noch vorsichtige Kritik an Freuds Technik. Er schildert seine eigene Entwicklung als Psychoanalytiker. Ich konnte mich“, sagt er (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 261),
des Eindrucks nicht erwehren, dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patienten gar zu sehr einem Schüler-Lehrer-Verhältnis ähnlich wurde. Ich kam auch zur Überzeugung, dass die Patienten mit mir höchst unzufrieden waren und sich nur nicht getrauten, sich gegen dieses Lehrhafte und Pedantische in uns offen zu empören. In einer meiner technischen Arbeiten forderte ich denn auch die Kollegen auf, ihre Analysanden zu größerer Freiheit und freierem Auslebenlassen der Aggressivität dem Arzt gegenüber zu erziehen, zugleich mahnte ich sie zu etwas größerer Demut den Patienten gegenüber, zum Einbekennen eventuell begangener Fehler, plädierte für größere Elastizität, eventuell auch auf Kosten unserer Theorien (die ja doch nicht unwandelbare, wenn auch vorläufig brauchbare Instrumente sind), und konnte schließlich auch davon berichten, dass die den Patienten gewährte größere Freiheit der Analyse nicht nur nicht geschadet, sondern nach Austobenlassen aller Aggressionen positive Übertragung und auch positivere Erfolge zeitigt.
Er schildert dann, wie er im Laufe seiner vieljährigen praktischen analytischen Tätigkeit immer wieder die von Freud gegebenen Ratschläge zur Technik verletzte. Er zwang den Patienten nicht, während der Analyse zu liegen und den Analytiker unsichtbar hinter sich zu haben. Er analysierte auch in Fällen, wo der Patient nicht bezahlen konnte. Er verlängerte nicht selten die Stunde, um die schockartige Wirkung des plötzlichen Abbrechens zu vermeiden, oder analysierte einen Patienten, wenn nötig, zwei oder mehr Stunden am gleichen Tag. An Stelle des „Prinzips der Versagung“, das „manche meiner Kollegen und seinerzeit auch ich mit übermäßiger Strenge [I-134] anwandten“ (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 263), stellte er nun das „Prinzip der Gewährung“ auf, das neben jenem Anwendung finden müsse. Er kritisiert die von Freud geforderte „kühle Objektivität dem Patienten gegenüber“, die Formen annehmen könne, welche „dem Patienten unnötige und vermeidbare Schwierigkeiten bereite“ (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 265); er verlangt, Mittel und Wege zu finden, „freundlich-wohlwollende Haltung während der Analyse dem Patienten begreiflich zu machen“. Noch einmal weist er, wenn auch wiederum vorsichtig darauf hin, dass die orthodoxe Technik die Gefahr in sich berge, den Patienten „mehr als unbedingt nötig leiden zu lassen“ (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 266). Die gleichen Gedanken wiederholt er in dem Festvortrag anlässlich des 75. Geburtstags von Freud 1931 in der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, eingeleitet durch eine Verteidigung Freuds gegen den Vorwurf, „er dränge alle selbständigen Talente aus diesem Kreis heraus, um tyrannisch seinen wissenschaftlichen Willen durchzusetzen“ (S. Ferenczi, 1972, Band 2, S. 274).
Freud hat dem entscheidenden Gegensatz zwischen sich und Ferenczi, allerdings ebenfalls unter einer feinen Nuancierung versteckt, in seinem Nachruf auf Ferenczi Ausdruck gegeben. Er spricht zunächst von den langen Jahren der „sicheren Zusammengehörigkeit“ und gemeinsamen Arbeit und fährt dann fort:
Nach dieser Höhenleistung (der Veröffentlichung von Versuch einer Genitaltheorie) ereignete es sich, dass der Freund uns langsam entglitt. Von einer Arbeitssaison in Amerika zurückgekehrt, schien er sich immer mehr in einsame Arbeit zurückzuziehen, der doch vorher an allem, was in analytischen Kreisen vorfiel, den lebhaftesten Anteil genommen hatte. Man erfuhr, dass ein einziges Problem sein Interesse mit Beschlag belegt hatte. Das Bedürfnis zu heilen und zu helfen war in ihm übermächtig geworden. Wahrscheinlich hatte er sich Ziele gesteckt, die mit unseren therapeutischen Mitteln heute überhaupt nicht zu erreichen sind. Aus unversiegten affektiven Quellen floß ihm die Überzeugung, dass man bei den Kranken weit mehr ausrichten könnte, wenn man ihnen genug von der Liebe gäbe, nach der sie sich als Kinder gesehnt hätten. Wie das im Rahmen der psychoanalytischen Situation durchführbar sei, wollte er herausfinden, und solange er damit nicht zum Erfolg gekommen war, hielt er sich abseits, wohl auch der Übereinstimmung mit den Freunden nicht mehr sicher. Wohin immer der von ihm eingeschlagene Weg geführt hätte, er konnte ihn nicht mehr zu Ende gehen. (S. Freud, 1933c, S. 267 ff.)
Freud hat in diesem Nachruf selbst auf den Kern des Gegensatzes hingewiesen. Wie charakteristisch sind seine Formulierungen. Das Bedürfnis zu heilen und zu helfen sei „übermächtig geworden“ und aus „unversiegten affektiven Quellen“ sei Ferenczi die Überzeugung von der Notwendigkeit der Liebe zum Kranken geflossen. Freud sagt nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, „unversiegbare“, und man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, dass Freud mit dem Ausdruck „unversiegte“ meint, hier lägen bei Ferenczi infantile, durch die Analyse nicht beseitigte Triebregungen vor.
Der frühe Tod Ferenczis ist ein tragischer Abschluss seines Lebens. Zerrissen von der Angst vor seinem Bruch mit Freud und der Einsicht in die Notwendigkeit einer von der Freudschen abweichenden Technik, hatte er nicht die innere Kraft, den Weg zu Ende zu gehen. Sein Gegensatz zu Freud ist prinzipiell: der Gegensatz zwischen einer [I-135] humanen, menschenfreundlichen, das Glück des Analysanden in unbedingter Weise bejahenden Haltung und einer patrizentrisch-autoritären, in der Tiefe menschenfeindlichen „Toleranz“.
Wir haben versucht, unmittelbar aus den Äußerungen von Freud und mittelbar aus der vorsichtigen Polemik Ferenczis gegen ihn, die Eigenart der Freudschen Toleranz darzustellen. Wir wollten zeigen, dass sich hinter der Wertfreiheit und Liberalität eine Haltung verbirgt, die die Tabus der bürgerlichen Moral nicht weniger respektiert und ihre Verletzung nicht weniger verabscheut als die konservativen Mitglieder der gleichen Gesellschaftsschicht. Bietet diese Toleranz eine optimale Bedingung dafür, dass der Patient seinen eigenen Widerstand durchstoßen und das verdrängte Material in sein Bewusstsein heben kann? Sicherlich nicht. Mag der Analytiker nach außen eine noch so freundliche Haltung einnehmen, dabei aber, wenn auch ihm selbst gar nicht bewusst, den Patienten verurteilen und ablehnen, das Unbewusste des Patienten wird diese Verurteilung fühlen, und zur mitgebrachten Angst wird sich die in der analytischen Situation produzierte addieren und die Analyse in die Länge ziehen oder gar zum Scheitern verurteilen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121439
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Menschenbild Individuum Gesellschaft Natur Kultur Wesen Freudsches Menschenbild The Nature of Man R. Xirau Triebtheorie Herbert Marcuse