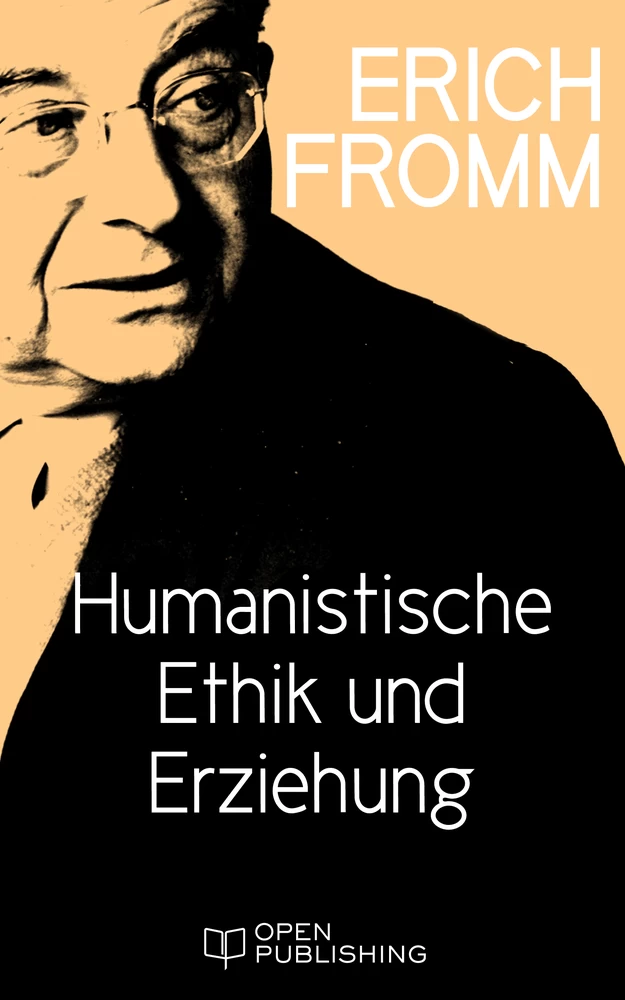Zusammenfassung
Aus dem Inhalt
• Die moralische Verantwortung des modernen Menschen
• Psychologie und Werte
• Der kreative Mensch
• Freiheit in der Arbeitswelt
• Zum Problem der Menschenrechte aus der Sicht des Klinikers
• Psychologische Probleme des Alterns
• Die psychologischen und geistigen Probleme des Überflusses
• Vorwort in A. S. Neill „Summerhill“
• Pro und Contra Summerhill
• Einleitung in I. Illich „Almosen und Folter“
• Father Wassons Prinzipien produktiver Erziehung
• Der Wille zum Leben
• Vita activa
• Von der Kunst des Lebens
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Humanistische Ethik und Erziehung
- Inhalt
- Die moralische Verantwortung des modernen Menschen
- Psychologie und Werte
- Der kreative Mensch
- Freiheit in der Arbeitswelt
- Zum Problem der Menschenrechte aus der Sicht des Klinikers
- Psychologische Probleme des Alterns
- Die psychologischen und geistigen Probleme des Überflusses
- Vorwort in A. S. Neill „Summerhill“
- Pro und Contra Summerhill
- Einleitung in I. Illich „Almosen und Folter“
- Father Wassons Prinzipien produktiver Erziehung
- Der Wille zum Leben
- Vita activa
- Von der Kunst des Lebens
- Hinweise zur Übersetzung
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Die moralische Verantwortung des modernen Menschen
(The Moral Responsibility of Modern Man)
(1958d)[2]
Wenn ich über die moralische Verantwortung bzw. über das ethische Problem des modernen Menschen spreche[3], dann möchte ich von vornherein ein Missverständnis ausschließen: Das gegenwärtige intellektuelle Klima ist von einem Relativismus in der Ethik gekennzeichnet. Im allgemeinen wird die Auffassung vertreten, Werte besäßen nur deshalb Gültigkeit, weil sie innerhalb einer bestimmten Kultur von der Gesellschaft akzeptiert werden. Die Normen des Kopfjägers erfüllen ihren Zweck bei den Kopfjägern, und das Gesetz der Nächstenliebe erfüllt seinen Zweck bei den Kulturen, die diese Norm akzeptiert haben. Die meisten Sozialwissenschaftler vertreten den Standpunkt, dass Werte und Normen keine allgemeine, objektive, universale Gültigkeit besitzen. Wenn ich nun hier über das ethische Problem des modernen Menschen spreche, könnte das so klingen, als ob ich diese Einstellung teilte. Das ist aber keineswegs der Fall. Ich bin ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass es gewisse Grundnormen und -werte für das Leben gibt, die vor Tausenden von Jahren von allen großen geistigen Führern der Menschheit mit einer bemerkenswerten Übereinstimmung erkannt wurden, obgleich diese untereinander keinen Kontakt hatten. Diese Werte besitzen für alle Menschen Gültigkeit und sind in der Natur des Menschen selbst, in den Bedingungen seiner Existenz begründet. Dies setzt natürlich die Annahme voraus, dass es so etwas wie den Menschen überhaupt gibt, nicht nur – wovon wir alle überzeugt sind – im physiologischen oder anatomischen Sinne, sondern auch im geistigen und psychologischen. Wir können also von einer Natur, von einem Wesen des Menschen als von einer definierbaren und nachweisbaren Größe sprechen.[4] Dies ist eine weitere Annahme, von der ich fürchte, dass sie nicht von den meisten heutigen Sozialwissenschaftlern geteilt wird.
Leider kann ich hier nicht im einzelnen ausführen, was ich unter der „Natur des Menschen“ verstehe. Da Worte ohne entsprechende Beispiele bedeutungslos bleiben, möchte ich dazu einige Beobachtungen anführen.
Der Mensch ist eine Laune der Natur. Er ist das einzige Lebewesen, das sich seiner selbst bewusst ist. Er ist das einzige Wesen, das innerhalb der Natur lebt und sie gleichzeitig transzendiert. Der Mensch ist sich seiner selbst, seiner Vergangenheit und seiner Zukunft bewusst. Der Mensch lebt nicht nur instinktiv, so wie es das Tier tut. [IX-320] Er ist weitgehend aus der Natur entwurzelt und steht vom Augenblick seiner Geburt an vor dem Problem, eine Frage zu beantworten, die das Leben ihm stellt: Was sollen wir aus unserem Leben machen? Wohin gehen wir? Welchen Sinn geben wir dem Leben? Soweit ich sehen kann, ist dies nur eine Frage, und es gibt nur wenige Antworten darauf. Diese Antworten sind in der Geschichte der Menschheit zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten wiederholt worden. Man hat sie bald in dieser, bald in jener Form in Begriffe gefasst, und nur wenige Antworten tauchen in der gleichen Form immer wieder auf. Man könnte sagen, die Geschichte der Religion und die Geschichte der Philosophie seien tatsächlich die Geschichte oder das System dieser wenigen möglichen Antworten. Aber wir alle müssen eine Antwort geben, und welches Leben wir führen, hängt ab von der Antwort, die wir geben.
Ich möchte an einem Beispiel verdeutlichen, was ich meine. Der Mensch muss zu seinen Mitmenschen und zur Natur in Beziehung treten. Der völlig beziehungslose Mensch ist wahnsinnig, ja man kann den Wahnsinn gerade so definieren, dass man sagt, er sei der Zustand eines völlig beziehungslosen Menschen. Die Bezogenheit auf andere Menschen kann nun aber ganz verschieden aussehen. Für sie können Unterwerfung, Machtausübung oder eine Marketing-Orientierung typisch sein. Bei der Marketing-Orientierung besteht die Bezogenheit aus einem ständigen Tausch, so wie man auf dem Markt Gebrauchswaren tauscht. Man kann aber auch zum anderen Menschen in liebender Weise bezogen sein. Diese Art ist angesichts der Natur des Menschen die einzig befriedigende Art, weil die Liebe die einzige Form der Bezogenheit ist, die gleichzeitig die Integrität und die Wirklichkeit der Beteiligten wahrt. Man kann auch „lieben“, indem man sich dem anderen unterwirft, oder indem man über ihn Macht ausübt; dann aber verlieren beide – derjenige, der sich dem anderen unterwirft, wie derjenige, unter dessen Macht er steht – ihre Integrität und die grundlegende menschliche Eigenschaft der Unabhängigkeit. Bei der echten Liebe bleiben Bezogenheit auf den anderen und Integrität erhalten.
Die vorstehenden Aussagen machen deutlich, dass das ethische Problem für den Menschen immer das Gleiche ist. Es gibt kein echtes ethisches Problem nur für ein bestimmtes Land oder nur für ein bestimmtes Alter. Es gibt besondere Verhältnisse, in denen Menschen leben und durch die sie sich unterscheiden, und deshalb ergeben sich unterschiedliche Aspekte ein und desselben ethischen Problems, die ich hier erörtern möchte.
Heute machen die meisten Menschen einen Fehler, den die Franzosen im Zweiten Weltkrieg machten, als die glaubten, ihn mit der Taktik und Strategie des Ersten Weltkriegs führen zu können: Die meisten Menschen schauen heute auf die ethischen Probleme der letzten Generation oder des vergangenen Jahrhunderts zurück, sie blicken auf die Laster und Sünden der Vergangenheit, um freudig feststellen zu können, dass wir diese Laster und Sünden überwunden haben. Gleichzeitig schließen sie daraus, dass wir unsere eigenen ethischen Probleme heute größtenteils gelöst hätten. In Wirklichkeit sehen wir uns heute mit ebenso schweren ethischen Problemen konfrontiert, die nur anders aussehen als in der Vergangenheit. Dies soll im Folgenden aufgezeigt werden.
Welches waren die Laster des Neunzehnten Jahrhunderts? Ein erstes war der [IX-321] Autoritarismus, die Forderung nach blindem Gehorsam. Von den Kindern verlangte man ebenso wie von den Frauen und Arbeitern, dass sie den Autoritäten blindlings gehorchten, ohne über deren Befehle nachzudenken und ohne Fragen zu stellen. Ungehorsam war etwas in sich Sündhaftes.
Ein zweites Laster war die Ausbeutung, und zwar die rohe Ausbeutung. Heute mögen wir uns darüber wundern, dass es noch kurz vor dem Neunzehnten Jahrhundert möglich war, dass sich die Damen und Herren der guten Gesellschaft mit dem Sklavenhandel abgaben, dass die Neger im Kongo skrupellos ausgebeutet wurden, und dass Kinder in den Fabriken schamlos ausgenützt wurden. Dies waren die Laster und ethischen Probleme des Neunzehnten Jahrhunderts, die wir fast vergessen haben und an die wir uns heute nur mit Verwunderung erinnern.
Ein drittes Laster des Neunzehnten Jahrhunderts war die mangelnde Gleichberechtigung der Geschlechter und Rassen. Man war überzeugt, dass diese Ungleichheit wohl begründet war, dass sie dem Wort Gottes entsprach, und man interessierte sich in keiner Weise für die offensichtlichen Widersprüche, die zwischen dem Wort Gottes und einer derartigen Ungleichheit unter den Menschen bestand.
Geiz und Horten waren das vierte Laster des Neunzehnten Jahrhunderts, denn für die Mittelklasse galt das Sparen als größte Tugend. Man wurde reich, wenn man hortete, sparte, sein Geld zusammenhielt, nichts ausgab. Auch wenn dies heute nicht mehr als Tugend gilt, so war dies doch im Neunzehnten Jahrhundert so.
Schließlich ist der egozentrische Individualismus des Neunzehnten Jahrhunderts zu nennen. Typisch hierfür ist ein Satz von Freud, den dieser im Zusammenhang mit dem Gebot „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ äußert (S. Freud, 1930a, S. 468):
Warum sollen wir das? Was soll es uns helfen? Vor allem aber, wie bringen wir das zustande? (...) Ich tue sogar unrecht damit, denn meine Liebe wird von all den Meinen als Bevorzugung geschätzt; es ist ein Unrecht an ihnen, wenn ich den Fremden ihnen gleichstelle.
Freud hat hier mit Mut ausgesprochen, was damals viele Menschen empfanden, ohne es so klar auszudrücken: „My home is my castle – ich bin ich; nimm dich in Acht, Fremder!“
Vielleicht gab es noch mehr Laster im Neunzehnten Jahrhundert, doch sehen wir jetzt nach, was aus diesen Lastern inzwischen geworden ist.
Den Autoritarismus gibt es heute nicht mehr in der gleichen Weise wie im Neunzehnten Jahrhundert. Die Autoritäten des Neunzehnten Jahrhunderts sind aus den Vereinigten Staaten und aus einigen anderen Teilen der Welt fast völlig verschwunden. Wenn jemand Angst hat, dann sind es eher die Eltern, die vor den Kindern Angst haben, als umgekehrt – und das aus einem sehr einfachen Grunde. Heute ist man allgemein der Auffassung, dass das Neueste auch das Beste sein müsse. Da die Kinder immer neuer sind und mehr über die letzten Neuigkeiten wissen als ihre Eltern, müssen die Eltern nun von ihnen lernen.
Bevor ich auf die Frage der Autorität als ethisches Problem der Gegenwart zu sprechen komme, muss ich einige theoretische Erklärungen zum Begriff der Autorität vorausschicken. Es ist sinnvoll, zwischen rationaler und irrationaler Autorität zu unterscheiden. Irrationale Autorität geht immer mit Angst und Ausübung von Druck auf der Grundlage einer emotionalen Unterwerfung einher. Es ist dies die Autorität [IX-322] des blinden Gehorsams, die Art von Autorität, die man am deutlichsten ausgeprägt in allen totalitären Ländern findet.
Aber es gibt noch eine andere Art, die rationale Autorität, worunter ich jede Art von Autorität verstehe, die sich auf Kompetenz und Wissen gründet, die Kritik zulässt und die ihrer Natur nach dazu tendiert abzunehmen, die sich nicht auf die emotionalen Faktoren von Unterwerfung und Masochismus gründet, sondern auf die realistische Anerkennung der Kompetenz eines Menschen etwa in seinem Beruf. Wenn ich auf einem Schiff bin und eine kritische Situation eintritt und der Kapitän seine Befehle erteilt, dann werde ich mich auf keine Diskussion mit ihm einlassen. Ich werde mich seinen Anordnungen fügen, weil ich annehme und weil ich Grund zur Annahme habe, dass er kompetent ist. Wenn ich einen kompetenten Arzt aufsuche, so erkenne ich seine rationale Autorität an, weil ich überzeugt bin, dass er etwas von seinem Fach versteht und ich mich deshalb nach seinen Anordnungen richten muss. Dynamisch gesehen, handelt es sich hier um eine völlig andere Art von Autorität als bei der irrationalen, die sich auf ganz andere Motive gründet und andere Funktionen und Auswirkungen hat.
Ein weiterer Unterschied besteht zwischen der offen ausgeübten und der anonymen Autorität. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig und sollte nicht übersehen werden. Um offene Autorität handelt es sich, wenn der Vater zu Johnny sagt: „Tu das nicht, sonst weißt du, was passiert.“ Anonyme Autorität ist es, wenn die Mutter zu Johnny sagt: „Ich bin sicher, dass du das nicht tun möchtest.“ Johnny merkt am Ton ihrer Stimme, was sie möchte und was sie nicht möchte. Er hat schon oft die Erfahrung gemacht, dass sie mit Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Angst usw. reagiert, und er weiß, dass es für ihn schlimmere Folgen haben würde als eine tüchtige Tracht Prügel, wenn er nicht tut, was sie ihm stillschweigend zu verstehen gibt. Im ersten Fall ist die Autorität offen und unverblümt. Im zweiten Fall ist sie anonym, sie gibt sich den Anschein von Toleranz und Nachgiebigkeit, und doch weiß ein jeder, der die Spielregeln kennt, was erwartet wird. Die offene Autorität ist dabei unbedingt vorzuziehen, denn der Betreffende kann sich gegen ihren Anspruch zur Wehr setzen – was ja auch viele im Neunzehnten Jahrhundert getan haben. Die offene Autorität bietet die Chance, über die Auseinandersetzung seine Persönlichkeit zu entwickeln. Die anonyme Autorität hingegen ist so gut wie unangreifbar und wirkt aus dem Hinterhalt. Man weiß nicht, wer was will. Die Spielregeln liegen nicht offen zutage; man fühlt sie zwar, aber es gibt nichts, woran man sich halten könnte. Das Neunzehnte und das Zwanzigste Jahrhundert unterscheiden sich gerade hinsichtlich dieser beiden Arten von Autorität. Wie aber sieht die anonyme Autorität des Zwanzigsten Jahrhunderts aus? Sie ist der Markt, die öffentliche Meinung, der gesunde Menschenverstand, das, was alle tun, der Wunsch, sich nicht vom anderen zu unterscheiden, und die Angst, drei Meter von der Herde entfernt ertappt zu werden. Jeder lebt dabei in der Illusion, er handle aus eigenem freien Willen. In Wirklichkeit aber macht er sich über nichts so viele Illusionen, wie über sich selbst.
Wir sind mit Recht stolz darauf, dass unsere Einstellung zur Ausbeutung sich drastisch geändert hat. Niemand kann leugnen, dass in den großen westlichen Demokratien Ausbeutung in dem Sinn, wie sie im Neunzehnten Jahrhundert existierte, praktisch [IX-323] aufgehört hat, und dies nicht nur in unserem eigenen Land und in den westlichen Demokratien, sondern auch in Bezug auf die Kolonialvölker, die noch vor hundert Jahren Objekte roher Ausbeutung waren. Diese Form roher materieller Ausbeutung, bei der andere Menschen zum eigenen Vorteil ausgesaugt werden, ist vielleicht noch nicht ganz verschwunden, sie ist aber doch so zurückgegangen, dass sie in den nächsten Generationen ganz verschwinden dürfte. Aber etwas anderes ist geschehen. Heute beutet jedermann sich selbst aus. Jeder benutzt sich selbst zu Zwecken außerhalb seiner selbst. Es gibt nur ein allmächtiges Ziel, die Produktion von Dingen, und es geht gerade nicht um Ziele, zu denen wir uns mit den Lippen bekennen: um die volle Entwicklung der Persönlichkeit, um die volle Geburt, die volle Entfaltung des Menschen.
In jenem Prozess, bei dem es uns letzten Endes nur um die Produktion von Dingen, um die Umwandlung von Mitteln in Zwecke geht, verwandeln wir uns selbst in Dinge. Wir stellen Maschinen her, die sich wie Menschen benehmen, und wir produzieren Menschen, die mehr und mehr wie Maschinen handeln. Die Gefahr des Neunzehnten Jahrhunderts hätte sein können, dass wir zu Sklaven geworden wären. Die Gefahr des Zwanzigsten Jahrhunderts ist, dass wir zu Robotern oder Automaten werden. Gewiss sparen wir Zeit, aber wenn wir Zeit gespart haben, sind wir in Verlegenheit, weil wir nicht wissen, was wir mit der eingesparten Zeit anfangen sollen, und versuchen bestenfalls, sie totzuschlagen. Was geschähe wohl in den Vereinigten Staaten, wenn wir in der Woche nur noch drei Arbeitstage hätten? Ich bin sicher, wir hätten nicht genug Kliniken, um die seelischen Zusammenbrüche aufzunehmen, zu denen es käme, wenn man soviel Zeit zur Verfügung hätte und nicht wüsste, was man mit ihr anfangen kann. Wir beten die Dinge an, die Erzeugnisse unserer eigenen Hände, und beugen vor ihnen das Knie. In der Schule, im Kindergottesdienst oder in der Kirche sprechen wir vom Götzendienst und denken dabei vielleicht an Baal oder die Götzen der Kanaaniter, und wir fühlen uns als gute Christen, Juden, Mohammedaner oder was auch immer, die längst den Götzendienst überwunden haben. Aber wir haben nur sein Objekt gewechselt. Bei unserer Anbetung der Dinge, bei unserer Verehrung der Erzeugnisse unserer Hände handelt es sich genau um den gleichen Götzendienst, von dem die Propheten sprachen, und unsere Götter haben genau wie die Götzen, von denen die Propheten sprachen, Augen und können nicht sehen, und sie haben Hände, mit denen sie nichts berühren können.
Aber der Mensch ist kein Ding, und wenn er sich in ein Ding verwandelt, wird er krank, ob er es weiß oder nicht. Die Franzosen wissen über diese Krankheit seit dem Achtzehnten Jahrhundert weit besser Bescheid, und es gibt eigentlich nur französische Bezeichnungen für diese Krankheit – ennui, malaise, la maladie du siècle (die Krankheit des Jahrhunderts) –, eine Bezeichnung, die schon im Neunzehnten Jahrhundert geprägt wurde. Wir bezeichnen diese Krankheit als Langeweile, als das Gefühl der Sinnlosigkeit des Lebens, das Gefühl, dass wir freudlos inmitten der Fülle leben, dass das Leben uns wie Sand durch die Finger rinnt, dass wir nicht wissen, wohin wir gehen, und dass wir verwirrt und ratlos sind. Die Franzosen hatten einen Namen dafür, und wir haben eigentlich keinen; erst seit relativ kurzer Zeit haben wir ein Wort dafür und bezeichnen diese Krankheit als Neurose. [IX-324]
Nur wenige Menschen kommen zum Arzt und sagen: „Herr Doktor, ich empfinde mein Leben als sinnlos. Ich leide unter einer Langeweile, die ich nicht länger ertragen kann.“ Es empfiehlt sich heute nicht, so etwas zu sagen oder zu denken. Tatsächlich besitzt ja jede Kultur ihre eigene Ideologie der Krankheit. Butler hat das in Erehwon vorzüglich ausgedrückt. Wenn man da eine Erkältung hat, sagt man, man sei deprimiert. Wenn man bei uns deprimiert ist, hat man zu sagen, man sei erkältet. Man hat uns eingetrichtert, was wir als krank bezeichnen dürfen. Deshalb sagen die meisten Leute nicht, sie litten unter Langeweile und unter der Sinnlosigkeit ihres Lebens, sondern sie sagen, sie litten unter Schlaflosigkeit, unter ihrer Unfähigkeit, ihre Frau, ihren Mann oder ihre Kinder zu lieben, unter ihrem Bedürfnis zu trinken, unter ihrem beruflichen Unbefriedigtsein – unter allen möglichen Dingen, die sämtlich zugelassene und gesellschaftlich gebilligte Ausdrucksformen von Krankheit sind. Und trotzdem sind Schlaflosigkeit, Trinken und berufliches Unbehagen nur unterschiedliche Aspekte der malaise, der Krankheit des Jahrhunderts, eben der Sinnlosigkeit des Lebens, die ihren Grund darin hat, dass der Mensch sich in ein Ding verwandelt.
Beschäftigen wir uns nun mit dem dritten Laster und seiner Geschichte, mit der Ungleichheit. Es wird nur noch einige Generationen dauern, bis die Rassendiskriminierung in den Vereinigten Staaten ganz abgeschafft sein wird. Gewiss haben wir auch die Diskriminierung der Geschlechter abgeschafft, sofern man nicht annehmen will, dass es jetzt eine neue Diskriminierung in umgekehrter Form gibt. Ohne Zweifel lässt sich heute keine Frau mehr das von ihrem Mann gefallen, was noch vor hundert Jahren ein Ehemann seiner Frau im allgemeinen zumutete. Kein Vorarbeiter würde es heute in einer Fabrik wagen, mit den Arbeitern so zu sprechen und umzugehen, wie es noch vor hundert Jahren selbstverständlich war. Die Diskriminierung in diesem Sinne ist tatsächlich abgeschafft, und wir können hier auf die erreichte Gleichberechtigung stolz sein.
Bei der Gleichheit geht es jedoch nicht nur um diese Art von Gleichberechtigung. Der Begriff der Gleichheit wurde gegen den absolutistischen Staat in der Philosophie der Aufklärung entwickelt und bedeutet – nach Kant –, dass alle Menschen insofern einander gleich sind, als kein Mensch zum Mittel für die Zwecke eines anderen gemacht werden darf, dass jeder Mensch Selbstzweck und niemals Mittel ist und dass deshalb kein Mensch Rechte über andere Menschen hat, welche diesen zum Mittel für seine Zwecke machen könnten. Das bedeutete Gleichheit in der Philosophie der Aufklärung und im Humanismus. Heute wird unter Gleichheit meistens Gleichartigkeit verstanden: Gleich sein bedeutet soviel wie sich nicht unterscheiden. Ja man geht noch weiter und argumentiert: Wenn du gleichberechtigt sein willst, musst du gleich sein wie die anderen; bist du es nicht, dann bist du auch nicht gleichberechtigt. Viele gehen heute lieber mit anderen freiwillig konform, als dass sie dazu gezwungen würden. Es gehört zu den besten Eigenschaften der Vereinigten Staaten, dass sie den Nonkonformisten einen breiten Raum gewähren. Zwar werden ihnen nicht gerade die Spitzenpositionen reserviert, aber sie haben doch reichlich Spielraum. Sie laufen weder Gefahr, ins Gefängnis zu müssen noch zu verhungern. Dennoch ist die Neigung, mit anderen konform zu gehen, heute weitaus größer, als man es aus den gesellschaftlichen Verhältnissen erklären kann. Der Mensch erlebt sich selbst, seine [IX-325] Überzeugungen, seine Gefühle nicht mehr als etwas Eigenes. Er fühlt sich mit sich identisch, wenn er sich nicht mehr von den anderen unterscheidet. Passt er sich ihnen aber nicht an, so fühlt er sich von einer schrecklichen Einsamkeit bedroht und läuft Gefahr, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden.
Als viertes Laster nannten wir den Geiz. Wollte man das Horten und Sparen, die für unsere Großeltern noch große Tugenden waren, heute gewaltsam durchsetzen, so würde unsere Wirtschaft zusammenbrechen. Es geht dabei nicht um die Frage, dass man sich etwas zusammenspart, um es dann ausgeben zu können. Die Frage, um die es geht, wurde vor einiger Zeit im „New Yorker“ mit einer Karikatur so formuliert: Da sieht sich jemand einen neuen Wagen mit allen Schikanen an, doch er gefällt ihm nicht. Sein Freund sagt zu ihm: „Wenn er dir nicht gefällt, dann ist es zwar dein gutes Recht, dass er dir nicht gefällt, aber wenn er allen Amerikanern nicht gefiele, was würde dann aus unserer Wirtschaft?“ Der heutige Mensch muss tatsächlich Geld ausgeben und konsumieren, kaufen und verbrauchen. Das Konsumieren ist heute eine ebenso große Tugend wie das Sparen und Horten vor hundert Jahren.
Wir sind die ewigen Verbraucher. Wir konsumieren Zigaretten, Alkohol, Vorträge, Bücher, Filme und Menschen. Selbst wenn wir von der Liebe reden, die ein Kind von seinen Eltern braucht, dann reden wir so darüber, als handelte es sich um einen neuen Artikel, den ein Kind benötigt. Wir sind passive Verbraucher, wir leben inmitten eines ungeheuren Reichtums und sind die ewigen Säuglinge, die nach der Flasche, nach dem Apfel Ausschau halten; wir konsumieren, warten und sind ständig enttäuscht, weil wir nicht produktiv sind. Wir produzieren zwar Dinge, aber in unserer Beziehung zu anderen Menschen – in unserer Beziehung zu den Dingen – sind wir höchst unproduktiv.
Das fünfte Laster des Neunzehnten Jahrhunderts nannten wir die Haltung des My home is my castle. Vor einigen Jahren war in der Zeitschrift „Fortune“ ein Bericht über eine Siedlung in der Nähe von Chicago zu lesen. Eine Dame, die in einem der neuen Appartements wohnte, sagte zu dem Interviewer: „Ich bin so froh, dass die Wände so dünn sind. Wenn mein Mann verreist ist, habe ich nie das Gefühl, allein zu sein, weil ich hören kann, was im anderen Appartement vor sich geht.“ Hier geht es nicht mehr um My home is my castle, sondern um die Unfähigkeit, allein sein zu können, um die Unfähigkeit, ein Privatleben führen zu können, und um den Drang, mit anderen Menschen zusammensein zu müssen. Man nennt dies „Zusammengehörigkeitsgefühl“ oder „Teamwork“ oder noch anders, doch geht es immer um die Unfähigkeit, mit sich selbst allein sein zu können und das eigene Zurückgezogensein oder das des Nachbarn ertragen zu können. Wir haben es heute mit dem genauen Gegenteil dessen zu tun, was in der Mittel- und Oberschicht des Neunzehnten Jahrhunderts als Individualismus und Egozentrik zu beobachten war.
Um zusammenzufassen: Das Bild hat sich geändert, praktisch alle Laster des Neunzehnten Jahrhunderts sind verschwunden und haben den Lastern des Zwanzigsten Jahrhunderts Platz gemacht. Die Frage, was schlimmer ist, erübrigt sich fast. Es kommt darauf an, unser ethisches Problem heute zu erkennen und uns nicht auf unseren Lorbeeren auszuruhen und die Schlachten des letzten Krieges nochmals auszufechten. Richten wir den Blick auf die ethischen Probleme unserer Väter, dann [IX-326] vernachlässigen wir unsere gegenwärtigen und befinden uns auf einem schlechten Weg. Die ethischen Probleme, mit denen wir uns heute auseinanderzusetzen haben, sind ebenso ernst wie die der Menschen vor hundert Jahren.
Welches sind die Aufgaben der Gegenwart? Eine erste und wichtige Aufgabe besteht darin, eine Einstellung zu erkennen und zu überwinden, die sich in zunehmendem Maße seit dem Siebzehnten Jahrhundert entwickelt hat: die Spaltung des Menschen in Intellekt und Affekt, die Trennung des Denkens vom Gefühl. Seit Descartes haben Vertreter des modernen Rationalismus die affektive Seite des Menschen immer wieder als irrational oder nicht-rational abgestempelt, so dass nur der Intellekt und das Denken rational waren. Am klarsten und deutlichsten lässt sich dieser Rationalismus vielleicht bei Freud aufzeigen, für den die Liebe stets etwas Irrationales war, ob es sich nun um Nächstenliebe oder um erotische Liebe handelte. Rational sind der Intellekt und die Vernunft, und tatsächlich ist es – im Gegensatz zu vielen Missverständnissen über Freud – das Prinzip der Bewegung, die er auf der ganzen Welt ins Leben gerufen hat, den Affekt durch die Vernunft zu kontrollieren und zu beherrschen. Es ist dies der Grundsatz der Aufklärung und des Puritanismus, und Freud gehörte dorthin und nicht zu den berühmten dekadenten Wienern, wie manche behaupten.
Natürlich gab es bei diesem Prinzip der Spaltung auch Ausnahmen. Ich brauche nur an den berühmten Ausspruch von Pascal zu erinnern: „Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt“ (Pensées 277). Unser Affekt kann deshalb genauso rational, genauso in Übereinstimmung mit der Vernunft sein, wie unsere Gedanken. Das Fühlen hat seine eigene Rationalität, seine eigene Logik, und zwar meines Erachtens deshalb, weil es sich in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit der menschlichen Natur befindet.
Auch Spinoza war eine große Ausnahme bezüglich dieser Spaltung. Für ihn gab es zwei Arten von Affekten, passive und aktive. Die passiven Affekte entsprechen dabei in etwa dem, was wir heute mit irrationalen Affekten bezeichnen, also etwa Neid und Hass (eigenartigerweise war für Spinoza auch das Mitleid ein irrationaler Affekt). Nach Spinoza sind wir hinsichtlich der passiven Affekte Sklaven und nicht Herren. Den passiven werden aber aktive Affekte entgegengestellt, durch die unser Tätigkeitsvermögen (unsere actiones) vermehrt wird. Über diese aktiven Affekte sind wir Herr; sie stehen in Übereinstimmung mit dem Modell der menschlichen Natur, begleiten den Prozess wachsender Vitalität und ermöglichen die Erfahrung von Freude. Für Spinoza gibt es drei aktive Affekte, die man ähnlich auch im buddhistischen Denken findet: Geisteskraft, Willensstärke und Edelsinn.[5]
Pascal und Spinoza waren Ausnahmen; andere Ausnahmen lassen sich vor allem bei den Romantikern des Neunzehnten Jahrhunderts finden. Sie betonen nicht den Intellekt, sondern ganz im Gegenteil ist für sie alles das gut, was nicht intellektuell ist. (An ihnen lässt sich auch der Unterschied zwischen Freud und Jung verdeutlichen: Freud war seinem Wesen nach ein Rationalist, für den alles, was nicht intellektuell war, als irrational galt. Jung war seinem Wesen nach ein Romantiker. Für ihn war alles, was nicht intellektuell war, gut und weise. Diese Wertung spielt besonders bei seiner Vorstellung vom Unbewussten eine große Rolle.) [IX-327]
Warum ist unser Denken so kopflastig geworden? Weshalb hat sich in den letzten drei oder vier Jahrhunderten der Schwerpunkt mehr und mehr von der Betonung der Vernunft und der Intensität der Leidenschaften in Richtung auf den Intellekt verlagert? Wenigstens einige Hinweise seien gegeben: Die Schwerpunktverlagerung hat viel mit unserer Produktionsweise, mit der zunehmenden Wertschätzung der Technik und mit der Notwendigkeit zu tun, unseren Intellekt für die Zwecke der Wissenschaft und die Wissenschaft für die Zwecke der Technik zu entwickeln. Wir können die Gesellschaft, deren Hauptanliegen die Produktion ist, nicht ganz von der menschlichen Entwicklung trennen, in welcher der Intellekt zum höchsten Wert wird. Doch wenn wir mit unserem gegenwärtigen ethischen Problem fertig werden wollen, müssen wir uns ernsthaft anstrengen, die Spaltung zwischen Affekt und Intellekt zu überwinden. Wir müssen den Menschen in seiner Totalität, oder wie ich lieber sagen würde: Wir müssen den wirklichen Menschen wieder entdecken. Ich bin nicht getrennt in Geist und Körper. Ich bin ich und du bist du; mein Herz und meine Gefühle können ebenso rational sein wie mein Denken. Und meine Gedanken können ebenso irrational sein wie mein Herz. Doch es ist mir nicht möglich, unabhängig voneinander von meinem Herzen und meinem Denken zu reden, weil sie in Wirklichkeit eines sind, nur zwei Aspekte des gleichen Phänomens. Es gibt nur eine Logik, nur eine Rationalität und nur eine Irrationalität, die sie beide durchdringt. Ob wir psychosomatische Krankheiten oder Erscheinungen von Massenhysterie untersuchen, immer geht es um ein und dasselbe. Das Denken kann durch das Gefühl verdummt oder erleuchtet werden, und umgekehrt. Dies gilt es zunächst zu erkennen, damit wir nicht mehr allein schon durch die Tatsache verwirrt werden, dass wir Gefühle haben.
Während des psychoanalytischen Prozesses kann man manchmal miterleben, wie jemand zunächst ganz davon überzeugt ist, glücklich zu sein. Er liebt seine Frau und seine Kinder und ist zufrieden. Gräbt man etwas tiefer, so stellt sich heraus: Er verdient gut, er ist erfolgreich und angesehen und meint deshalb, er müsse auch glücklich sein. Sein Gefühl, glücklich zu sein, ist aber nur eine Annahme. Dringt man noch tiefer, dann könnte man zu ihm sagen: „Ich habe Ihr Gesicht jetzt während mehrerer Sitzungen beobachtet, und ich habe den Eindruck, dass Sie schrecklich traurig und deprimiert aussehen. Worüber sind Sie eigentlich so traurig?“ Dann kann man erleben, dass dieser Mensch, der sagte, er habe seit 20 Jahren nicht mehr geweint, sich plötzlich an ein Erlebnis in seiner Kindheit erinnert, an etwas, das die ganze Zeit in ihm fortlebte, und dass er nun hemmungslos zu weinen beginnt. Er hat sich also – um sich vor seiner Traurigkeit zu schützen – gegen dieses Gefühl abgeschirmt, und zwar mit Hilfe einer Illusion über sein Gefühl, die nichts weiter war als eine verstandesmäßige Annahme.
Eine zweite Aufgabe, die sich aus dem ethischen Problem der Gegenwart ergibt, ist die Überwindung unserer Haltung des Konsumierens und Empfangens, indem wir schöpferisch werden. Mit schöpferisch meine ich nicht, dass wir Bilder malen, Gedichte schreiben oder Musik hervorbringen sollten. Es geht vielmehr um Kreativität als einer Haltung, als einem Charakterzug, als einer Haltung den Menschen und der Welt gegenüber. Ich kann zum Beispiel ein Buch lesen, und wenn ich es gelesen habe, dann habe ich verstanden, was der Autor sagen wollte – nichts weiter. Wenn ich will, [IX-328] kann ich auch über dieses Buch reden. All dies kann in einer reinen Konsumentenhaltung geschehen. Vorausgesetzt, es ist ein gutes Buch, dann kann ich ein Buch aber auch so lesen, dass ich nicht nur das, was der Autor sagt, in mich aufnehme, sondern dass dabei in mir selbst etwas zum Leben kommt, dass mir neue Gedanken kommen. Dann setze ich mich mit dem Buch tatsächlich auseinander und bin ein veränderter Mensch, wenn ich das Buch gelesen habe. Bin ich nach dem Lesen noch der Gleiche, dann taugt entweder das Buch nichts, oder ich tauge nichts, das heißt ich habe das Buch nur konsumiert.
Um den entscheidenden Punkt noch zu verdeutlichen: Kreativität ist eine Haltung, bei der man sich der Welt bewusst ist und auf sie antwortet. Der Einwand, dass wir das doch die ganze Zeit täten, dass wir die Dinge bewusst erlebten und auf sie eingingen, trifft nicht den entscheidenden Punkt. In Wirklichkeit sind wir uns der Dinge nicht bewusst oder nur sehr eingeschränkt. Einige Beispiele mögen das belegen: Ich sehe eine Rose und sage, das ist eine Rose. Tatsächlich aber sehe ich einen Gegenstand und weiß, dass dieser Gegenstand als Rose zu klassifizieren ist. Er heißt „Rose“, weil er in die Kategorie „Rose“ gehört, und darum sage ich, ich sehe eine Rose. Doch was ich nicht sehe, ist das, was Gertrude Stein so umschrieben hat: „Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose.“ Ich sehe die Rose nicht wirklich. Ich sage nur: „Das ist eine Rose“ und beweise damit, dass ich in der Lage bin, zu sprechen, einen Gegenstand zu erkennen und ihn mit diesem Wort richtig zu klassifizieren.
Oder: Wenn ich einen Berg sehe, dann ist meine erste Frage, wie dieser Berg heiße, und meine zweite, wie hoch er sei. Dann vergesse ich den Berg. Wenn ich seinen Namen und seine Höhe weiß, kann ich ihn vergessen, obwohl die Tatsache, dass ich seinen Namen und seine Höhe weiß, nicht das Geringste damit zu tun hat, dass ich den Berg sehe. Vielleicht mache ich ein Foto von ihm. Dann blicke ich in die Kamera, die Kamera richtet sich auf den Berg, während ich ihn überhaupt nicht sehe. Zu Hause kann ich dann meinen Kindern das Foto zeigen – den Berg habe ich aber in Wirklichkeit nicht gesehen.
Oder: Ich sehe einen Menschen und frage ihn, wie er heißt. Dieser gibt seinen Namen an, als ob dieser Name irgendetwas mit ihm zu tun hätte. Gebe ich mich dann immer noch nicht damit zufrieden, erzählt er vielleicht, dass er Arzt sei, verheiratet sei und zwei Kinder habe. Gebe ich mich dann immer noch nicht zufrieden, dann wird er sich entweder denken, ich sei ein bisschen komisch oder ich wollte ihn in Verlegenheit bringen. Meistens begegnen wir Menschen in der gleichen Weise, wie wenn wir einen Berg sehen. Wir klassifizieren sie intellektuell und abstrakt, aber wir sehen sie nicht wirklich. Viele haben schon die Erfahrung gemacht, dass man jemanden, den man recht gut kennt – vielleicht den eigenen Mann oder die eigene Frau, die eigenen Kinder oder auch einen Freund –, so sieht, als ob man sie zum ersten Mal sähe, so als ob der Betreffende uns wirklicher schiene als je zuvor, als ob plötzlich ein Schleier weggezogen worden wäre und wir den Betreffenden jetzt „wirklich“ sähen. Wenn wir mit Gegenständen, mit der Natur, mit Menschen in Beziehung treten, dann tun wir das in erster Linie auf eine abstrakte, klassifizierende, intellektuelle Weise, auch wenn wir uns einbilden, dass wir sie sehen und hören.
Nun seien noch einige Beispiele für die entgegengesetzte Einstellung genannt. Eine [IX-329] Malerin, die bei mir eine Psychoanalyse machte, kam eines Tages ganz aufgeregt zu mir und sagte: „Wissen Sie, ich habe heute ein wundervolles Erlebnis gehabt. Ich habe in der Küche Erbsen ausgekernt und zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass Erbsen rollen.“ Nun wissen wir ja alle, dass Erbsen wie alle runden Gegenstände auf einer schrägen, relativ glatten Oberfläche rollen, aber wir sehen das einfach nicht. Es ist etwas völlig anderes zu wissen, dass Erbsen rollen, und es zu sehen; unser Wissen bestätigt zu finden oder es zu sehen. Nehmen wir andererseits einen kleinen Jungen, der Ball spielt. Er wirft den Ball, der Ball rollt, und er kann das hundertmal wiederholen, weil er wirklich sieht, dass der Ball rollt. Er macht es nicht so wie die meisten, die lediglich registrieren, was sie bereits wissen. Wir langweilen uns, sobald der Ball dreimal gerollt ist, weil wir ja schon wissen, dass das Ding rollt und es uns nicht darum geht, es rollen zu sehen. Der kleine Junge aber sieht es. Aus diesem Grunde langweilt es ihn nicht. Entsprechendes gilt auch für die Einstellung, die ein kreativer Künstler hat. Wenn er seinen Baum oder seine Blume, seine Landschaft usw. sieht, dann interessiert es ihn, ob der Baum schön ist oder nicht. Es interessiert ihn nicht, wie der Baum heißt, ihm kommt es vielmehr darauf an, den Baum erschöpfend selbst zu erleben, das Wesen des Baumes zu erleben, kurz: ihn zu sehen. Das ist alles.[6]
Was den Künstler auszeichnet, ist seine Fertigkeit, seine Vision des Baumes auf die Leinwand zu bannen. Jeder von uns, auch wenn er nicht die technischen Fähigkeiten eines Künstlers hat, besitzt dennoch die gleiche Fähigkeit, den Baum so zu sehen, wie ihn der Künstler sieht – oder wie der kleine Junge den Ball rollen sieht. Wenn wir einen Menschen als Person sehen – und es geht mir hier mehr um die menschlichen Beziehungen als um unsere Beziehung zur Natur –, dann geben wir eine Haltung, die nur abstrakt klassifizieren will, auf. Wir sind dann fähig, zum anderen zu sagen: „Das bist du“ (man kann über einen anderen Menschen nicht mehr sagen als dies) und zum Ausdruck bringen: „Ich sehe dich“. Können wir einen Menschen in dieser Weise sehen, dann geben wir auch den törichten Gedanken auf, dass wir einen Menschen kennen, wenn wir über seine Vorgeschichte Bescheid wissen. In der Psychoanalyse frage ich den Patienten auch: „Was fällt Ihnen zu mir ein?“ Wenn er sagt: „Ich kenne Sie ja nicht!“, antworte ich: „Wenn Sie mich nach 20 Sitzungen noch nicht kennen, werden Sie mich bestimmt nach zwei Jahren auch nicht besser kennen, weil alles, was Sie über mich wissen können, hier vor Ihren Augen ist. Sie haben nur Angst davor, mich kennenzulernen.“ Vielleicht wird der Patient dann wie die meisten Menschen sagen: „Ich weiß ja nichts über Ihr Leben“, so als ob das eine Rolle spielte. Wer einen Menschen wirklich sieht, der kennt ihn auch.
Um sich, seine Vorliebe oder seine Abneigung gegen einen anderen Menschen nicht auf diesen zu projizieren, braucht es einige Übung, eine gewisse Sensitivität und sehr viel Objektivität; und man braucht hierzu viel Konzentrationsfähigkeit. Gerade diese geht uns ab. Weil wir geschäftig sind, alles und jedes gleichzeitig tun wollen, gehören wir zu den unkonzentriertesten Menschen, die es je auf der Erde gegeben hat. Wir hören Radio und lesen dabei die Zeitung, gleichzeitig unterhalten wir uns mit unserer Frau und tun noch anderes nebenher. In Wirklichkeit sind wir unfähig, uns auf irgendetwas zu konzentrieren.
Von den anderen ethischen Problemen der Gegenwart soll hier nur noch eines [IX-330] hervorgehoben werden: Wir müssen uns vor allem dazu entschließen, Mittel auch wirklich Mittel und Zwecke tatsächlich Zwecke sein zu lassen und beides nicht durcheinanderzubringen. Wir müssen uns entscheiden, ob es uns mit unserer westlichen religiösen und humanistischen Tradition ernst ist, dass der Mensch das Ziel von allem ist. Wenn es uns damit nicht ernst ist, sollten wir es wenigstens zugeben. Heute beherrschen die Dinge den Menschen. Unsere Aufgabe ist es, dem Menschen wieder den Vorrang zu geben.
Psychologie und Werte
(Values, Psychology, and Human Existence)
(1959b)[7]
Diese Abhandlung soll folgende These begründen und mit Beispielen belegen[8]: Werte wurzeln in den Bedingungen der menschlichen Existenz. Die Kenntnis dieser Bedingungen, das heißt die Kenntnis der „Situation des Menschen“[9], führt uns zur Erhebung von Wertbegriffen, die objektive Gültigkeit besitzen. Die Gültigkeit dieser Werte existiert jedoch nur in Bezug auf die Existenz des Menschen; außerhalb der menschlichen Existenz gibt es keine Werte.
Zunächst ist nach dem Wesen des Menschen und nach den Bedingungen der menschlichen Existenz zu fragen: Worin besteht das Wesen des Menschen, welches sind die besonderen Bedingungen der menschlichen Existenz, und welche Bedürfnisse wurzeln in diesen Bedingungen?
Der Mensch ist aus seiner ursprünglichen Einheit mit der Natur, welche für das Leben der Tiere kennzeichnend ist, herausgerissen. Da er gleichzeitig Vernunft und Vorstellungsvermögen besitzt, ist er sich seiner Einsamkeit und Abgesondertheit, seiner Ohnmacht und Unwissenheit und der Zufälligkeit seiner Geburt und seines Todes bewusst. Er könnte diesen Zustand keinen Augenblick ertragen, wenn er nicht neue Bindungen an seine Mitmenschen finden könnte, welche die alten, von Instinkten regulierten, ersetzen. Selbst wenn alle seine physiologischen Bedürfnisse befriedigt wären, würde er den Zustand der Einsamkeit und Individuation als Gefängnis empfinden, aus dem er ausbrechen müsste, um sich seine geistige Gesundheit zu erhalten. Tatsächlich handelt es sich ja beim Geisteskranken um einen Menschen, dem es nicht gelungen ist, eine Verbindung irgendwelcher Art einzugehen, und der auch dann, wenn er nicht hinter vergitterten Fenstern lebt, ein Gefangener ist. Die Notwendigkeit, mit anderen lebenden Wesen eine Verbindung einzugehen, mit ihnen in Beziehung zu stehen, ist ein unverzichtbares Bedürfnis, von dessen Befriedigung die geistige Gesundheit des Menschen abhängt. Dieses Bedürfnis nach Bezogenheit steht hinter allen Phänomenen, welche die ganze Skala intimer menschlicher Beziehungen ausmachen, hinter allen Leidenschaften, die wir im weitesten Sinne des Wortes als Liebe bezeichnen.
Es gibt mehrere Wege, auf denen man diese Einheit suchen und finden kann. Der Mensch kann versuchen, mit der Welt eins zu werden, indem er sich einer anderen [IX-332] Person, einer Gruppe, einer Institution oder einem Gott völlig unterwirft. Auf diese Weise überwindet er das Abgetrenntsein seiner individuellen Existenz dadurch, dass er Teil eines anderen Menschen oder einer Einrichtung wird, die größer sind als er selber, und er erlebt dann seine Identität in der Verbindung mit der Macht, der er sich unterworfen hat. Eine andere Möglichkeit, die Isolierung zu überwinden, liegt in entgegengesetzter Richtung: Der Mensch kann auch versuchen, dadurch mit der Welt eins zu werden, dass er Macht über sie gewinnt, dass er andere zu einem Bestandteil seiner selbst macht und dass er so durch die Herrschaft über diese anderen seine individuelle Existenz transzendiert. Das gemeinsame Element in der Unterwerfung wie auch in der Beherrschung ist die symbiotische Eigenart der Bezogenheit. Beide Beteiligten verlieren dabei ihre Integrität und Freiheit; einer lebt vom anderen. Beide befriedigen zwar ihre Sehnsucht nach Nähe, leiden aber unter einem Mangel an innerer Kraft und Selbstsicherheit, deren Voraussetzung Freiheit und Unabhängigkeit wären. Außerdem fühlen sie sich ständig durch die bewusste oder unbewusste Feindseligkeit bedroht, die bei jeder symbiotischen Beziehung unausweichlich entsteht. Die Verwirklichung der unterwürfigen (masochistischen) oder beherrschenden (sadistischen) Leidenschaft führt nie zur Befriedigung. Beide besitzen eine Eigendynamik, und da keine noch so große Unterwerfung unter andere oder deren Beherrschung (oder auch Besitz und Ruhm) genügt, um uns ein Gefühl der Identität und des Einsseins zu geben, suchen wir immer nur nach mehr und immer mehr. Diese Leidenschaften sind schließlich stets zum Scheitern verurteilt; dies kann auch gar nicht anders sein, denn obgleich sie nach einem Gefühl des Einsseins streben, zerstören sie das Integritätsgefühl. Wer von einer dieser Leidenschaften getrieben wird, wird in Wirklichkeit von anderen abhängig; anstatt sein eigenes individuelles Sein zu entwickeln, ist er von denen abhängig, denen er sich unterwirft oder die er beherrscht.
Es gibt nur eine einzige Leidenschaft, die das Bedürfnis des Menschen, mit der Welt eins zu werden und gleichzeitig das Gefühl seiner Integrität und Individualität zu erlangen, befriedigt: die Liebe. Liebe ist die Vereinigung mit einem anderen Menschen oder Gegenstand außerhalb seiner selbst unter der Voraussetzung der Beibehaltung des Abgetrenntseins und der lntegrität des eigenen Selbst. Liebe ist Erfahrung von Teilen und Gemeinsamkeit, die die volle Entfaltung der eigenen inneren Aktivität ermöglicht. Das Erlebnis der Liebe beseitigt die Notwendigkeit, sich Illusionen hinzugeben. Ich habe es nicht mehr nötig, das Bild vom anderen oder von mir selbst aufzublähen, weil die Realität des eigenen Teilens und Liebens es mir ermöglicht, meine individuelle Existenz zu transzendieren und gleichzeitig mich selbst als Träger der aktiven Kräfte zu erfahren, die den Akt des Liebens ausmachen. Worauf es ankommt, ist die besondere Qualität des Liebens, nicht sein Gegenstand. Liebe ist zu finden im Erlebnis der menschlichen Solidarität mit unseren Mitmenschen, in der erotischen Liebe von Mann und Frau, in der Liebe der Mutter zu ihrem Kind und auch in der Liebe zu uns selbst als einem menschlichen Wesen; wir finden sie in der mystischen Vereinigung. Im Akt des Liebens bin ich eins mit dem All und bin doch ich selbst, ein einzigartiges, getrenntes, begrenztes, sterbliches menschliches Wesen. Gerade aus der Polarität zwischen Abgetrenntsein und Vereinigung wird die Liebe immer neu geboren. [IX-333]
Ein zweiter Aspekt der menschlichen Situation, der in engem Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach Bezogenheit steht, ist die Situation des Menschen als eines geschaffenen Wesens und sein Bedürfnis, den Zustand der passiven Kreatürlichkeit zu transzendieren. Der Mensch wird ohne seine Zustimmung und ohne es zu wollen in diese Welt hineingeworfen. In dieser Hinsicht unterscheidet er sich nicht vom Tier, von der Pflanze oder von der anorganischen Materie. Aber weil er mit Vernunft und Vorstellungsvermögen begabt ist, kann er sich nicht mit der passiven Rolle der Kreatur, mit der Rolle des aus dem Becher geworfenen Würfels begnügen. Es treibt ihn das Verlangen, die Rolle der Kreatürlichkeit, seine Zufälligkeit und die Passivität seiner Existenz dadurch zu transzendieren, dass er selbst zum „Schöpfer“ wird.
Der Mensch kann Leben schaffen. Es ist dies die wunderbare Eigenschaft, die er zwar mit allen lebenden Wesen gemeinsam hat, jedoch mit dem Unterschied, dass er allein sich bewusst ist, zugleich Geschöpf und Schöpfer zu sein. Der Mensch, oder – besser gesagt – die Frau kann Leben hervorbringen, indem sie ein Kind gebiert und so lange für das Kind sorgt, bis es groß genug ist, um selbst für sich sorgen zu können. Die Menschen – Mann wie Frau – können etwas erzeugen, indem sie Pflanzen säen, materielle Gegenstände herstellen, Kunstwerke schaffen, Ideen entwickeln und sich gegenseitig lieben. Im Akt der Schöpfung transzendiert der Mensch sich selbst als Kreatur und erhebt sich über die Passivität und Zufälligkeit seiner Existenz in den Bereich der Zielgerichtetheit und Freiheit. Das Bedürfnis des Menschen nach Transzendenz ist eine der Wurzeln der Liebe ebenso wie der Kunst, der Religion und der Erzeugung materieller Dinge.
Die Voraussetzung dafür, dass man etwas schaffen kann, ist produktives Tätigsein und Fürsorge. Es setzt voraus, dass man das, was man schaffen will, liebt. Wie sonst könnte der Mensch das Problem, sich selbst zu transzendieren, lösen, wenn er nicht lieben könnte. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, dieses Bedürfnis nach Transzendenz zu befriedigen: Wenn ich nicht fähig bin, Leben zu erzeugen, kann ich Leben zerstören. Auch indem ich Leben zerstöre, transzendiere ich es. Dass der Mensch Leben zerstören kann, ist ebenso rätselhaft, wie dass er es erzeugen kann. Denn Leben ist das Wunder schlechthin, das Unerklärliche. Auch im Akt der Zerstörung erhebt sich der Mensch über das Leben; er transzendiert sich damit als Kreatur. So bleibt dem Menschen, insofern er danach strebt, sich zu transzendieren, letzten Endes keine andere Wahl, als entweder etwas zu schaffen oder etwas zu zerstören, entweder zu lieben oder zu hassen. Die ungeheure Macht des Zerstörungswillens, der wir in der Menschheitsgeschichte begegnen und die wir in unserer Zeit auf so entsetzliche Weise erlebt haben, wurzelt in der Natur des Menschen, genauso wie der Trieb etwas zu schaffen darin verwurzelt ist. Wenn man sagt, der Mensch sei in der Lage, sein primäres Potenzial zu Liebe und Vernunft zu entwickeln, so impliziert dies nicht einen naiven Glauben an das Gutsein des Menschen. Destruktivität ist ein sekundäres Potenzial, welches ebenso in der Existenz des Menschen selbst verwurzelt ist und welches die gleiche Intensität und Macht besitzt, wie sie jede Leidenschaft besitzen kann. Aber – und das ist der wesentliche Punkt meines Arguments – sie ist die Alternative zur Kreativität. Schaffen und Zerstören, Lieben und Hassen sind nicht zwei voneinander unabhängig existierende Triebe. Beides sind Reaktionen auf das gleiche [IX-334] Bedürfnis nach Transzendenz, und der Wille zu zerstören muss sich regen, wenn der Wille zu schaffen nicht befriedigt werden kann. Aber die Befriedigung des Bedürfnisses nach Kreativität macht glücklich, während die Destruktivität Leiden erzeugt – vor allem bei dem Zerstörer selbst.
Ein drittes Bedürfnis, welches ebenfalls aus den Bedingungen der menschlichen Existenz folgt, ist das Bedürfnis nach Verwurzelung. Die Geburt des Menschen als Mensch bedeutet den Beginn seines Auftauchens aus seiner natürlichen Heimat, den Beginn der Durchtrennung seiner natürlichen Bindungen. Aber eben dieses Durchtrennen ist Angst erregend; wenn der Mensch seine natürliche Verwurzelung verliert, wo ist er dann, und wer ist er? Er würde allein stehen, ohne Heimat, wurzellos; er könnte die Isolierung und Hilflosigkeit dieser Lage nicht ertragen, er würde wahnsinnig. Er kann auf seine natürlichen Wurzeln erst verzichten, wenn er eine neue menschliche Verwurzelung findet, und erst dann kann er sich wieder in der Welt zu Hause fühlen. Ist es da erstaunlich, dass man beim Menschen eine tiefe Sehnsucht findet, die natürlichen Bindungen nicht zu durchtrennen, und dass er sich dagegen wehrt, von der Natur, von der Mutter und von Blut und Boden weggerissen zu werden?
Die elementarste der natürlichen Bindungen ist die Bindung des Kindes an die Mutter. Das Kind beginnt sein Leben im Mutterleib und existiert darin weit länger, als dies bei den meisten Tieren der Fall ist; sogar noch nach der Geburt bleibt das Kind körperlich hilflos und völlig von der Mutter abhängig; auch diese Periode der Hilflosigkeit und Abhängigkeit zieht sich weit mehr in die Länge als bei irgendeinem Tier. In den ersten Lebensjahren kommt es zu keiner völligen Trennung von Mutter und Kind. Die Befriedigung all seiner körperlichen Bedürfnisse und sein vitales Bedürfnis nach Wärme und Zuneigung hängt von ihr ab; sie hat das Kind nicht nur geboren, sie gibt ihm auch weiterhin die Möglichkeit zu leben. Ihre Fürsorge ist nicht abhängig davon, ob das Kind etwas für sie tut, sie hängt nicht davon ab, ob das Kind irgendwelche Verpflichtungen ihr gegenüber erfüllt; sie ist bedingungslos. Sie sorgt für das neue Geschöpf, weil es ihr Kind ist. Das Kind erlebt die Mutter in diesen entscheidenden ersten Lebensjahren als die Quelle des Lebens, als eine allumfassende, beschützende, nährende Kraft. Die Mutter ist Nahrung; sie ist Liebe; sie ist Wärme; sie ist Erde. Von ihr geliebt werden, bedeutet lebendig sein, verwurzelt sein, daheim sein.
Genauso wie die Geburt bedeutet, dass man den umhüllenden Schutz des Mutterleibes verlassen muss, so bedeutet das Heranwachsen, dass man die schützende Welt der Mutter zu verlassen hat. Aber selbst beim reifen Erwachsenen verliert sich die Sehnsucht nach jener einmal vorhandenen Situation nie völlig, wenngleich zwischen einem Erwachsenen und einem Kind in der Tat ein großer Unterschied besteht. Der Erwachsene besitzt die Möglichkeit, auf eigenen Füßen zu stehen, für sich selbst zu sorgen und für sich und andere die Verantwortung zu übernehmen, während das Kind zu alldem nicht in der Lage ist. Aber angesichts der wachsenden Schwierigkeiten des Lebens, unserem nur fragmentarischen Wissen und allen Zufälligkeiten, denen unser Leben als Erwachsene ausgesetzt ist, angesichts der unvermeidlichen Fehler, die wir machen, unterscheidet sich die Situation des Erwachsenen keineswegs so grundlegend von der des Kindes, wie man gewöhnlich annimmt. Jeder Erwachsene braucht Hilfe, Wärme und Schutz, die sich zwar in mannigfacher Weise von den Bedürfnissen [IX-335] des Kindes unterscheiden, ihnen in vieler Hinsicht aber auch wieder ähnlich sind. Ist es da erstaunlich, dass man bei allen Erwachsenen eine tiefe Sehnsucht nach Sicherheit und Verwurzelung findet, die ihnen einstmals die Beziehung zu ihrer Mutter gab? Ist nicht zu erwarten, dass sie ihre intensive Sehnsucht nicht aufgeben können, wenn sie nicht andere Möglichkeiten finden, wieder Wurzeln zu fassen?
In der Psychopathologie finden wir reichlich Beispiele für das Phänomen, dass sich jemand weigert, den allumfassenden Bannkreis der Mutter zu verlassen. In der extremsten Form treffen wir auf die Sehnsucht, wieder in den Mutterleib zurückzukehren. Ein Mensch, der von diesem Wunsch besessen ist, kann das Bild eines Schizophrenen bieten. Er fühlt und handelt dann wie der Embryo im Mutterleib und ist unfähig, auch nur die elementarsten Funktionen eines kleinen Kindes zu erfüllen. Bei vielen Neurosen schwererer Art finden wir die gleiche Sehnsucht; jedoch in Form eines verdrängten Wunsches, der sich nur in Träumen, Symptomen und einem neurotischen Verhalten manifestiert, das durch den Konflikt zwischen der tiefen Sehnsucht, im Mutterleib zu bleiben, und dem erwachsenen Teil der Persönlichkeit, der ein normales Leben führen möchte, entsteht. In den Träumen äußert sich dieses Verlangen in Symbolen wie zum Beispiel, dass man sich in einer dunklen Höhle oder in einem Ein-Mann-Unterseeboot befindet, dass man in ein tiefes Wasser taucht usw. Ein solcher Mensch zeigt in seinem Verhalten Lebensangst und eine tiefe Faszination durch den Tod (wobei der Tod in der Phantasie gleichbedeutend ist mit der Rückkehr in den Mutterleib, zur Mutter Erde).
Die weniger schwere Form der Mutterbindung finden wir in jenen Fällen, wo jemand es zwar zugelassen hat, geboren zu werden, wo er aber vor dem nächsten Schritt nach der Geburt, nämlich der Entwöhnung von der Mutterbrust, Angst hat. Menschen, die auf dieser Stufe des Geborenwerdens stehen geblieben sind, haben eine tiefe Sehnsucht danach, von einer Mutterfigur bemuttert, umsorgt und beschützt zu werden; es sind die ewig Abhängigen, die Angst bekommen und unsicher werden, wenn ihnen der mütterliche Schutz entzogen wird, die aber optimistisch und aktiv sind, wenn eine liebende Mutter oder ein Mutterersatz entweder wirklich oder in ihrer Phantasie vorhanden ist.
Leben ist ein Prozess ständigen Geborenwerdens. Die Tragödie im Leben der meisten von uns besteht darin, dass wir sterben, bevor wir ganz geboren sind. Geboren werden heißt jedoch nicht nur vom Mutterleib, vom Mutterschoß, von der mütterlichen Hand loszukommen, sondern es heißt frei zu sein, um schöpferisch tätig zu werden. Genauso wie der Säugling atmen muss, wenn die Nabelschnur durchtrennt ist, so muss der Mensch in jedem Augenblick seiner Geburt schöpferisch tätig sein. In dem Maße, wie der Mensch ganz geboren ist, findet er auch eine neue Art der Verwurzelung, welche auf seiner schöpferischen Bezogenheit zur Welt beruht, sowie auf dem sich daraus ergebenden Erlebnis der Solidarität mit allen Menschen und der gesamten Natur. Nach seiner passiven Verwurzelung in der Natur und im Mutterleib wird der Mensch wieder eins mit allem Lebendigen, aber diesmal auf produktiv-tätige und schöpferische Weise.
Ein viertes Bedürfnis ist des Menschen Bedürfnis nach einem Identitätserleben. Man kann den Menschen definieren als das Lebewesen, das „ich“ sagen kann, das sich [IX-336] seiner selbst als eigenständiges Wesen bewusst werden kann. Das Tier, das innerhalb der Natur existiert, ohne sie zu transzendieren, ist sich seiner selbst nicht bewusst und braucht auch kein Identitätserleben. Der von der Natur losgerissene Mensch, der mit Vernunft und Vorstellungsvermögen ausgestattet ist, muss sich eine Vorstellung von sich selbst formen, muss sagen und fühlen können: „Ich bin ich.“ Da er nicht gelebt wird, sondern lebt, weil er sein ursprüngliches Einssein mit der Natur verloren hat, weil er Entscheidungen treffen muss, ist er sich seiner selbst und seines Nächsten als unterschiedlicher Personen bewusst, muss er sich als Subjekt seiner Handlungen fühlen. Genau wie das Bedürfnis nach Bezogenheit, nach Verwurzelung und Transzendenz ist auch dieses Bedürfnis nach Identitätserleben so lebenswichtig und unabdingbar, dass der Mensch seine geistige Gesundheit einbüßen würde, wenn er nicht irgendeine Möglichkeit fände, sie zu befriedigen. Das Identitätserleben des Menschen entwickelt sich im Prozess seiner Loslösung von den „primären Bindungen“, die ihn an die Mutter und die Natur ketten. Der Säugling, der sich noch eins mit der Mutter fühlt, kann noch nicht „ich“ sagen und braucht es auch nicht zu können. Erst wenn er die Außenwelt bewusst wahrnimmt als etwas von ihm Getrenntes und Unterschiedenes, gelangt er zum Bewusstsein seiner selbst als einem Wesen für sich, und eines der letzten Worte, die das Kind lernt, ist „ich“.
In der Gesamtentwicklung der Menschheit hängt der Grad, bis zu welchem der einzelne Mensch sich seiner als eines separaten Selbst bewusst ist, davon ab, wieweit er sich von seiner Sippe gelöst hat und wieweit er im Individuationsprozess fortgeschritten ist. Ein Angehöriger eines primitiven Stammes könnte sein Identitätsgefühl in die Formel kleiden „Ich bin wir“; er kann sich noch nicht als ein „Individuum“ begreifen, das auch außerhalb der Gruppe existiert. In der mittelalterlichen Welt identifizierte sich der Einzelne mit seiner sozialen Rolle innerhalb der feudalen Hierarchie. Der Bauer war kein Mensch, der nur zufällig ein Bauer war, und der Feudalherr war nicht nur zufällig ein Feudalherr. Er war ein Bauer oder ein Herr, und dieses Gefühl von der Unabänderlichkeit seines Standes war ein wesentlicher Bestandteil seines Identitätserlebens. Als das Feudalsystem zusammenbrach, geriet dieses Identitätsgefühl ins Wanken, und es erhob sich die dringende Frage: „Wer bin ich?“ – oder genauer gesagt: „Woher weiß ich, dass ich ich bin?“. Diese Frage hat sich in philosophischer Form Descartes gestellt. Seine Antwort auf der Suche nach der Identität lautete: „Ich zweifle – also denke ich; ich denke – also bin ich.“ Diese Antwort legt allen Nachdruck auf die Erfahrung des „Ich“ als des Subjekts meiner Denktätigkeit und übersieht, dass das „Ich“ auch im Prozess des Fühlens und der schöpferischen Tätigkeit erfahren wird.
Die Entwicklung der westlichen Kultur verlief so, dass die Grundlage für die volle Erfahrung der Individualität geschaffen wurde. Dadurch, dass man den Einzelnen politisch und wirtschaftlich befreite und dass man ihn lehrte, selbständig zu denken und sich von autoritärem Druck zu befreien, hoffte man, ihm ein Ichgefühl zu geben in dem Sinn, dass er sich als Mittelpunkt und tätiges Subjekt seiner Kräfte empfand. Aber nur eine Minderheit gelangte zu diesem neuen Icherlebnis. Für die meisten war der Individualismus nicht viel mehr als eine Fassade, hinter der sich der misslungene Versuch verbarg, zu einem individuellen Identitätserleben zu gelangen. [IX-337]
Man suchte nach vielen Ersatzmöglichkeiten für ein echtes individuelles Identitätserleben und fand sie auch. Nation, Religion, Klasse und Beruf dienten zur Bildung eines Gefühls von Identität. „Ich bin Amerikaner“ – „Ich bin Protestant“ – „Ich bin Geschäftsmann“ – das sind solche Formeln, die einem Menschen helfen, Identität zu erfahren, nachdem die ursprüngliche Sippenidentität verlorenging, und bevor man sich ein echtes individuelles Identitätserleben errungen hat. Diese verschiedenen Identifikationen gehen in unserer heutigen Gesellschaft gewöhnlich miteinander Hand in Hand. Es handelt sich dabei weitgehend um Statusidentifikationen, die noch wirkungsvoller sind, wenn man sie wie in den europäischen Ländern mit gewissen Überresten aus der Feudalzeit vermischt. In den Vereinigten Staaten, wo nur noch so wenig von feudalen Überresten vorhanden ist und es eine große gesellschaftliche Mobilität gibt, sind diese Statusidentifikationen natürlich weniger wirksam, und das Identitätserleben verschiebt sich immer mehr in Richtung auf das Erlebnis der Konformität.
Insofern ich nicht anders bin als die anderen, insofern ich ihnen gleiche und von ihnen als „Mensch wie du und ich“ anerkannt werde, kann ich mich auch als „Ich“ fühlen. Ich bin dann „Einer, Keiner, Hunderttausend“, wie Pirandello es im Titel seines Romans formuliert. Anstelle der vor-individualistischen Sippenidentität entwickelt sich eine neue Herdenidentität, bei der das Identitätserleben auf dem Gefühl beruht, unbestritten der Masse anzugehören. Dass diese Uniformität und Konformität oft nicht als solche erkannt wird und von der Illusion der Individualität verdeckt wird, ändert nichts an den Tatsachen.
Das Problem der Identität ist nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, nur ein philosophisches Problem oder nur ein Problem, das unseren Geist und unser Denken angeht. Das Bedürfnis nach einem Identitätserleben entstammt den Bedingungen der menschlichen Existenz und ist die Quelle vieler intensiver Strebungen. Da ich ohne ein Ichgefühl nicht geistig gesund bleiben kann, würde ich vor so gut wie nichts zurückschrecken, um mir dieses Gefühl zu verschaffen. Hinter dem leidenschaftlichen Streben nach Status und Konformität steckt eben dieses Bedürfnis, welches sogar manchmal stärker ist als das Bedürfnis, körperlich zu überleben. Könnte man sich einen besseren Beweis hierfür vorstellen, als dass die Menschen bereit sind, ihr Leben einzusetzen, einen geliebten Menschen aufzugeben, ihre Freiheit preiszugeben und ihr eigenes Denken zu opfern, nur um zur Herde zu gehören, mit den anderen konform zu gehen und sich auf diese Weise ein Identitätserleben zu verschaffen, auch wenn es sich nur um ein illusorisches handelt?
Die Tatsache, dass der Mensch Vernunft und Vorstellungsvermögen besitzt, führt dazu, dass er nicht nur ein Erleben seiner eigenen Identität nötig hat, sondern dass er sich auch intellektuell in der Welt orientieren muss. Dieses Bedürfnis nach einem Rahmen der Orientierung lässt sich mit dem körperlichen Orientierungsprozess vergleichen, der in den ersten Lebensjahren abläuft und der abgeschlossen ist, wenn das Kind allein laufen, Gegenstände greifen und mit ihnen umgehen kann und sie verstehen kann. Aber wenn es laufen und sprechen gelernt hat, hat es erst den ersten Schritt auf dem Weg zu seiner Orientierung in der Welt getan. Der Mensch findet sich von vielen verwirrenden Erscheinungen umgeben, und da er mit Vernunft begabt ist, muss [IX-338] er sie zu verstehen suchen, muss sie in einen Zusammenhang bringen, den er begreifen kann und der es ihm ermöglicht darüber nachzudenken. Je weiter sich seine Vernunft entwickelt, umso angemessener wird sein Orientierungssystem, das heißt umso näher kommt es der Wirklichkeit. Aber selbst dann, wenn der Orientierungsrahmen eines Menschen völlig illusorisch ist, befriedigt er doch sein Bedürfnis nach einem Weltbild, das für ihn einen Sinn besitzt. Ob er etwa an die Macht eines Totemtieres, an einen Regengott oder an die Überlegenheit und das zukünftige Schicksal seiner Rasse glaubt, sein Bedürfnis nach einem Orientierungsrahmen ist damit befriedigt. Natürlich hängt das Bild, das er sich von der Welt macht, von der Entwicklung seiner Vernunft und von seinem Wissen ab. Wenn auch vom biologischen Gesichtspunkt aus die Kapazität des menschlichen Gehirns seit Tausenden von Generationen gleich geblieben ist, so bedurfte es doch eines langen Evolutionsprozesses, um zur Objektivität zu gelangen, das heißt um die Welt, die Natur, die anderen Menschen und sich selber so zu sehen, wie sie wirklich sind, und nicht entstellt durch Wünsche und Ängste. Je mehr der Mensch seine Objektivität entwickelt, je mehr er mit der Realität in Berührung kommt, je reifer er wird, desto eher kann er eine menschliche Welt schaffen, die seine Heimat ist. Die Vernunft ist die Fähigkeit des Menschen, die Welt mit seinem Denken zu erfassen, im Gegensatz zur Intelligenz, der Fähigkeit des Menschen, die Welt mit Hilfe des Denkens zu beherrschen. Die Vernunft ist das Hilfsmittel des Menschen, zur Wahrheit zu gelangen, die Intelligenz dagegen ist das Werkzeug, das ihn die Welt noch erfolgreicher gestalten hilft; erstere ist eine spezifisch menschliche Eigenschaft, letztere hat der Mensch mit dem Tier gemeinsam.
Die Vernunft ist eine Fähigkeit, die geübt werden muss, wenn sie sich entwickeln soll, und die unteilbar ist. Damit ist auch gesagt, dass die Fähigkeit zu Objektivität sich sowohl auf die Kenntnis der Natur als auch auf die Kenntnis des Menschen, der Gesellschaft und seiner selbst bezieht. Wenn man sich in einem Bereich des Lebens Illusionen hingibt, so leidet die Fähigkeit zur Vernunft darunter und wird auch auf allen anderen Gebieten eingeschränkt. Mit der Vernunft ist es in dieser Hinsicht genau wie mit der Liebe. Ebenso wie die Liebe eine Orientierung ist, die sich auf alle Dinge bezieht und die sich niemals nur auf ein Objekt beschränken kann, so ist auch die Vernunft eine menschliche Fähigkeit, welche die ganze Welt, der sie sich gegenübergestellt sieht, umfassen muss.
Das Bedürfnis nach Orientierung existiert auf zwei Ebenen; das erste und fundamentalste Bedürfnis ist das Verlangen nach einem Orientierungsrahmen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob dieser richtig oder falsch ist. Hat der Mensch keinen ihn subjektiv befriedigenden Orientierungsrahmen, so kann er sich seine seelische Gesundheit nicht bewahren. Auf der zweiten Ebene besteht das Bedürfnis darin, dass man durch Vernunft die Realität durchdringt, so dass man die Welt objektiv erfassen kann. Aber die Notwendigkeit, die eigene Vernunft zu entwickeln, ist nicht so unabdingbar wie überhaupt die Entwicklung eines Orientierungsrahmens, denn im Falle der Vernunft stehen für den Menschen zwar sein Glück und seine Zufriedenheit, nicht aber seine geistige Gesundheit auf dem Spiel. Das zeigt sich deutlich, wenn wir etwa die Funktion der Rationalisierung untersuchen. Wie unvernünftig und unmoralisch eine Handlungsweise auch sein mag, der Mensch hat ein unüberwindliches Bedürfnis, sie [IX-339] zu rationalisieren, das heißt sich selbst und anderen zu beweisen, dass er in seinem Tun von Intelligenz, gesundem Menschenverstand oder doch wenigstens von den herkömmlichen Moralbegriffen geleitet war. Es fällt ihm kaum schwer, sich irrational zu verhalten, aber es ist ihm so gut wie unmöglich, seinem Tun nicht den Anschein einer vernünftigen Motivation zu verleihen.
Wäre der Mensch nur ein körperloser Intellekt, so brauchte er nichts weiter als ein umfassendes Denksystem. Aber da er eine Einheit von Körper und Geist ist, muss er nicht nur mit seinem Denken auf die Dichotomie seiner Existenz reagieren, sondern in seinem gesamten Lebensvollzug, mit seinem Fühlen und Handeln. So enthält jedes befriedigende Orientierungssystem nicht nur intellektuelle Elemente, sondern auch Elemente des Fühlens und Empfindens, die in der Beziehung zu einem Objekt der Hingabe zum Ausdruck kommt.
Die Art, wie jeder Mensch sein Bedürfnis nach einem Orientierungssystem und einem Objekt seiner Hingabe befriedigt, weist nach Inhalt und Form erhebliche Unterschiede auf. Es gibt primitive Systeme wie Animismus und Totemismus, bei denen Naturobjekte oder die Ahnen die Antwort auf die Suche des Menschen nach einem Sinn repräsentieren. Es gibt nicht-theistische Systeme wie zum Beispiel den Buddhismus, die man gewöhnlich als Religion bezeichnet, obwohl sie in ihrer ursprünglichen Form keine Gottesvorstellung enthalten. Es gibt rein philosophische Systeme wie die Stoa, und es gibt monotheistische religiöse Systeme, die für die Suche des Menschen nach einem Sinn des Lebens einen Gottesbegriff als Antwort bereit haben.
Aber welchen Inhalt sie auch immer haben mögen, sie alle entsprechen dem Bedürfnis des Menschen nicht nur nach einem bestimmten Denksystem, sondern auch nach einem Objekt der Hingabe, das seinem Leben und seiner Stellung in der Welt Sinn verleiht. Nur die Analyse der verschiedenen Formen der Religion kann zeigen, welche Antworten die besseren und welche die schlechteren Lösungen für die Suche des Menschen nach Sinn und für seine Sehnsucht nach Hingabe sind, wobei „besser“ und „schlechter“ stets vom Standpunkt der Natur des Menschen und seiner Entwicklungsstufe her zu beurteilen sind.
Der Aufweis der verschiedenen Bedürfnisse aus den Bedingungen der menschlichen Existenz hat verdeutlicht, dass diese Bedürfnisse auf die eine oder die andere Art befriedigt werden müssen, soll der Mensch nicht verrückt werden. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Bedürfnisse zu befriedigen; der Unterschied liegt darin, ob sie der Entwicklung des Menschen förderlich sind oder nicht. Das Bedürfnis nach Bezogenheit kann durch Unterwerfung oder Beherrschung befriedigt werden; aber nur in der Liebe wird auch noch ein anderes menschliches Bedürfnis erfüllt – nämlich das nach Unabhängigkeit und Integrität des Selbst. Das Bedürfnis nach Transzendenz lässt sich entweder durch Kreativität oder durch Destruktivität erfüllen; aber nur Kreativität bringt Freude mit sich, während Destruktivität einen selbst und andere leiden lässt. Das Bedürfnis nach Verwurzelung kann regressiv durch Fixierung an die Natur und die Mutter befriedigt werden oder auch progressiv durch ein volles Geborenwerden, bei dem eine neue Solidarität und ein neues Einssein erreicht werden. Auch hier bleiben nur im letzteren Fall Individualität und Integrität erhalten. Ein Orientierungsrahmen kann irrational oder rational sein, aber nur der [IX-340] rationale kann als Grundlage für Wachstum und Entwicklung der ganzen Persönlichkeit dienen. Schließlich kann sich das Identitätserleben auf primäre Bindungen an Natur und Sippe, auf die Anpassung an eine Gruppe oder andererseits auf die volle, kreative Entwicklung der Persönlichkeit gründen. Wiederum kann der Mensch nur im letzteren Fall zu innerer Stärke und Freude gelangen.
Der Unterschied zwischen den verschiedenen Antworten entspricht dem Unterschied zwischen seelischer Gesundheit und seelischer Krankheit, zwischen Freude und Leid, Wachstum und Stagnation, Leben und Tod, zwischen Gut und Böse. Allen Antworten, die man als gut werten kann, ist gemeinsam, dass sie der wahren Natur des Lebens entsprechen, das eine ständige Geburt und immerwährendes Wachstum ist. Allen Antworten, die man als schlecht bewerten kann, ist gemeinsam, dass sie mit der Natur des Lebens in Konflikt stehen, dass sie zu Stagnation und schließlich zum Tod führen. Schon im Augenblick der Geburt stellt das Leben dem Menschen eine Frage, die Frage der menschlichen Existenz. Er muss diese Frage in jedem Augenblick seines Lebens beantworten. Er muss sie beantworten, nicht sein Gehirn oder sein Körper, sondern er, seine ganze Person mit Füßen, Händen, Augen, Magen, Geist, Gefühl, seine reale – und nicht nur eingebildete oder abstrahierte – Person. Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Antworten auf die Existenzfrage. Wir finden diese Antworten in der Geschichte der Religion von ihren primitivsten bis zu ihren höchsten Formen. Wir finden sie auch in der Vielfalt der Charaktere, von der vollkommensten geistig-seelischen Gesundheit bis zur schwersten Psychose.
Die Skizze der verschiedenen Antworten hatte immer zur Voraussetzung, dass jeder einzelne Mensch in sich die ganze Menschheit, ihre Evolution repräsentiert. Es gibt Individuen, die den Menschen auf der primitivsten Stufe seiner Geschichte repräsentieren, und es gibt andere, welche die Menschheit repräsentieren, wie sie in späteren Jahrtausenden beschaffen sein wird.
Nur jene Antwort auf das Leben, die der Wirklichkeit der menschlichen Existenz entspricht, führt zu seelischer Gesundheit. Freilich wird im allgemeinen das, was man unter seelischer Gesundheit versteht, eher negativ als Abwesenheit von Krankheit, und nicht positiv als Wohlbefinden, als Wohl-Sein (well-being) des Menschen bestimmt.[10] Es lassen sich deshalb auch in der psychiatrischen und psychologischen Literatur kaum irgendwelche Erörterungen darüber finden, was dieses Wohl-Sein ausmacht.
Wohlsein lässt sich als die Fähigkeit beschreiben, kreativ zu sein, ganz bewusst zu leben und zu handeln; es bedeutet, unabhängig zu sein und ganz tätig und gerade dadurch mit der Welt eins zu sein. Wohl-Sein besagt zu sein, und sich nicht um das Haben zu kümmern; es ist die Erfahrung von Freude im Vollzug des Lebens selbst, bei dem schöpferisch zu leben als der einzige Lebenssinn betrachtet wird. Wohl-Sein ist nicht nur eine Frage der verstandesmäßigen Einschätzung, sondern drückt sich im ganzen Körper, in der Art der Bewegung, der Sprache und im Tonus der Muskeln aus.
Freilich muss jeder, der dieses Ziel erreichen will, gegen viele Entwicklungen in der heutigen Kultur ankämpfen. Zwei dieser negativen Tendenzen sollen erwähnt werden[11]: Die eine ist die Spaltung zwischen Intellekt und Affekt, die von Descartes bis [IX-341] zu Freud immer wieder gefördert wurde. Bei den Vertretern einer solchen Spaltung (natürlich gibt es auch Ausnahmen) wird angenommen, dass nur der Intellekt rational sei, während der Affekt seinem Wesen nach irrational sei. Bei Freud zeigt sich diese Spaltung vor allem in der Behauptung, die Liebe sei ihrem Wesen nach etwas Neurotisches, Infantiles und Irrationales. Sein Ziel war es, den Menschen dabei zu helfen, den irrationalen Affekt mit Hilfe des Intellekts zu beherrschen: „Wo Es war, soll Ich werden“ (S. Freud, 1933a, S. 86). Aber diese dogmatische Trennung von Affekten und Denken entspricht nicht der Wirklichkeit der menschlichen Existenz und verhindert Wachstum. Wir können weder den Menschen ganz verstehen noch zu Wohl-Sein gelangen, wenn wir die Vorstellung einer solchen Spaltung nicht überwinden. Es geht darum, dem Menschen seine ursprüngliche Einheit wiederzugeben und zu erkennen, dass die Spaltung zwischen Affekten und Denken, zwischen Körper und Geist nichts anderes als das Produkt unseres eigenen Denkens ist, das der Wirklichkeit des Menschen nicht entspricht.
Das andere Hindernis für ein Wohl-Sein, das tief im Geiste der modernen Gesellschaft verwurzelt ist, ist die Entmachtung des Menschen von seinem höchsten Platz. Das Neunzehnte Jahrhundert formulierte: „Gott ist tot!“ Für das zwanzigste Jahrhundert könnte gelten: „Der Mensch ist tot!“ Mittel wurden in Zwecke verwandelt, Produktion und Konsum sind die Ziele des Lebens geworden, dem sich das Leben unterordnen muss. Wir produzieren Dinge, die sich wie Menschen verhalten, und Menschen, die sich wie Dinge verhalten. Der Mensch hat sich in ein Ding verwandelt und betet die Erzeugnisse seiner eigenen Hände an. Er ist sich selbst fremd geworden und zum Götzendienst zurückgekehrt, obwohl er den Namen Gottes im Munde führt. Bereits Emerson hat gesehen, dass „die Dinge im Sattel sitzen und die Menschheit reiten“. Heute erkennen viele Menschen, dass dies tatsächlich so ist. Wohl-Sein aber werden wir nur unter der Bedingung erreichen, dass wir den Menschen wieder in den Sattel heben.
Der kreative Mensch
(The Creative Attitude)
(1959c)[12]
Von Kreativität[13] kann man in einem zweifachen Sinne sprechen: Kreativität kann heißen, dass etwas Neues geschaffen wird, etwas, das andere sehen oder hören können, etwa ein Gemälde, eine Skulptur, eine Sinfonie, ein Gedicht, ein Roman usw. Unter Kreativität versteht man aber auch die Haltung, aus der heraus erst jene Schöpfungen entstehen, von denen eben gesprochen wurde, und die vorhanden sein kann, ohne dass in der Welt der Dinge etwas Neues geschaffen wird.
Für Kreativität im ersten Sinne, für das kreative Schaffen eines Künstlers, gibt es verschiedene Voraussetzungen: Begabung (oder besser gesagt: genetische Veranlagung), Studium und Übung sowie bestimmte ökonomische und gesellschaftliche Bedingungen, die es dem Betreffenden erlauben, seine Begabung durch Studium und Übung zu entwickeln. Mir geht es im Folgenden nicht um diese Art von Kreativität, sondern um die kreative Haltung, um den kreativen Charakterzug.
Was ist Kreativität? Die beste Antwort scheint mir folgende zu sein: Kreativität ist die Fähigkeit, zu sehen (oder bewusst wahrzunehmen) und zu antworten. Es könnte der Eindruck entstehen, als sei diese Definition von Kreativität zu einfach. Man könnte sagen: „Wenn das Kreativität ist, dann bin ich ganz gewiss kreativ, denn ich nehme Dinge und Menschen ganz bewusst wahr und reagiere darauf. Nehme ich denn nicht wahr, was auf meinem Weg zum Büro geschieht? Reagiere ich nicht mit einem freundlichen Lächeln auf jene Menschen, die mit mir in Kontakt kommen? Sehe ich nicht meine Frau und reagiere auf ihre Wünsche?
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121422
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Ethik Humanismus Pädagogik Werte Freiheit Menschenrechte A. S. Neill Summerhill I. Illich Almosen und Folter Father Wasson Vita activa