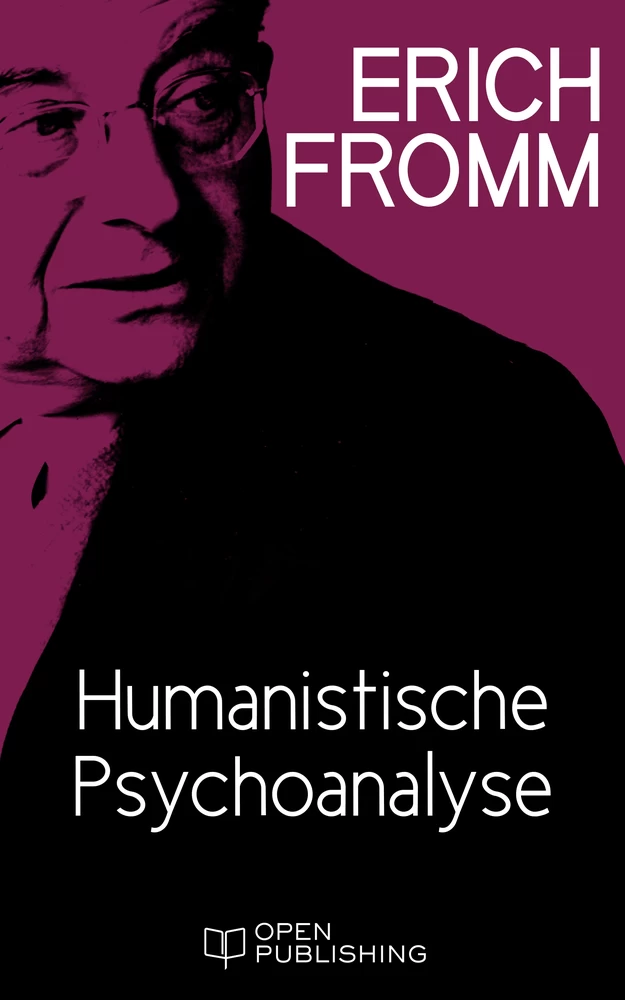Zusammenfassung
Aus dem Inhalt
– Dauernde Nachwirkung eines Erziehungsfehlers
– Ödipus in Innsbruck
– Zum Gefühl der Ohnmacht
– Die Sozialphilosophie der „Willenstherapie“ Otto Ranks
– Individuelle und gesellschaftliche Ursprünge der Neurose
– Einleitung in P. Mullahy „Oedipus. Myth and Complex“
– Das Wesen der Träume
– Anmerkungen zum Problem der Freien Assoziation
– Psychoanalyse als Wissenschaft
– C. G. Jung: Prophet des Unbewussten. Zu „Erinnerungen, Träume, Gedanken“ von C. G. Jung
– Humanismus und Psychoanalyse
– Der Ödipuskomplex. Bemerkungen zum „Fall des kleinen Hans“
– Vorwort in B. Luban-Plozza „Praxis der Balint-Gruppen“
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Humanistische Psychoanalyse
- Inhalt
- Dauernde Nachwirkung eines Erziehungsfehlers
- Ödipus in Innsbruck
- Zum Gefühl der Ohnmacht
- Die Sozialphilosophie der „Willenstherapie“ Otto Ranks
- Individuelle und gesellschaftliche Ursprünge der Neurose
- Einleitung in P. Mullahy „Oedipus. Myth and Complex“
- Das Wesen der Träume
- Anmerkungen zum Problem der Freien Assoziation
- Psychoanalyse als Wissenschaft
- 1. Die psychoanalytische Theorie
- 2. Die psychoanalytische Therapie
- 3. Weiterentwicklungen in der Psychoanalyse
- C. G. Jung: Prophet des Unbewussten. Zu „Erinnerungen, Träume, Gedanken“ von C. G. Jung
- Humanismus und Psychoanalyse
- Der Ödipuskomplex. Bemerkungen zum „Fall des kleinen Hans“
- Vorwort in B. Luban-Plozza „Praxis der Balint-Gruppen“
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Dauernde Nachwirkung eines Erziehungsfehlers
(1926a)[2]
Welche Bedeutung ungeschicktes Verhalten der Mutter dem kleinen Kinde gegenüber für dessen spätere charakterliche Entwicklung haben kann, mögen folgende zwei Beispiele zeigen:
Eine 25jährige Analysandin leidet darunter, dass sie dann, wenn sie auf Fragen etwas antworten soll (z.B. bei Unterhaltungen oder im Examen), gewöhnlich versagt und kein Wort herausbringt. Andererseits aber muss sie bei Gelegenheiten, bei denen es ihr erwünscht wäre, zu schweigen, die Dinge heraussagen, und sie kommt dadurch oft in die unangenehmsten Situationen. Ganz ebenso geht es ihr mit Gefühlsäußerungen. Sie ist außerstande, ihrem Manne gegenüber Liebes- und Dankbarkeitsgefühlen, auch wo sie sie intensiv empfindet, Ausdruck zu geben, während sie ihm alle hässlichen und feindseligen Gefühle mitteilen muss, obwohl sie es durchaus vermeiden möchte. In der Analyse wird ihr diese Verhaltungsweise zusammenfassend beschrieben: Sie könne überhaupt nichts von sich geben, wenn sie es solle oder die Realität es fordert, lasse aber alles zur unrechten Zeit heraus. Sie bringt darauf spontan folgenden Einfall:
Ich erinnere mich an eine Situation aus meinem zweiten oder dritten Lebensjahre. Ich sitze auf dem Töpfchen und meine Mutter sagt mir: „Wenn du jetzt nicht gleich etwas machst, schlage ich dich.“
Die Mutter versuchte dem Kinde allzu streng das Einhalten gewisser Zeiten zur Entleerung aufzuzwingen, bevor bei ihm noch die psychische Bereitschaft dazu vorhanden war. Die Gewöhnung an Reinlichkeit und regelmäßige Entleerung geschah nicht der Mutter „zuliebe“, sondern aus Furcht vor ihren Schlägen, und ein trotziges Zurückhalten, von Angst vor den daraus erwachsenden Unannehmlichkeiten begleitet, ist zum Bestandteil des Charakters des erwachsenen Menschen geworden.
Eine andere Analysandin klagt über ganz ähnliches. Auch sie ist unfähig, ihren Meinungen und Gefühlen Ausdruck zu geben, wenn sie es möchte; sie empfindet jede Frage und Aufforderung als Angriff und fühlt sich vergewaltigt, wenn man ihr doch eine Äußerung entlockt hat. In der Analyse stellt sich heraus, dass die Mutter, als die Analysandin noch ein kleines Kind war, sich jeden Abend zu ihr ans Bett setzte und von dem Kinde verlangte, ihr zu „beichten“, d.h. alles zu erzählen, [X-037] was es am Tage etwa gedacht oder getan hatte. Wenn sich das Kind weigerte, wurde es von der Mutter damit bestraft, dass sie so lange überhaupt nicht mit ihm sprach, bis es sich entschloss, wieder zu „beichten“. Diese frühe Vergewaltigung durch die Mutter erlebte das Mädchen im späteren Leben in allen Aufforderungen, zu reden und sich zu äußern, wieder, und die Unfähigkeit, dies zu tun, ist beträchtlich von dem verkehrten Verhalten der Mutter mitbestimmt.
Ödipus in Innsbruck
(1930d)[3]
Der Fall Halsmann[4] bietet ein psychologisches Rätsel. Denn was den Angeklagten verdächtig macht, ist nicht das Übliche, eine Waffe oder ein Blutfleck, auch nicht der Nachweis eines Motivs für den Mord, sondern die Tatsache, dass er sich auf die Schilderung eines Tatbestandes versteift (der Vater sei durch einen Unglücksfall umgekommen), von dem durch die Sachverständigen nachgewiesen wird, dass er falsch sein muss: Die tödlichen Wunden können ja nicht vom Absturz stammen, sondern sind sicher die Folgen eines gewaltsamen Angriffs. Hätte nun Halsmann gesagt, er wisse nicht, wie sein Vater umgekommen sei, und hätte er nicht mit so hartnäckiger Sicherheit die These vom Unglücksfall vertreten, so wäre wohl gegen ihn kaum die Anklage erhoben worden, und noch viel weniger wahrscheinlich wäre seine Verurteilung gewesen.
Die Verteidigung muss nun also eine Antwort auf die Frage geben, aus welchem Grunde denn der Angeklagte Dinge als Tatsachen hinstellt, die falsch sind, und hartnäckig an dieser Tatsache festhält. Zu diesem Zweck hat sie auf die Möglichkeit hingewiesen, dass der Anblick des tödlich verwundeten Vaters im Sinne eines schweren schockartigen Traumas wirkt und eine, auch und vor allem nach rückwärts verlaufende, Gedächtnislücke (sog. „retrograde Amnesie“) beim Angeklagten bewirkte, die dann später von ihm durch Erfundenes ausgefüllt wurde. Er sei gerade deshalb auf die Unfalltheorie gekommen, weil wohl der erste Gedanke beim Anblick des verwundeten Vaters naturgemäß der gewesen sei, er sei abgestürzt.
Diese psychologische These der Verteidigung genügt aber nicht; denn sie gibt keine Antwort auf die Frage, warum denn gerade dieser Mensch, der doch im Übrigen ganz normal wirkt, auf den, wenn auch ganz plötzlichen Anblick des sterbenden Vaters mit einer Amnesie reagiert, und warum er seine Erinnerungslücken durch eine falsche Darstellung ausfüllt, an der er dann so hartnäckig festhält. (Dass die Verteidiger in der Revisionsverhandlung schließlich die Unfallthese zugunsten der Annahme eines Raubmordes aufgaben, ändert daran wenig, da man den Eindruck von Halsmanns Verhalten im ersten Prozess damit nicht verwischen konnte, und Halsmann selber auch im zweiten Prozess im Großen und Ganzen bei seiner früheren Darstellung blieb.) [VIII-134]
Was nun die Innsbrucker Psychiater angeht, so kommen diese – berufen, durch eingehende Untersuchung der psychischen Situation Halsmanns den Richtern die Möglichkeit einer Urteilsfindung zu erleichtern – ihrer Aufgabe ganz im Geiste des Staatsanwalts nach und erwähnen in ihrem Gutachten, dass man beim Angeklagten auch das Vorhandensein des Freudschen Ödipuskomplexes annehmen könne, dass sie aber diese Spur nicht weiter verfolgen wollten, weil nicht genügend Material vorliege. Dabei stellten sich die Innsbrucker Psychiater den Ödipuskomplex offenbar so vor, als handele es sich um einen Wunsch mancher kranker Menschen, den Vater zu töten. Gelingt es bei einem des Vatermordes Angeklagten, das Vorhandensein dieses Ödipuskomplexes nachzuweisen, so hat die Anklage gewonnenes Spiel. Ein frischer Blutfleck am Anzug des Mörders könnte kein besserer Beweis sein. Aber leider ist es so schwer, diesen Ödipuskomplex zu finden, und da es auch beim Angeklagten nicht gelingt, so muss man sich mit einer Verdächtigung begnügen.
Nun, der Ödipuskomplex ist gar nicht so selten, er ist im Gegenteil ein ganz allgemeiner Mechanismus und, wenn auch in verschiedenen Abwandlungen, bei allen Menschen vorhanden. Hätten die Sachverständigen sich nämlich nicht aufs Raten verlegt, sondern auch nur einige Kapitel aus einem der grundlegenden Werke Freuds gelesen, so hätten sie nicht nur entdeckt, dass der Ödipuskomplex nichts Anormales ist, sondern auch, dass die unbewusste Feindseligkeit zwischen Vater und Sohn sich in Träumen, neurotischen Symptomen und Charaktereigenschaften ausdrückt, aber nicht im realen Mord zu enden pflegt. Sie hätten entdeckt, dass die Psychoanalyse gerade nachgewiesen hat, dass die feindseligen Regungen gegen den Vater zu den verpöntesten seelischen Inhalten gehören, so verpönt, dass sie schon als andeutende Phantasien vom Bewusstsein ausgeschlossen, d.h. verdrängt werden, und umso mehr von der Verwirklichung durch eine Tat. Wäre es anders, so wären die meisten Menschen Vatermörder geworden.
Dessen ungeachtet könnte es ja aber so sein, wie die Anklage behauptet, dass zwischen Sohn und Vater Halsmann eine gewisse feindselige Spannung herrschte. Wir wollen uns einmal auf diesen Standpunkt stellen, um zu sehen, was er für die Klärung des Tatbestandes bedeutet.
Vater und Sohn bildeten offenbar nach Temperament und Eigenart recht schroffe Gegensätze. Der Vater war ein lebhafter, sanguinischer, zu Scherzen und Zoten sehr leicht aufgelegter Mann, der mit viel Stolz und Eitelkeit die Erinnerung und manche Gewohnheiten seiner Militärarztzeit bewahrte; der Sohn ist verschlossen, in sich gekehrt, ernst und offenbar häufig verärgert durch die ihm peinliche Art des Vaters. Wenn auch vieles von dem von der Anklage beigebrachten Material wertlos erscheint, so gibt es doch manches andere, was den Eindruck von einer bestehenden, wohl mehr unbewussten als bewussten Spannung zwischen Vater und Sohn verstärkt. So etwa, wenn wir hören, dass der Vater sehr häufig, und auch noch kurz vor seinem Tode, als es sich darum handelte, eine schwierige Bergtour ohne Führer zu machen, sagte: „Nun, dann wird mich mein Sohn eben beerben, wenn uns etwas zustößt.“ Solch ein Scherz, besonders, wenn er wie bei Halsmanns oft gemacht wird, ist gewöhnlich mehr als nur ein Scherz. Er ist das Anzeichen einer, wenn auch unbewussten, feindseligen Spannung. Diese unbewusste Feindseligkeit mag zur Zeit des Todes des [VIII-135] Vaters eher stärker als schwächer gewesen sein, hatte doch der Vater seinen Sohn zum Frühaufstehen, zu großen Märschen und manchem anderen gezwungen, was den Sohn reizte und verärgerte.
In solcher Verfassung wanderte der Sohn mit dem Vater, und plötzlich hört er den Schrei des Vaters, sieht ihn tödlich verwundet liegen. Dieser Anblick wirkt auf ihn als schweres Trauma, denn plötzlich wird ihm plastisch vor Augen geführt, was der Inhalt seiner geheimsten, vom Gewissen verpöntesten und vom Bewusstsein gänzlich ferngehaltenen Wünsche und Regungen war. Er hatte zwar nie dem Vater etwas Böses getan und hätte ihm auch nie im Leben Böses zugefügt, aber der plötzliche Anblick des sterbenden Vaters reißt einen Abgrund seines Unbewussten auf, vor dem nur die Flucht in die Amnesie rettet. Einen Augenblick mögen seine aggressiven Wünsche gegen den Vater triumphieren, der nächste Augenblick lässt das Schuldgefühl wegen dieser immer verdrängten und von jeder Realisierung gänzlich ausgeschlossenen Wünsche zu einer Stärke anwachsen, die nur den Ausweg einer Verdrängung der ganzen Situation und eines Festhaltens an einer entlastenden Phantasie offen lässt. Die leiseste Spur seiner unbewussten Wünsche muss verwischt werden, nicht um den Richter günstig zu stimmen (denn gerade dadurch gestaltet er ja seine Position ungünstiger, und vielleicht dürfen wir in diesem ungeschickten Verhalten vor Gericht ein Stück unbewusster Selbstbestrafung erblicken), sondern um sein eigenes unbewusstes Schuldgefühl zu beschwichtigen. Deshalb darf auch der Vater nicht durch Mörderhand, sondern muss durch einen selbstverschuldeten Unfall umgekommen sein.
Das, was die Anklage an Material über die Feindseligkeit vom Sohn zum Vater beigebracht hat, reicht also nie und nimmer aus, um einen Mord zu erklären, aber es reicht vielleicht aus, um die Schockwirkung des plötzlichen Anblicks des sterbenden Vaters, d.h. die Amnesie (die Gedächtnislücke) zu erklären.
Aber es wird noch ein weiteres verständlich – und gerade hier liegt ja der schwächste Punkt der Verteidigung –, nämlich die Tatsache, dass der Angeklagte die Gedächtnislücke mit der Erzählung vom Unfall des Vaters ausfüllt und dass er so hartnäckig daran festhält. Wenn es so ist, dass der Tod des Vaters die Erfüllung unbewusster Todeswünsche des Sohnes gegen ihn bedeutet, und dass der plötzliche Tod ein außerordentlich intensives und unerträgliches Schuldgefühl im Sohn hervorruft, so wird es verständlich, warum der Angeklagte gerade deshalb in seiner Phantasie auf eine Todesart des Vaters kommt, bei der überhaupt jede Schuld, auch die eines andern, wegfällt, und warum er so hartnäckig an dieser These festhält. Es ist sein aus seinem unbewussten Vaterhass stammendes Schuldgefühl, das die Amnesie und gleichzeitig die Phantasie vom Unfall des Vaters hervorruft und mit dieser Intensität auch weiter bestehen lässt.
Es ist natürlich schwer, aus der Ferne einen Einblick in die unbewussten Seelenvorgänge des Angeklagten zu gewinnen, und deshalb ist die hier gegebene Erklärung nicht mehr als eine Hypothese, aber immerhin eine, die geeignet erscheint, die verschiedenen psychologischen Schwierigkeiten durch einen einheitlichen Gesichtspunkt zu erklären. Die Nachprüfung dieser Hypothese wäre die Sache von [VIII-136] Sachverständigen, die Gelegenheit hätten, näheren Einblick in die Psyche des Angeklagten zu nehmen.
Wenn die Psychologie zur Klärung eines Tatbestandes herangezogen wird, dann ist zu fordern, dass wenigstens ein Teil der Sachkenntnis von einem Fachmann verlangt wird, wie es bei einem chemischen oder medizinischen Problem selbstverständlich ist. Aber selbst diese recht bescheidene Forderung ist vorläufig wohl nur eine Utopie – und nicht nur in Innsbruck!
Zum Gefühl der Ohnmacht
(1937a)[5]
Der bürgerliche Charakter weist einen eigenartigen Zwiespalt auf.[6] Einerseits hat er eine sehr aktive, auf bewusste Gestaltung und Veränderung der Umwelt ausgerichtete Einstellung. Der bürgerliche Mensch hat mehr als der Mensch irgendeiner früheren Geschichtsepoche den Versuch gemacht, das Leben der Gesellschaft nach rationalen Prinzipien zu ordnen, es in der Richtung des größten Glückes für die größte Zahl der Menschen zu verändern und den Einzelnen aktiv an dieser Veränderung zu beteiligen. Er hat gleichzeitig die Natur in einem bisher nie gekannten Maß bezwungen. Seine technischen Leistungen und Erfindungen stehen einer Verwirklichung aller Träume nahe, die je von der Herrschaft des Menschen über die Natur und seiner Macht geträumt worden sind. Er hat einen bisher ungeahnten Reichtum geschaffen, der zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit eröffnet, die materiellen Bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen. Nie zuvor ist der Mensch so Meister der materiellen Welt gewesen.
Andererseits aber weist der bürgerliche Mensch gerade schroff entgegengesetzte Charakterzüge auf. Er produziert eine Welt der großartigsten und wunderbarsten Dinge; aber diese seine eigenen Geschöpfe stehen ihm fremd und drohend gegenüber; sind sie geschaffen, so fühlt er sich nicht mehr als ihr Herr, sondern als ihr Diener. Die ganze materielle Welt wird zum Monstrum einer Riesenmaschine, die ihm Richtung und Tempo seines Lebens vorschreibt. Aus dem Werk seiner Hände, bestimmt, ihm zu dienen und ihn zu beglücken, wird eine ihm entfremdete Welt, der er demütig und ohnmächtig gehorcht. Dieselbe Haltung der Ohnmacht hat er auch gegenüber dem sozialen und politischen Apparat. Vielleicht wird es der späte Historiker noch rätselhafter finden als wir Zeitgenossen, dass, obwohl allmählich fast jedes Kind wusste, dass man vor Kriegen stand, die auch für den Sieger das entsetzlichste Leiden mit sich brachten, dennoch die Massen nicht etwa mit verzweifelter Energie alles unternahmen, um die Katastrophe abzuwenden, sondern auch noch ihre Vorbereitung durch Rüstungen, militärische Erziehung usw. ruhig geschehen ließen, ja sogar unterstützten. Er wird weiter die Frage erheben, wie es zu erklären sei, dass angesichts der durch die industrielle Entwicklung erreichten ungeheuren Möglichkeiten für das Glück und die Sicherheit der Menschen die große Mehrzahl sich damit abfand, [I-190] dass nichts geschah und dass in plan- und hilfloser Weise das Kommen und Gehen von Krisen und von sie ablösenden kurzen Prosperitätsperioden wie das Wirken unergründlicher Schicksalsmächte abgewartet wurde.
Diese Studie hat die eine Seite des hier angedeuteten Zwiespalts im bürgerlichen Charakter zum Gegenstand, das Gefühl der Ohnmacht. Es ist in der Beschreibung und Analyse des bürgerlichen Charakters bisher immer zu kurz gekommen. Ein wichtiger Grund hierfür liegt auf der Hand: Das Gefühl der Ohnmacht ist dem bürgerlichen Menschen – im Gegensatz zu bestimmten Typen religiöser Menschen – im wesentlichen nicht bewusst und auf Grund rein deskriptiv-psychologischer Methoden kaum zu erfahren. Es erscheint uns deshalb als ein gangbarer Weg, zum Verständnis des hier gemeinten sozialpsychologischen Phänomens vorzudringen, wenn wir von Beobachtungen ausgehen, wie sie die Psychoanalyse Einzelner erlaubt. Gewiss bleibt es weiteren sozialpsychologischen Forschungen vorbehalten, die Allgemeinheit des hier geschilderten Gefühls zu untersuchen. Es ist aber ein erster Schritt auf diesem Wege, den hier zugrunde liegenden seelischen Mechanismus in seiner Struktur, seinen Bedingungen und seinen Wirkungen auf das Verhalten von Individuen darzustellen.
Die extremen Fälle des Ohnmachtsgefühls finden wir nur bei neurotischen Persönlichkeiten; doch lassen sich die Ansätze des gleichen Gefühls auch beim gesunden Menschen unserer Zeit unschwer entdecken. Zur Beschreibung des Gefühls und seiner Folgeerscheinungen eignen sich neurotische Fälle der größeren Deutlichkeit wegen freilich besser, und wir werden uns deshalb im Folgenden meistens auf sie beziehen. Das Ohnmachtsgefühl ist bei neurotischen Menschen so regelmäßig vorhanden und stellt einen so zentralen Teil ihrer Persönlichkeitsstruktur dar, dass sich vieles dafür sagen ließe, die Neurose geradezu von diesem Ohnmachtsgefühl her zu definieren. In jeder Neurose, Symptom- oder Charakterneurose, handelt es sich darum, dass ein Mensch nicht imstande ist, bestimmte Funktionen auszuüben, dass er etwas nicht tun kann, was er können sollte, und dass diese Unfähigkeit mit einer tiefen Überzeugung von der eigenen Schwäche und Machtlosigkeit einhergeht, sei es, dass diese Überzeugung bewusst ist oder dass es sich um eine „unbewusste Überzeugung“ handelt.
In den neurotischen Fällen wird der Inhalt des Ohnmachtsgefühls etwa folgendermaßen beschrieben: Ich kann nichts beeinflussen, nichts in Bewegung setzen, durch meinen Willen nicht erreichen, dass irgendetwas in der Außenwelt oder in mir selbst sich ändert, ich werde nicht ernstgenommen, bin für andere Menschen Luft. Folgender Traum einer Analysandin gibt eine schöne Illustration des Ohnmachtsgefühls:
Sie hatte in einem Drugstore etwas getrunken und eine Zehndollarnote in Zahlung gegeben. Nachdem sie ausgetrunken hatte, verlangt sie vom Kellner den Restbetrag. Er antwortet ihr, den habe er ihr doch längst gegeben und sie solle nur richtig in ihrer Tasche nachsehen, dann werde sie ihn schon finden. Sie kramt alle ihre Sachen durch und findet natürlich den Betrag nicht. Der Kellner antwortet in kühl überlegenem Ton, es sei nicht seine Sache, wenn sie das Geld verloren habe, und er könne sich nicht weiter damit befassen. Voller Wut rennt sie auf die Straße, um einen Polizisten zu holen. Sie findet zunächst eine Polizistin, der sie die Geschichte erzählt. Diese geht auch in den Drugstore und verhandelt mit dem Kellner. Als sie zurückkommt, sagt [I-191] sie der Träumerin lächelnd überlegen, es sei ja klar, dass sie das Geld bekommen habe, „sehen Sie nur richtig nach, und Sie werden es schon finden“. Die Wut steigert sich, und sie läuft zu einem Polizisten, um ihn zu bitten einzuschreiten. Dieser gibt sich kaum Mühe zuzuhören und antwortet ganz von oben herab, um solche Sachen könne er sich nicht kümmern und sie solle machen, dass sie weiterkomme. Endlich geht sie in den Drugstore zurück. Da sitzt der Kellner in einem Lehnsessel und fragt sie grinsend, ob sie sich nun endlich beruhigt hätte. Sie gerät in ohnmächtige Wut.
Die Objekte, auf die sich das Ohnmachtsgefühl bezieht, sind sehr mannigfaltig. Zunächst und in erster Linie bezieht es sich auf Menschen. Es besteht die Überzeugung, dass man andere Menschen in keiner Weise beeinflussen könne; man kann sie weder kontrollieren noch von ihnen erreichen, dass sie das tun, was man will. Solche Charaktere sind häufig sehr erstaunt, wenn sie hören, dass ein anderer über sie in ernsthafter Weise gesprochen oder gar sich auf sie oder eine Meinung von ihnen bezogen hat. Ihre realen Fähigkeiten haben damit nichts zu tun. Ein Analysand, der auf seinem wissenschaftlichen Gebiet außerordentliches Ansehen genoss und vielfach zitiert wurde, war jedes Mal von neuem überrascht, dass ihn überhaupt jemand ernst nahm und dem, was er sagte, irgendwelche Bedeutung zumaß. Auch die lange Erfahrung, dass dies tatsächlich so war, hatte an dieser Einstellung kaum etwas geändert. Solche Menschen glauben auch nicht, dass sie irgendjemanden kränken können, sie sind gerade deshalb häufig in ungewöhnlichem Maße zu aggressiven Äußerungen imstande und völlig davon überrascht, dass ein anderer beleidigt ist. Wenn man dieser Überraschung nachgeht, so stellt sich als Grund dafür eben die tiefe Überzeugung heraus, sie könnten überhaupt nicht ernst genommen werden.
Diese Menschen glauben nicht daran, sie vermöchten irgendetwas dazu zu tun, dass jemand sie liebt oder gern hat. Sie machen auch gar keine Anstrengung, aus sich herauszugehen, sich in aktiver Weise so zu verhalten, wie es nötig wäre, um Liebe und Sympathie anderer zu gewinnen. Wenn dies dann natürlich ausbleibt, so ziehen sie die Folgerung, dass sie niemand liebt, und sehen nicht, dass hier eine optische Täuschung vorliegt. Während sie meinen, dass infolge irgendwelcher Mängel oder unglücklicher Umstände sich keiner findet, der sie liebt, ist es in Wirklichkeit ihre Unfähigkeit zu irgendeiner Anstrengung, die Liebe anderer zu gewinnen, die an der Wurzel des von ihnen beklagten Zustandes liegt. Da sie nicht glauben, dass sie irgendetwas dazu tun können, um geliebt zu werden, konzentriert sich alle ihre Aufmerksamkeit auf die in ihnen einmal vorhandenen Qualitäten, wie sie sie von Geburt mitbekommen haben. Sie sind ständig von dem Gedanken erfüllt, ob sie klug, schön, gut genug wären, um andere anzuziehen. Die Frage lautet immer: „Bin ich klug, schön usw., oder bin ich es nicht?“ Das müsse man herausfinden, denn die Möglichkeit, sich aktiv zu verändern und die anderen zu beeinflussen, gibt es für sie nicht. Das Resultat ist dann gewöhnlich ein tiefes Minderwertigkeitsgefühl, dass man eben die Qualitäten nicht hat, die nötig wären, um Liebe und Sympathie zu finden. Soweit es sich um den Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung handelt, ist es nicht anders. Solche Menschen denken zwangsmäßig darüber nach, ob sie so begabt wären, um die Bewunderung aller anderen hervorzurufen. Ihr Ohnmachtsgefühl hindert sie aber daran, Anstrengungen zu machen, zu arbeiten, zu lernen, etwas zu produzieren, was [I-192] die andern wirklich anerkennen oder bewundern. Ein Selbstgefühl, das zwischen Größenideen und dem Gefühl der absoluten Wertlosigkeit schwankt, ist gewöhnlich das Resultat.
Eine andere wichtige Folge des Ohnmachtsgefühls vor Menschen ist die Unfähigkeit, sich gegen Angriffe zu verteidigen. Das kann sich auf körperliche Angriffe beziehen, und die Folge ist dann ein mehr oder weniger ausgeprägtes Gefühl der körperlichen Hilflosigkeit. Dies führt häufig dazu, dass Menschen von den in ihnen vorhandenen körperlichen Kräften im Falle der Gefahr keinerlei Gebrauch machen können, dass sie wie gelähmt sind und gar nicht auf den Gedanken kommen, sich auch pur wehren zu können. In der Praxis sehr viel wichtiger als die Unfähigkeit zur Verteidigung gegen körperliche Bedrohung ist die Verteidigungsunfähigkeit gegen alle anderen Arten von Angriffen. Man findet in diesen Fällen, dass Menschen jede gegen sie gerichtete Kritik, ungerechtfertigte wie gerechtfertigte, einfach hinnehmen und nicht imstande sind, Gegenargumente vorzubringen. Manchmal wissen sie, dass die Kritik ungerechtfertigt ist, und können nur zu ihrer Verteidigung nichts äußern. In extremen Fällen geht aber die Hilflosigkeit so weit, dass sie auch nicht mehr imstande sind zu fühlen, dass sie ungerechtfertigt kritisiert werden, und jede Kritik oder jeden Vorwurf als berechtigt innerlich akzeptieren. Die gleiche Verteidigungsunfähigkeit bezieht sich häufig auch auf alle Arten von Beleidigungen und Demütigungen. Auch hier schwankt das Verhalten zwischen einer Unfähigkeit, auf die Beleidigung entsprechend zu antworten, und einem willigen Hinnehmen in der Überzeugung, der andere habe Recht und Grund, sie zu demütigen. Oft geht es so, dass erst nach Stunden oder Tagen die Tatsache der Unberechtigtheit eines Vorwurfs oder der Unverschämtheit einer Beleidigung ins Bewusstsein kommt. Dann fallen häufig den Betreffenden alle Argumente ein, die sie zur Entkräftung des Vorwurfs hätten gebrauchen, oder alle Grobheiten, die sie auf die Beleidigung hin hätten äußern können. Sie führen sich die Situation wieder und wieder vor Augen, phantasieren bis in alle Details, wie sie es hätten machen sollen, steigern sich in eine Wut, die sich manchmal mehr gegen den anderen, manchmal mehr gegen sie selbst richtet, um doch bei der nächsten Gelegenheit wieder genauso gelähmt und hilflos einem Angriff gegenüberzustehen.
Das Ohnmachtsgefühl tritt Dingen gegenüber ebenso in Erscheinung wie Menschen. Es führt dazu, dass sich Menschen in jeder Situation, die ihnen nicht geläufig ist, völlig hilflos fühlen. Es kann sich darum handeln, dass sie sich in einer fremden Stadt außerstande fühlen, sich allein zurechtzufinden, oder dass sie bei einer Autopanne ganz unfähig sind, auch nur den leisesten Versuch zu unternehmen nachzusehen, wo die Störung liegen kann, oder dass sie bei einer Wanderung, bei der sie über einen kleinen Bach springen müssen, sich völlig gelähmt fühlen, dies zu tun, oder dass sie unfähig sind, sich ihr Bett zu machen oder sich etwas zu kochen, wenn die Situation es erfordert. Ein Verhalten, welches man als besonders unpraktisch oder ungeschickt bezeichnet, geht häufig auf das Ohnmachtsgefühl zurück. Wir vermuten, dass auch beim Schwindelgefühl auf Höhen das Ohnmachtsgefühl nicht selten die Wurzel darstellt.
Das Ohnmachtsgefühl äußert sich auch im Verhältnis zur eigenen Person. Ja, hier liegen vielleicht seine wichtigsten Folgen für das Individuum. Eine Erscheinungsform des Ohnmachtsgefühls auf dieser Ebene ist die Hilflosigkeit gegenüber den in einem [I-193] selbst wirksamen Trieben und Ängsten. Es fehlt völlig der Glaube, dass man auch nur den Versuch machen könne, seine Triebe oder Ängste zu kontrollieren. Das Motto ist eben immer: „Ich bin einmal so, und daran kann ich nichts ändern.“ Nichts scheint überhaupt unmöglicher, als sich zu ändern. Sie können ihr Leben damit zubringen, darüber zu jammern und zu klagen, wie schrecklich sie unter dieser oder jener Eigenschaft leiden, sie können auch bewusst sich äußerst bereit zeigen, sich zu ändern, aber bei näherer Beobachtung wird deutlich, dass sie deshalb nur umso hartnäckiger an der Überzeugung festhalten, sie selbst könnten nichts ändern. In manchen Fällen ist die Diskrepanz zwischen dieser unbewussten Überzeugung und den bewussten kompensierenden Veranstaltungen geradezu grotesk. Ob solche Menschen von einem Arzt zum anderen oder von einer religiösen oder philosophischen Lehre zu anderen laufen, ob sie jede Woche einen neuen Plan haben, wie sie sich ändern können, oder von jeder Liebesbeziehung erwarten, dass sie die große Änderung vollbringe, alle diese Geschäftigkeit und bewusste Anstrengung ist doch nur der Schirm, hinter dem sie sich im Gefühl der tiefsten Ohnmacht verstecken.
Wie schon oben erwähnt, glauben sie nicht daran, ihre Wünsche durchsetzen und selbständig etwas erreichen zu können. Menschen dieser Art warten immer auf etwas und sind tief davon überzeugt, dass sie zum Ergebnis nichts tun können. Sehr häufig geht dieses Gefühl so weit, dass sie es aufgeben, überhaupt etwas zu wünschen oder zu wollen, ja, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich wünschen. Gewöhnlich tritt an die Stelle der eigenen Wünsche die Erwägung, was andere von ihnen erwarten. Ihre Entscheidungen nehmen zum Beispiel die Form an, darüber nachzugrübeln, dass, wenn sie diesen Schritt tun, ihre Frau ihnen böse ist, und wenn sie einen anderen Schritt tun, ihr Vater. Sie entscheiden sich zum Schluss nach der Richtung, wo sie das Bösesein am wenigsten fürchten, aber es kommt überhaupt nicht zur Aufrollung der Frage, was sie eigentlich am liebsten tun möchten. Die Folge ist häufig, dass solche Menschen bewusst oder unbewusst das Gefühl haben, von anderen vergewaltigt zu werden, wütend darüber sind und doch nicht sehen, dass sie es in erster Linie sind, die sich vergewaltigen lassen.
Der Grad der Bewusstheit des Ohnmachtsgefühls schwankt nicht weniger als der seiner Intensität. In vielen Fällen ist es als solches bewusst. Hier handelt es sich allerdings um Fälle schwerer Neurosen, in denen die Leistungsfähigkeit und das soziale Funktionieren der Menschen so eingeschränkt sind, dass sie des Zwanges enthoben sind, sich über das Gefühl ihrer Ohnmacht hinwegzutäuschen. Der Betrag an seelischem Leiden, der mit der völligen Bewusstheit des Ohnmachtsgefühls verknüpft ist, ist kaum zu überschätzen. Das Gefühl tiefer Angst, der Sinnlosigkeit des eigenen Lebens, ist regelmäßig in solchen Fällen gegeben. Allerdings finden sich in schweren Neurosen auch die gleichen Wirkungen des Ohnmachtsgefühls, ohne dass dieses als solches überhaupt bewusst wäre. Es bedarf häufig langwieriger analytischer Arbeit, um das unbewusste Ohnmachtsgefühl ins Bewusstsein zu heben und mit seinen Folgeerscheinungen zu verknüpfen. Aber auch da, wo dieses Gefühl bewusst ist, zeigt sich gewöhnlich in der Analyse, dass das nur für einen kleinen Teil seines Umfangs gilt. Es stellt sich meist heraus, dass die tiefe Angst, die das Ohnmachtsgefühl begleitet, bewirkt, dass es nur in sehr abgeschwächter Form ins Bewusstsein zugelassen wird. [I-194]
Ein erster Versuch, das Quälende des Gefühls zu überwinden, liegt in einer Reihe von Rationalisierungen, die das Ohnmachtsgefühl begründen sollen. Die wichtigsten der begründenden Rationalisierungen sind folgende: Die Ohnmacht wird auf körperliche Mängel zurückgeführt. In solchen Fällen bestehen die Menschen darauf, körperlich schwach zu sein, keine Anstrengungen zu vertragen, diesen oder jenen körperlichen Defekt zu haben, „leidend“ zu sein. Damit gelingt es ihnen, das Ohnmachtsgefühl, das in Wirklichkeit psychische Wurzeln hat, auf körperliche Mängel zurückzuführen, die ihnen nicht zur Last zu legen sind und an denen sich auch im Prinzip nichts ändern lässt. Eine andere Form der begründenden Rationalisierungen ist die Überzeugung, durch bestimmte Lebenserfahrungen so geschädigt worden zu sein, dass ihnen alle Aktivität und aller Mut geraubt wurde. Bestimmte Erlebnisse in der Kindheit, unglückliche Liebe, ein finanzieller Zusammenbruch, Enttäuschungen mit Freunden werden als die Ursachen für die eigene Hilflosigkeit angesehen. Ein simplifizierendes Missverständnis der psychoanalytischen Theorie hat diese Rationalisierungen in mancher Hinsicht noch erleichtert. Es gibt manchen Menschen den Vorwand zu dem Glauben, dass sie ihre Ohnmacht der Tatsache verdanken, dass sie mit drei Jahren einmal von der Mutter Schläge bekommen haben oder dass sie mit fünf Jahren von einem älteren Bruder ausgelacht worden sind. Eine andere Form der begründenden Rationalisierungen erweist sich oft als besonders verhängnisvoll, nämlich die Tendenz, in der Phantasie oder auch in Wirklichkeit eine Schwierigkeit auf die andere zu türmen und damit das Gefühl zu haben, dass die Aussichtslosigkeit der realen Situation es verständlich macht, wenn man sich ihr gegenüber hilflos fühlt. Was sich hier abspielt, ist zum Beispiel folgendes: Ein Beamter soll einen Bericht schreiben und fühlt sich dieser Aufgabe gegenüber hilflos. Während er an seinem Schreibtisch sitzt und das Gefühl seiner Schwäche wahrnimmt, geht ihm durch den Kopf, dass er Angst hat, seine Stelle zu verlieren, dass seine Frau krank ist, dass sein Freund ihm böse sein wird, weil er ihm so lange nicht geschrieben hat, dass es im Zimmer zu kalt ist, bis er endlich in seiner Phantasie eine so traurige und aussichtslose Situation zusammengebraut hat, dass das Gefühl der Ohnmacht als das ganz natürliche und adäquate Kapitulieren vor zu großen Schwierigkeiten erscheint. Noch verhängnisvoller ist es, wenn sich die Tendenz, die Situation zu verschlimmern, nicht nur auf Phantasien beschränkt, sondern sich auf das Verhalten in der Wirklichkeit erstreckt. Der Betreffende wird dann geneigt sein, wirklich krank zu werden, seinen Chef so zu provozieren, dass er ihn in der Tat entlässt, mit seiner Frau Streit anzufangen, so dass den ganzen Tag Unfriede im Hause herrscht, und wenn ihm alles dies gelungen ist, fühlt er sich völlig gerechtfertigt, seine Ohnmacht als durch die Unerträglichkeit der äußeren Verhältnisse begründet anzusehen. Gewiss hat die hier geschilderte Tendenz, sich in der Phantasie oder in Wirklichkeit Leiden zuzufügen, sich schwach und unglücklich zu machen, noch andere Wurzeln. Dies zu erörtern führt in das Problem des Masochismus, auf das wir hier nicht eingehen können. (Vgl. hierzu E. Fromm, Sozialpsychologischer Teil, 1936a, GA I, S. 139-187, sowie K. Horney, 1937.) Die Rationalisierung des eigenen Ohnmachtsgefühls ist aber sicherlich einer der Faktoren, der für die Tendenz zur phantasierten oder realen Steigerung des eigenen Leidens verantwortlich ist.
Eine andere Gruppe von Rationalisierungen tritt in Erscheinung, wenn das [I-195] Ohnmachtsgefühl weniger bewusst ist als in den eben besprochenen Fällen. Die Rationalisierungen haben dann weniger einen begründenden als vielmehr einen tröstenden Charakter und dienen dazu, die Hoffnung zu erwecken, dass die eigene Ohnmacht nur eine vorübergehende sei. Die zwei wichtigsten Formen dieser tröstenden Rationalisierungen sind der Glaube an das Wunder und der Glaube an die Zeit. Beim Glauben an das Wunder dreht es sich um die Vorstellung, durch irgendein von außen eintretendes Ereignis werde plötzlich die eigene Ohnmacht verschwinden und alle Wünsche nach Erfolg, Leistung, Macht und Glück erfüllt werden. Die Formen, in denen dieser Glaube auftritt, sind äußerst mannigfaltig. Häufig ist es so, dass man erwartet, irgendeine Veränderung in äußeren Lebensumständen werde den Umschwung bringen, sei es eine neue Liebesbeziehung, der Umzug in eine andere Stadt oder eine andere Wohnung, ein neuer Anzug, ein neues Jahr oder auch nur ein frischer Bogen Papier, auf dem die Arbeit besser gehen wird. Bei religiösen Menschen nimmt der Glaube an das Wunder zuweilen die Form an, Gott werde plötzlich in das Schicksal eingreifen. Eine weitere Form des Wunderglaubens ist die, dass durch bestimmte Menschen das eigene Schicksal geändert werde. Ein häufiges (oben bereits erwähntes) Beispiel hierfür sind Menschen, die von einem Arzt zum anderen laufen und jedes Mal erwarten, er werde das Wunder vollbringen. Das Gemeinsame an all diesen tröstenden Illusionen ist immer, dass man selbst nichts zum gewünschten Erfolg zu tun braucht, auch gar nichts dazu tun kann, sondern dass eine außerhalb des Menschen stehende Macht oder Konstellation plötzlich das Gewünschte vollbringt.
Eine besondere Form dieses Wunderglaubens ist der Ersatz kausaler Beeinflussung durch magische Handlungen, die dem Bewusstsein die Illusion eigener Aktivität gestatten. Der Inhalt der magischen Geste kann sehr verschieden sein. Ob es sich darum handelt, einem Bettler ein Almosen zu geben, einer alten Tante einen Besuch zu machen, aufs korrekteste seine Pflicht zu erfüllen oder vor dem Beginn der Arbeit dreimal bis dreißig zu zählen, die Erwartung ist immer dieselbe. Wenn ich dies oder jenes tue, dann wird sich alles so wenden, wie ich es wünsche. Wie bei allen magischen Handlungen tritt an die Stelle der objektiven Beeinflussung ein rein in Gedanken des Subjekts vorhandener Kausalnexus. Häufig wird es den betreffenden Menschen gar nicht bewusst, dass sie eine bestimmte Handlung im Sinne einer magischen Geste ausführen, häufig, vor allem bei Zwangsneurotikern, kann die magische Geste zu einem äußerst quälenden Zeremoniell ausarten. Gerade in der Stärke des Ohnmachtsgefühls und der magischen Gesten als seiner spezifischen Überwindung liegt eine der Charakteristiken der Zwangsneurose.
Beim Glauben an die Zeit fehlt das Moment der Plötzlichkeit der Veränderung. Stattdessen besteht die Erwartung, dass sich „mit der Zeit“ schon alles machen werde. Von Konflikten, zu deren Lösung man sich selbst außerstande fühlt, wird erwartet, dass die Zeit sie schon lösen werde, ohne dass man selbst das Risiko einer Entscheidung auf sich nehmen muss. Besonders häufig findet man diesen Glauben an die Zeit mit Bezug auf die eigenen Leistungen. Menschen trösten sich über die Tatsache, dass sie nicht nur nichts von dem vollbringen, was sie leisten wollen, sondern auch selbst keine Vorbereitungen dazu treffen, damit hinweg, sie hätten ja noch lange Zeit, und es sei kein Grund, sich zu eilen. Ein Beispiel für diesen Mechanismus ist der Fall, in [I-196] dem ein sehr begabter Schriftsteller, der ein Buch schreiben wollte, das seiner Meinung nach zu einem der wichtigsten Bücher der Weltliteratur gehören würde, nicht mehr tat, als eine Reihe von Gedanken über das zu haben, was er schreiben wollte, in Phantasien zu schwelgen, welche epochemachende Wirkung sein Buch haben würde, und seinen Freunden zu erzählen, es sei schon fast fertig. In Wirklichkeit hatte er noch nicht eine Zeile davon geschrieben, obwohl er schon seit sieben Jahren an dem Buch „arbeitete“. Je älter solche Menschen werden, desto krampfhafter müssen sie an der Illusion festhalten, die Zeit werde es bringen. Bei vielen führt das Erreichen eines bestimmten Alters – häufig um den Beginn der Vierzig herum – entweder zu einer Ernüchterung, zu einem Aufgeben der Illusion und zu einer Anstrengung, die eigenen Kräfte zu benutzen, oder zu einem neurotischen Zusammenbruch, der mit darauf beruht, dass das Leben ohne die tröstende Zeitillusion unerträglich wird.
Handelt es sich bei den tröstenden Rationalisierungen noch darum, dass das Gefühl der Ohnmacht vage bewusst ist, aber sein Stachel durch die Hoffnung auf seine Überwindung gemildert wird, so geht eine dritte Reaktion noch weiter in der Unterdrückung des Ohnmachtsgefühls. Hier wird es durch ein überkompensierendes Verhalten und verdeckende Rationalisierungen ersetzt. Der häufigste Fall solcher Überkompensierungen ist der der Geschäftigkeit. Wir finden, dass Menschen, die ein tiefes Ohnmachtsgefühl verdrängt haben, besonders aktiv und geschäftig sind, und zwar bis zu einem Grade, dass sie vor sich selbst und anderen gerade als das Gegenteil von ohnmächtigen Menschen erscheinen. Solche Menschen müssen immer etwas tun. Wenn sie sich in ihrer Stellung bedroht fühlen, so verhalten sie sich nicht so, wie wir es oben geschildert haben, dass sie Schwierigkeiten über Schwierigkeiten türmen, um sich ihre Unfähigkeit, irgendetwas zu unternehmen, zu beweisen, sie schwelgen auch nicht in Phantasien über ein Wunder, was geschehen werde, sondern sie fangen an, von Pontius zu Pilatus zu laufen, dieses und jenes zu unternehmen, und erwecken den Eindruck höchster Aktivität in der Abwehr der Gefahr. Oder wenn sie eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben haben, sitzen sie nicht träumend vor ihrem Schreibtisch, sondern bestellen sich Dutzende von Büchern aus der Bibliothek, besprechen sich mit allen möglichen Fachleuten, deren Meinung wichtig sein könnte, machen Reisen zum Studium gewisser Probleme und schützen sich so vor der Einsicht, dass sie sich ohnmächtig fühlen, die erwartete Leistung zu vollbringen. Eine andere Form der Scheinaktivität äußert sich in Dingen wie der „Vereinsmeierei“, in der fortwährenden Bekümmerung um andere Menschen oder auch nur im Kartenspielen oder langen Stammtischunterhaltungen. Es ist oft recht schwer, die Grenze zwischen dieser scheinbaren und der echten Aktivität zu ziehen. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass sich die Geschäftigkeit immer auf Dinge erstreckt, die im Verhältnis zum zu lösenden Problem nebensächlich und untergeordnet sind, und dass die Geschäftigkeit keine Beziehung zu den fundamentalen Zügen der zu lösenden Aufgabe hat. Im Falle des Neurotikers ist der Gegensatz zwischen echter Aktivität und Geschäftigkeit sehr viel leichter zu erkennen als im Falle des gesunden, realitätsangepassten Menschen. Hier ist es gewöhnlich so, dass er Aufgaben zu lösen hat, zu deren Vollbringung im Grunde nicht mehr als eine bestimmte Routine gehört und die eine echte Aktivität gar nicht erfordern. Der durchschnittliche Mensch der bürgerlichen Gesellschaft sieht sich [I-197]einer Reihe von Aufgaben und Problemen gegenüber, zu deren routinemäßiger Lösung er von früh auf trainiert ist, und weil niemand etwas anderes von ihm erwartet, wird auch das Bewusstsein seiner faktischen Ohnmacht nie so quälend, dass er es durch ein extremes und lächerliches Ausmaß an Geschäftigkeit verdecken müsste. Was im gesellschaftlichen Maßstab gesehen als Aktivität erscheint, mag psychologisch gesehen als Geschäftigkeit aufgefasst werden, und häufig wird man sich überhaupt nicht darüber einigen können, ob ein Verhalten der einen oder anderen Kategorie zuzuschreiben ist.
Eine noch radikalere Reaktionsbildung gegen das Ohnmachtsgefühl ist das Streben nach Kontrolle und Führung in jeder Situation. In vielen Fällen bleibt dieser Wunsch rein auf die Phantasie beschränkt. Menschen ergehen sich dann in Phantasien darin, wie viel besser sie ein Unternehmen oder eine Universität leiten würden als die faktischen Leiter, oder sie stellen sich sich als Diktatoren eines Staates oder der gesamten Menschheit vor und schwelgen in diesen Phantasien. Oder es kommt nicht zur Ausbildung von solchen elaborierten Phantasien, sondern die Größenideen bleiben vage und sind den Betreffenden wenig bewusst. In solchen Fällen findet man bewusst häufig nur die Erwartung, allen Menschen, mit denen man zusammenkommt, überlegen zu sein, oder, wenn auch noch diese Erwartung verdrängt ist, eine Wutreaktion, wenn man mit Menschen zusammentrifft, denen gegenüber man seine Überlegenheit nicht durchsetzen kann. Wenn auch diese Wutreaktion verdrängt ist, so ist gewöhnlich nichts sichtbar als eine gewisse Gehemmtheit und Schüchternheit gegenüber denen, die den Vorrang beanspruchen können. Gleichgültig, ob nun die Größenideen mehr oder weniger elaboriert und mehr oder weniger bewusst sind, ihre Häufigkeit und ihre Intensität, speziell beim Angehörigen der bürgerlichen Mittelschichten und besonders bei Intellektuellen, lassen sich kaum überschätzen. Da die Menschen immer wieder ernüchtert aus solchen Träumereien aufwachen, erfüllen diese ihre Funktion, das vorhandene Ohnmachtsgefühl zu kompensieren, nur sehr unvollkommen. Anders ist es schon, wenn der Wunsch nach Kontrolle und Macht sich nicht nur auf Phantasien beschränkt, sondern sich im Verhalten in der Wirklichkeit ausdrückt. Wenn es gelingt, ihre faktische Ohnmacht im Großen durch faktische Macht im Kleinen zu ersetzen, so wird häufig ein Gleichgewicht hergestellt, das für ein Leben lang anhalten kann. Der häufigste Fall dieser Art sind Männer, wie wir sie besonders im europäischen Kleinbürgertum finden, die in ihrer gesellschaftlichen und ökonomischen Existenz völlig ohnmächtig sind, aber ihren Frauen, Kindern und vielleicht dem Hund gegenüber einen intensiven Wunsch nach Macht und Kontrolle haben und imstande sind, ihn auch zu realisieren und zu befriedigen. In neurotischen Fällen finden wir gewöhnlich, dass die Teilung der Welt in eine Sphäre, wo man ohnmächtig, und eine, wo man mächtig ist, nicht gelingt. Der Neurotiker empfindet den Wunsch nach Kontrolle und Macht in jeder Situation, auch dort, wo ihre Ausübung unmöglich ist. Es ist ihm unerträglich, einen Vorgesetzten zu haben, er hat immer das Gefühl, alles besser zu verstehen und besser zu machen, er will in jeder Unterhaltung die dominierende Rolle spielen, in jeder Gesellschaft die anderen beherrschen. Aus diesem verstärkten Wunsch nach Kontrolle und Macht heraus werden auch Situationen, die für einen anderen Menschen gar kein Beweis seiner eigenen Unzulänglichkeit sind, zu [I-198] solchen, die er als beschämende Niederlagen empfindet. In extremen Fällen, die jedoch recht häufig sind, bedeutet jede Konstellation, in der er nicht führend und kontrollierend ist, eine Niederlage und einen Beweis seiner Ohnmacht. Es kommt zu einem circulus vitiosus. Der verstärkte Wunsch nach Kontrolle und Macht ist zur gleichen Zeit eine Reaktion auf das Ohnmachtsgefühl und die Wurzel für seine Verstärkung.
Die Verdrängung des Ohnmachtsgefühls entfernt zwar, wie jede andere Verdrängung, das Gefühl aus dem Bewusstsein, hindert es aber nicht daran, zu existieren und bestimmte Wirkungen zu haben. Zwar hängt deren Art davon ab, ob das Ohnmachtsgefühl bewusst ist oder nicht, ihre Stärke aber wird im wesentlichen nur von seiner Intensität bedingt.
Die wichtigste und allgemeinste Folge des Ohnmachtsgefühls ist Wut, und zwar eine Wut, die besonders durch ihre Ohnmächtigkeit gekennzeichnet ist. Ihr Ziel ist nicht, wie bei anderen Arten der Wut, die aktive und zielbewusste Vernichtung des Feindes, sondern sie ist viel vager, unbestimmter, aber auch viel destruktiver gegen die Außenwelt und gegen das eigene Selbst gerichtet. Bei Kindern drückt sich das häufig im Strampeln aus, bei Erwachsenen im Weinen, manchmal aber auch in einem Wutanfall, dem jede Zielgerichtetheit und Beziehung zur Aktion fehlt. Gewöhnlich allerdings ist die ohnmächtige Wut nicht bewusst. Sie wird häufig durch trotziges und eigensinniges Verhalten ausgedrückt beziehungsweise ersetzt. Dieser Trotz kann ganz bewusst sein. Hierher gehören Menschen, die sich nie einer Anordnung fügen können, die immer widersprechen müssen, nie zufrieden sind und so fort. Er kann auch unbewusst sein, und dann entsteht gewöhnlich das Bild einer allgemeinen Gehemmtheit. In solchen Fällen haben die betreffenden Menschen bewusst den besten Willen, aktiv zu sein und das zu tun, was andere von ihnen oder sie von sich selbst erwarten. Aber sie sind trotz allen guten Willens ständig unlustig, missgestimmt und zu keiner Initiative fähig. Sind nicht nur die Wut und der Trotz aus dem Bewusstsein verdrängt, sondern an der Wurzel gebrochen und umgebogen, dann findet man häufig eine Reaktionsbildung, die sich als Überfreundlichkeit und Übergefügigkeit äußert.
Die Folge der Wut ist immer Angst. Je mehr die Wut verdrängt ist, desto größer ist die Angst. Auf die komplizierten Mechanismen, die hierfür verantwortlich sind, können wir an dieser Stelle nicht eingehen. Als wichtigsten wollen wir die Projektion der eigenen Wut auf andere hervorheben. Um die Verdrängung der eigenen Wut zu sichern, wird das Gefühl erzeugt, das sich in dem Motto ausdrücken lässt: „Nicht ich bin auf andere wütend, sondern andere auf mich.“ Die Folge davon ist das Gefühl, von anderen gehasst oder verfolgt zu werden, und die Folge hiervon ist Angst. Neben diesem indirekten Weg über die Verdrängung der Wut wird die Angst auch direkt aus dem Ohnmachtsgefühl gespeist. Das Gefühl, seine Ziele nicht durchsetzen zu können und vor allem gegen Angriffe von anderen wehrlos zu sein, erzeugt notwendigerweise immer neue Angst. Das Ohnmachtsgefühl schafft Angst, die Angst aber verstärkt ihrerseits wieder das Ohnmachtsgefühl. Dieser Zirkel ist dafür verantwortlich, dass in so vielen Fällen ein einmal vorhandenes Ohnmachtsgefühl, statt allmählich zu verschwinden, immer stärker wird, und die Menschen gleichsam mit jedem Schritt tiefer in den Sumpf geraten. [I-199]
Ein besonders günstiges Beobachtungsfeld für das Ohnmachtsgefühl und die verschiedenen Formen seiner Verdeckung oder Versuche zu seiner Überwindung bietet die psychoanalytische Situation. Manche Analysanden dieser Art werden dem Analytiker wieder und wieder klarmachen, dass sie sich nicht ändern können, weil sie schon zu alt seien, weil die Neurose in ihrer Familie erblich sei, weil sie nicht die Zeit hätten, die Analyse lange genug durchzuführen, oder was sonst immer als Rationalisierung gefunden werden kann. Häufiger als das offene Gefühl der Ohnmacht und der Aussichtslosigkeit der analytischen Bemühungen sind die Fälle, wo im Bewusstsein ein gewisser Optimismus und eine positive Erwartung vorherrschen. Der Analysand hat das Gefühl, er wolle sich ändern und könne es auch, aber wenn man näher zusieht, entdeckt man, dass er alles andere erwartet, nur nicht, dass er selbst dazu etwas tun könne. Seine grundlegende Erwartung ist die, dass der Analytiker oder „die Analyse“ das Entscheidende für ihn tun müssten und dass er im Grunde passiv diese Prozedur über sich ergehen lassen könne. Sein wirklicher Unglaube an irgendeine Veränderung wird häufig durch die oben dargestellten tröstenden Rationalisierungen verdeckt. Er erwartet, dass ganz plötzlich, wenn es nur gelinge, das „infantile Trauma“ herauszufinden, die große Wandlung mit ihm vorgehen werde. Oder er richtet sich auf Zeiträume von mehreren Jahren ein und hat nach fünf Jahren erfolgloser Analyse das Gefühl, man habe eben nur noch nicht lange genug analysiert, um etwas ändern zu können. Wir finden auch in der analytischen Situation die verdeckende und überkompensierende Geschäftigkeit wieder. Solche Analysanden sind äußerst pünktlich, lesen alle erreichbare Literatur, machen bei allen ihren Freunden Propaganda für die Analyse, treffen dieses oder jenes Arrangement im Leben, weil das „gut für die Analyse sei“, und alles dies, um vor sich selbst zu verbergen, dass sie in den fundamentalen Fragen ihrer Persönlichkeit nichts zu ändern bereit beziehungsweise imstande sind. Eng verknüpft hiermit ist ein Verhalten im Sinne der „magischen Geste“. Analysanden, bei denen das eine große Rolle spielt, sind besonders darauf bedacht, „alles richtig zu machen“. Sie fügen sich den Anordnungen des Analytikers aufs Genaueste, und je mehr Regeln und Vorschriften er macht, desto zufriedener sind sie. Sie haben das Gefühl, dass, wenn sie nur das analytische Ritual getreu befolgen, diese Folgsamkeit in magischer Weise die Veränderung ihrer Persönlichkeit bewirken werde.
Es mag an dieser Stelle ein kleiner Exkurs über ein Problem der analytischen Technik gestattet sein. Wenn unsere eingangs geäußerte Annahme richtig ist, dass das Ohnmachtsgefühl, wenn auch in gemilderter Form, bei sehr vielen Menschen unserer Kultur vorhanden ist, dann ist es nur natürlich, wenn es sich bei einer Reihe von Psychoanalytikern selbst findet. In solchen Fällen ist es nicht nur der Patient, der im Grunde davon überzeugt ist, dass er sich nicht ändern kann, sondern der Analytiker ist der gleichen, wenn auch ganz unbewussten Überzeugung, dass man keinen Menschen beeinflussen könne. Hinter seinem bewussten beruflichen Optimismus steckt ein tiefer Unglaube an die Möglichkeit irgendwelchen verändernden Einflusses auf Menschen. Er scheut sich geradezu einzugestehen, dass die analytische Therapie eine Beeinflussung des Menschen sei. Gewiss sollte sie keine Beeinflussung in dem Sinne sein, ihn zu bestimmten Anschauungen oder Handlungen zu veranlassen. Aber man vergisst, dass alles Heilen, wie auch alles Erziehen, immer eine Beeinflussung [I-200] voraussetzt, und dass, wo es in phobischer Weise vermieden wird, auch mit Notwendigkeit der Erfolg ausbleibt. Eine besondere Rolle spielt bei manchen Analytikern die Verdeckung des eigenen Ohnmachtsgefühls durch die magische Geste. Es scheint, als ob, ebenso wie für manche Patienten, auch für sie selbst die korrekte Durchführung des analytischen Rituals der Kernpunkt der ganzen Prozedur sei. Wenn sie nur getreulich allen Vorschriften von Freud gefolgt sind, meinen sie, alles getan zu haben, was möglich ist, und ihre wirkliche Ohnmacht, den Patienten zu beeinflussen, braucht ihnen nicht ins Bewusstsein zu kommen. Wir möchten annehmen, dass die absonderliche Wichtigkeit, die für Analytiker dieses Typs das analytische Zeremoniell hat, letzten Endes auf ihr eigenes Ohnmachtsgefühl zurückgeht. Das Zeremoniell wird zum magischen Ersatz für die faktische Beeinflussung des Patienten.
Für die Entstehung des Ohnmachtsgefühls trifft man auf dieselbe Schwierigkeit, die immer vorhanden ist, wenn man die Entstehungsbedingungen für einen seelischen Mechanismus angeben will. Es liegt niemals eine einfache Bedingung vor, die man als „Ursache“ des in Frage stehenden Mechanismus bezeichnen kann. Man muss vielmehr immer die gesamte Konstellation der äußeren Umstände, unter denen ein Mensch lebt, und die komplizierte Dynamik seiner Charakterstruktur, die sich als Reaktion auf die Außenwelt entfaltet, kennen, um die Entstehungsbedingungen des einzelnen seelischen Mechanismus voll zu verstehen. Der Versuch einer prinzipiellen Darstellung der Entstehungsbedingungen des Ohnmachtsgefühls, insbesondere einer Untersuchung der grundlegenden Rolle des Masochismus, würde weit über den Rahmen dieses Aufsatzes hinausgehen. Wir halten es auch ganz allgemein für methodologisch gerechtfertigt, einen unbewussten Mechanismus zu beschreiben und die verschiedenen Konsequenzen dieses Mechanismus im Sinne von Rationalisierungen, Reaktionsbildungen usf. zu untersuchen, ohne gleichzeitig auch alle diese unbewusste Tendenz bedingenden Faktoren zu analysieren. Soweit im Folgenden doch noch auf sie eingegangen wird, werden wir uns nur an diejenigen Umstände halten, die in unmittelbarer Weise das Ohnmachtsgefühl bedingen, beziehungsweise ein schon vorhandenes verstärken. Aber selbst mit dieser Einschränkung werden die Entstehungsbedingungen nur skizzenhaft und in Umrissen beschrieben.
Wir haben uns bei der Beschreibung des Ohnmachtsgefühls und der aus ihm stammenden Folgeerscheinungen vorwiegend an die neurotischen Erscheinungsformen gehalten, weil sie ein deutlicheres Bild des zu beschreibenden Phänomens geben als die „normalen“. Bei der Beschreibung der Entstehungsbedingungen ist es zweckmäßiger, uns an jene allgemein in der bürgerlichen Gesellschaft vorhandenen Bedingungen zu halten, deren Steigerung im Einzelfall zu den oben geschilderten neurotischen Erscheinungsformen des Ohnmachtsgefühls führt und deren durchschnittliches Auftreten wir als Bedingung für das normale Ohnmachtsgefühl im bürgerlichen Charakter vermuten dürfen.
Wir müssen erwarten, dass ein so tief liegendes und intensives Gefühl wie das der Ohnmacht nicht erst in späteren Lebensjahren entsteht, sondern dass Erlebnisse in der allerfrühesten Kindheit für seine Entstehung verantwortlich zu machen sind. Diese Erwartung wird rasch bestätigt, wenn man sich die Situation des Kindes in der bürgerlichen Familie unter den uns hier interessierenden Gesichtspunkten ansieht. [I-201] Das Verhalten des Erwachsenen zum Kind lässt sich dahin charakterisieren, dass das Kind im letzten Grunde nicht ernstgenommen wird. Dieser Tatbestand ist offenbar in den Fällen, in denen Kinder vernachlässigt und ausgesprochen schlecht behandelt werden. Hier haben die Eltern die ganz bewusste Meinung, dass das Kind nichts gilt, sie wollen seinen eigenen Willen und seine eigene Persönlichkeit unterdrücken, das Kind ist für sie ein willenloses Instrument ihrer Willkür, und es darf in keiner Weise etwas zu bestellen haben. In extremen Fällen trägt es ihm schon Strafe ein, wenn es auch nur wagt, einen Wunsch zu äußern; aber dass es selbst etwas anordnen, die Eltern in ihren Entschlüssen beeinflussen, selbständig irgendetwas erreichen könnte, liegt ganz außerhalb auch nur der Denkmöglichkeiten in dieser Konstellation. Schwerer durchschaubar, aber nicht weniger folgenschwer ist jenes Nichternstnehmen des Kindes, das sich hinter Verzärtelung und Verwöhnung versteckt. Solche Kinder werden gewiss beschützt und behütet, aber die Entfaltung ihrer eigenen Kräfte beziehungsweise des Gefühls dafür, selbst Kräfte zu haben, wird mehr oder weniger vollständig gelähmt. Sie erhalten alles, was sie brauchen, im Überfluss, sie dürfen sich auch alles wünschen, dürfen alles sagen, was sie wollen. Ihre Situation gleicht aber im Grunde der eines gefangenen Prinzen. Auch dieser hat alle Genüsse im Überfluss und viele Diener, denen er Befehle geben kann. Und doch ist alles unwirklich und gespensterhaft, denn seine Befehle haben nur Geltung, solange sie nicht den Rahmen seines Gefängnisses sprengen. Alle seine Macht ist eine Illusion, die er dann am besten aufrechterhalten kann, wenn er gar nicht mehr daran denkt, ein Gefangener zu sein, und gar nicht mehr wünscht, die Freiheit zu gewinnen. Er kann zwar seinen Untergebenen, befehlen, dass sie ihn aufs pünktlichste bedienen; wollte er ihnen aber gebieten, sie sollten das Tor des Schlosses öffnen, in dem er gefangen ist, so würden sie sich verhalten, als habe er überhaupt nichts gesagt. Ob nun so extreme Fälle der Verwöhnung oder der durchschnittliche Fall des „liebevoll“ behandelten Kindes vorliegen, macht nur einen Unterschied im Grad des Nichternstnehmens aus. Allen Fällen gemeinsam ist, dass das Kind aus eigenem Recht nichts anordnen, nichts vollbringen, nichts beeinflussen, nichts verändern kann. Es kann viel von dem, was es will, bekommen, wenn es lieb und brav ist, aber es kann nichts bekommen, was ihm nicht gegeben wird, und es kann nichts erreichen, ohne dass der Erwachsene sich einschaltet.
Dieses Nichternstnehmen drückt sich gewöhnlich keineswegs in dramatischen und auf den ersten Blick auffallenden Formen aus. Man muss nach sehr subtilen Eigenheiten des Verhaltens der Erwachsenen suchen, um den hier gemeinten Einfluss zu verstehen. Das leichte und kaum wahrnehmbare Lächeln, wenn das Kind etwas Selbständiges sagt oder tut, kann eine ebenso niederschmetternde Wirkung haben wie die gröbsten Versuche, seinen Willen zu brechen. Ja, häufig ist es so, dass, wo sich die Eltern feindselig zeigen, das Kind gleichfalls eine Opposition entwickelt, die ihm erlaubt, sich von den Eltern zu lösen und ein selbständiges Leben zu beginnen, während die Freundlichkeit der Eltern das Kind an der Entfaltung jeder prinzipiellen Opposition hindert und es nur umso hilfloser und ohnmächtiger macht. Man findet nicht selten in Analysen, dass sich Menschen daran erinnern, welche ohnmächtige Wut sie als Kinder hatten, wenn sie über die notwendige Zeit hinaus in die Schule begleitet wurden, beim Anziehen geholfen bekamen, wenn sie nicht mitbestimmen durften, [I-202]welche Art Kleider sie tragen wollten, wann es Zeit war, sich wärmer oder leichter anzuziehen. Noch in einer Reihe von anderen typischen Verhaltensweisen kommt das Nichternstnehmen des Kindes zum Ausdruck. Versprechen, die dem Kind gegeben werden, werden nicht gehalten, bestimmte Fragen nicht ernstgenommen oder unaufrichtig beantwortet. Anordnungen werden gegeben, ohne dass dem Kind ihr Grund gesagt wird. Dies alles kann in der freundlichsten Weise geschehen, dem Kind bleibt aber das Gefühl, dass man nicht mit ihm rechnet und dass man sich im Grunde alles gegen es erlauben kann. Selbst da, wo Versprechen gehalten und Antworten gegeben werden, aber wo der Erwachsene das Gefühl hat, sein Verhalten stelle eine besondere Freundlichkeit oder ein besonderes Entgegenkommen dar, ist der Eindruck auf das Kind kein anderer. Es fühlt sich nur dann ernstgenommen, wenn der Erwachsene sich ihm gegenüber ebenso verpflichtet fühlt, aufrichtig und zuverlässig zu sein, wie er das anderen Erwachsenen gegenüber ist, die er respektiert. Als ein Symbol für die hier gemeinte Situation des Kindes hat uns immer ein bestimmtes Spielzeug beeindruckt, nämlich ein Spieltelefon. Es sieht aus wie ein richtiges Telefon, das Kind kann den Hörer abnehmen und die Nummern wählen, nur verbindet es mit niemandem. Das Kind kann niemanden erreichen, und obwohl es genau dasselbe tut wie der telefonierende Erwachsene, bleibt seine Handlung ohne jede Wirkung und ohne jeden Einfluss. (In der modernen pädagogischen Theorie und Praxis sind Ansätze vorhanden, durch eine Reihe von Maßnahmen dem Kind das Gefühl des Ernstgenommenwerdens zu verschaffen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wollen wir hier nicht diskutieren.)
Wenn auch extreme Fälle des Nichternstnehmens des Kindes auf individuelle Umstände zurückzuführen sind, so hat doch die geschilderte Haltung ihre Wurzel in der gesamten gesellschaftlichen und der durch sie bestimmten seelischen Konstellation. Der erste hier zu erwähnende Faktor ist die scharfe Trennung des Kindes von der Realität des Lebens, eine Trennung, die allerdings in geringerem Maße für das proletarische und das Bauernkind gilt. Das bürgerliche Kind wird ausgesprochen davor behütet, mit der Realität in Berührung zu kommen; seine Welt gewinnt damit notwendig einen illusionären, ja gespensterhaften Charakter. Das Kind wird gelehrt, die Tugenden von Bescheidenheit, Anspruchslosigkeit, Nächstenliebe zu entwickeln. Für die große Mehrzahl der Menschen ist es nötig, dass sie sich fügen können, dass sie ihre Ansprüche auf eigenes Glück reduzieren und bis zu einem gewissen Grade tatsächlich jene Tugenden verkörpern. Für die kleine Gruppe derjenigen, aus denen die tüchtigen Geschäftsleute und alle anderen Arten von Erfolgreichen erwachsen, dürfen diese Regeln jedoch nicht gelten. Sie müssen anspruchsvoll und rücksichtslos sein, wenn sie Erfolg haben wollen. Aber das Geheimnis, das zum Erreichen dieses Erfolgs nötig ist – alles das, was den Kindern gepredigt wird zu vergessen –, entdecken die Söhne der „Elite“ schon zur rechten Zeit. Der großen Masse darf diese Entdeckung nicht gelingen. Die meisten bleiben daher ihr Leben lang verwirrt und verstehen gar nicht, was eigentlich im gesellschaftlichen Leben vor sich geht. Bei vielen führt der Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Erfolg und dem Wunsch nach Erfüllung der ihnen in der Kindheit gelehrten Ideale zu neurotischen Erkrankungen. Für das Verhalten der Erwachsenen zum Kind ist das regelmäßige Resultat, dass es gar nicht [I-203]ernstgenommen werden kann, weil es ja noch dumm ist, das heißt, von den Spielregeln des Lebens, in dem die Erwachsenen stehen, nichts weiß.
Das Kind wird nicht ernstgenommen, ebenso wenig wie die Kranken und Alten – trotz aller entgegengesetzten Ideologien. In der bürgerlichen Gesellschaft beruht der Wert des Menschen auf seiner ökonomischen Leistungsfähigkeit. Das Maß an Respekt, das ihm entgegengebracht wird, hängt von dem Ausmaß seiner ökonomischen Kapazität ab. Menschen, die ökonomisch keine Potenz darstellen, sind letzten Endes auch menschlich unbeachtlich. Wenn man das Verhalten zu alten Menschen oder im Umgang mit Kranken in Hospitälern etwas näher beobachtet, dann entdeckt man die gleiche Skala in den Verhaltensweisen wieder, die auch dem Kind gegenüber vorhanden sind. Von brutaler Nichtachtung bis zur überfreundlichen Hilfsbereitschaft finden sich alle Gefühlsskalen.
Das Nichternstnehmen des Kindes wird mit seiner biologischen Hilflosigkeit begründet. Gewiss ist das Kind relativ lange hilflos und auf die Erwachsenen angewiesen. Diese Hilflosigkeit erweckt aber in Erwachsenen nur zum Teil die Tendenz der Ritterlichkeit oder der Mütterlichkeit, zum anderen Teil vielmehr Tendenzen, das Kind eben wegen dieser Hilflosigkeit bewusst oder unbewusst zu verachten und zu demütigen. Diese Tendenzen, die man im weiteren Sinne als sadistische bezeichnen kann, sind ihrerseits in der Rolle des Erwachsenen im gesellschaftlichen Prozess begründet. Wenn er Mächten ausgeliefert ist, denen gegenüber er keinerlei Kontrolle hat, so entwickelt sich die Tendenz als Kompensation dieser Ohnmacht, sich stark und überlegen gegenüber denen zu empfinden, die schwächer sind als er. In der großen Mehrzahl der Fälle ist der Sadismus als solcher ganz unbewusst und äußert sich nur in der Tendenz, die biologische Hilflosigkeit des Kindes überzubetonen, und in jenem Nichternstnehmen des Kindes, von dem die Rede ist.
Die Bedingungen für das Ohnmachtsgefühl des Kindes finden ihre Wiederholung auf höherer Ebene im Leben des Erwachsenen. Gewiss fehlt hier das Moment des ausgesprochenen Nichternstnehmens. Im Gegenteil, dem Erwachsenen wird gesagt, er könne alles erreichen, was er wolle, wenn er es nur wirklich wolle und sich anstrenge, und er sei ebenso für seinen Erfolg wie für das Misslingen selbst verantwortlich. Das Leben wird ihm als ein großes Spiel hingestellt, in dem in erster Linie nicht der Zufall, sondern eigenes Geschick, eigener Fleiß und eigene Energie entscheiden. Diesen Ideologien stehen die faktischen Verhältnisse schroff gegenüber. Der durchschnittliche Erwachsene unserer Gesellschaft ist tatsächlich ungeheuer ohnmächtig, und diese Ohnmacht wirkt noch umso drückender, als er ja glauben gemacht wird, es müsste eigentlich ganz anders sein und es sei sein Verschulden, wenn er so schwach sei. Er hat gar keine Macht, sein eigenes Schicksal zu bestimmen. Schon welche Fähigkeiten er entwickeln kann, ist ihm vom Zufall der Geburt vorgeschrieben; ob er überhaupt Arbeit bekommen, welchen Beruf er wählen kann, wird im wesentlichen von Faktoren bestimmt, die von seinem Willen und seiner Anstrengung unabhängig sind. Selbst in der Freiheit der Wahl seines Liebespartners ist er durch enge ökonomische und soziale Grenzen eingeschränkt. Gefühle, Meinungen, Geschmack werden ihm eingehämmert, und jede Abweichung bezahlt er mit verstärkter Isolierung. Die Statistik kann ihm zeigen, ein wie kleiner Prozentsatz von denen, die mit der Illusion beginnen, [I-204] die Welt stehe ihnen offen, auch nur eine gewisse Unabhängigkeit und ökonomische Sicherheit erreichen. Massenarbeitslosigkeit und Kriegsgefahr haben – wenigstens in Europa – die faktische Ohnmacht des Einzelnen in den letzten Jahren noch vermehrt. Er muss für jeden Tag dankbar sein, an dem er noch Arbeit hat und der ihn noch von dem Grauen eines neuen Krieges trennt. Bei der Gestaltung der ökonomischen und politischen Verhältnisse ist er völlig ohnmächtig. In autoritären Staaten ist Einflusslosigkeit zum bewussten Prinzip erhoben. Aber auch in Demokratien besteht eine außerordentliche Diskrepanz zwischen der ideologischen Vorstellung, das einzelne Mitglied der Gesellschaft bestimme als Teil des Ganzen dessen Schicksal, und der Distanz, die in Wirklichkeit den Einzelnen von den Zentren der politischen und ökonomischen Macht trennt.
Der Umstand, dass der bürgerliche Mensch über die sein Verhalten bestimmenden seelischen Antriebe nicht Bescheid weiß, findet seine Entsprechung darin, dass er die die wirtschaftliche Entwicklung bestimmenden Kräfte in der durch den Markt regulierten Wirtschaft nicht kennt und sie ihm als undurchschaubare Schicksalsmächte erscheinen. In der gegenwärtigen Gesellschaft bedarf es zum Unterschied von anderen Wirtschaftsformen einer besonderen Wissenschaft der politischen Ökonomie, um zu verstehen, wie sie funktioniert. Entsprechend bedarf es der Psychoanalyse, um das Funktionieren der individuellen Persönlichkeit, das heißt, um sich selbst zu verstehen. Das Ohnmachtsgefühl wird durch den Umstand außerordentlich verstärkt, dass sowohl die komplizierten Vorgänge ökonomischer und politischer Art als auch die seelischen Vorgänge undurchsichtig sind. Auch wenn er zu wissen glaubt, was vorgeht, so ändert diese Illusion doch nichts daran, dass ihm die Orientierung über die in der Gesellschaft und in ihm selbst wirkenden fundamentalen Kräfte nahezu völlig fehlt. Er sieht hundert Einzelheiten, hält sich an die eine oder andere und versucht, von einer aus das Ganze zu verstehen, um nur immer wieder von neuen Einzelheiten überrascht und verwirrt zu werden. Da die erste Bedingung zum aktiven Handeln und Beeinflussen des eigenen Schicksals wie des der Gesellschaft die richtige Einsicht in die entscheidenden Kräfte und Konstellationen ist, haben die Unkenntnis und der Mangel an Einsicht die Folge, das Individuum ohnmächtig zu machen, und diese Ohnmacht wird auch innerlich von ihm registriert, selbst wenn es sich mit allen möglichen Illusionen verzweifelt dagegen wehrt, sie zu registrieren. Das Nichtverfügen über eine richtige gesellschaftliche und, soweit das Individuum in Frage kommt, psychologische Theorie ist eine wichtige Quelle für das Ohnmachtsgefühl. Theorie ist die Bedingung für das Handeln. Aber die Existenz der Theorie, und selbst der leichte Zugang zu ihr, befähigt die Menschen noch nicht ohne weiteres zum aktiven Handeln. Die europäische Situation stellt gerade sehr eindrucksvoll dar, wie fatalistisch die Menschen sich mit ihrem Schicksal abfinden, obwohl Millionen von ihnen eine im Prinzip richtige Theorie der gesellschaftlichen Vorgänge besitzen. Der gleiche Vorgang zeigt sich auch immer wieder, wenn die theoretische Kenntnis der psychologischen Vorgänge Menschen so wenig hilft, sie zu ändern. Für Menschen, in denen das Ohnmachtsgefühl vorhanden ist, hat die Theorie im Grunde kein vitales Interesse. Da sie nicht erwarten, etwas ändern zu können, ist auch die Einsicht, die beschreibt, wie man etwas ändern könnte, blass und unwichtig. Selbst wenn man sie hat, [I-205] bleibt sie eine abstrakte Kenntnis, ein Bildungsgut wie Geschichtsdaten oder Gedichte, die man in der Schule gelernt hat, oder – Weltanschauung.
Man kann in der psychischen Einstellung der breiten Massen und ihrer Führer, speziell der im letzten Krieg unterlegenen Länder, beinahe eine zeitliche Abfolge der oben geschilderten Kompensationsmechanismen entdecken. Die ersten Jahre nach dem Friedensschluss waren durch eine außerordentliche politische und soziale Aktivität charakterisiert. Man schuf neue Verfassungen, neue Symbole, neue Gesetze. Vor allem die leitenden Politiker gaben den Eindruck äußerster Aktivität. Sie erklärten, dass sie es seien, die praktisch arbeiteten, die nicht träumten, sondern die Realität veränderten, die endlich „zupackten“. Es geschah viel, doch nichts, was an die Fundamente rührte, und infolgedessen nichts, was auch nur den Beginn zu wirklichen Veränderungen darstellte. Das „Zupacken“ und der Eifer der Führer (soweit er überhaupt ehrlich und nicht bloß Vorwand und Trick war), auch bis zu einem gewissen Grade die Aktivität der Massen, erwies sich als leere Geschäftigkeit, hinter der sich der Mangel an echter Aktivität und das Gefühl der Ohnmacht mit Bezug auf wirkliche Veränderungen versteckte. Die Resultatlosigkeit der Bemühungen führte bald zum „Glauben an die Zeit“. Man hatte das Gefühl, die Erfolglosigkeit der Anstrengungen sei daraus zu erklären, dass die Zeit zu kurz sei, um Erfolge zu erwarten, und man tröstete sich damit, dass große Veränderungen schon vor sich gingen, wenn man nur Geduld habe und nichts überstürze. Geduld wurde zum Fetisch und Ungeduld zum schweren Vorwurf. Allmählich musste man aber einsehen, dass die Entwicklung in der gewünschten Richtung nicht nur ausblieb, sondern dass die entgegengesetzte erfolgte. Was im ersten Ansturm erreicht worden war, verschwand langsam und sicher. Man musste schon die Einsicht in das, was real vorging, verdrängen, um am Glauben an die Zeit festhalten zu können. Dann trat an seine Stelle mehr und mehr der Glaube an das Wunder. Man verzweifelte daran, dass menschliche Anstrengung überhaupt etwas ändern könne, und erwartete alles von „begnadeten“ Führern und von „irgendeinem Wechsel“ in den Verhältnissen. Man verzichtete darauf, zu wissen, was man ändern wollte und wie man es ändern könnte, und glaubte, dass irgendein Umschwung, auch wenn man ihn seinem Inhalt nach gar nicht bejahte, besser sei als gar nichts und zum mindesten die Möglichkeit in sich berge, das zu vollbringen, woran die eigene Anstrengung gescheitert war. Diese Hoffnung auf einen Umschwung, wie immer er auch geartet sei, war der Nährboden für das Wachstum der zum Siege des autoritären Staates führenden Ideologien.
Die hier skizzierte zeitliche Abfolge ist gewiss keine strenge und bezieht sich nur auf den Akzent, den die verschiedenen Formen der kompensierenden Mechanismen jeweils hatten. Bis zu einem gewissen Grad fanden sich immer alle Mechanismen auch gleichzeitig vor. Der Glaube an die Zeit ist schon in der ersten Phase nach dem Zusammenbruch zu beobachten[7], und viele, vor allem die geschlagenen Führer, haben [I-206] ihn auch nach dem Sieg der autoritären Ideologie nicht aufgegeben. Andererseits war der Glaube an das Wunder schon von Anfang an vorhanden, allerdings im wesentlichen bei einer bestimmten sozialen Schicht, dem Kleinbürgertum. Auf Grund einer Reihe von Umständen, vor allem der zunehmenden ökonomischen Entmachtung des Kleinbürgertums, war das Ohnmachtsgefühl in dieser Schicht am stärksten. In den ersten Jahren nach dem Krieg erwartete man das Wunder von der Rückkehr der Monarchie und von den alten Flaggen, nachher von „Führern“ und „einer“ Umwälzung. Gewiss herrschte in bestimmten Teilen der Bevölkerung echte Aktivität und weder Wunderglaube noch Zeitglaube. Dies gilt sowohl für die fortgeschrittensten Teile der Arbeiterschaft als auch, in einem anderen und beschränkteren Sinne, für die mächtigsten und, im ökonomischen Sinne, fortgeschrittensten Teile des Unternehmertums, wenn auch die Ziele entgegengesetzt waren.
Wenn man die Nachkriegsperiode durch ein Anwachsen des Ohnmachtsgefühls charakterisiert, erhebt sich ein neuer Einwand. Haben nicht die Vertreter der autoritären Ideologien ein großes Maß an Aktivität und Machtgefühl bewiesen, haben sie nicht mit Zähigkeit und Energie die politischen und menschlichen Verhältnisse umgestaltet? Oberflächlich gesehen scheint dieser Einwand zwingend zu sein und zum Schluss zu führen, dass die Klassen und Individuen, welche die Träger der siegreichen Bewegungen waren, also vor allem das Kleinbürgertum, das ihnen innewohnende Ohnmachtsgefühl überwunden haben. Sieht man jedoch näher zu, so zeigt sich, dass die heute von ihnen entfaltete Aktivität sehr bedingt ist. Krieg, Leiden, Armut werden als gegebene und unabänderliche Faktoren des menschlichen Zusammenlebens angesehen und jeder Versuch, an diesen Fundamenten zu rütteln, als Dummheit oder Lüge betrachtet. Das Verhalten in Bezug auf die grundlegenden politischen und gesellschaftlichen Faktoren ist unlösbar verknüpft mit dem Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit. Diese Schicksalsmächte mögen realistisch als „Naturgesetz“ oder als „Zwang der Tatsachen“, philosophisch als die „Macht der völkischen Vergangenheit“, religiös als „Wille Gottes“ oder moralisch als „Pflicht“ rationalisiert sein, immer bleibt es eine höhere Gewalt außerhalb des Menschen, der gegenüber jede eigene Aktivität endet und nur blinde Unterwerfung möglich ist. Die Hilflosigkeit des Individuums ist das Grundthema der autoritären Philosophie.
Die Sozialphilosophie der „Willenstherapie“ Otto Ranks
(The Social Philosophy of „Will Therapy“)
(1939a)[8]
Die moderne Psychotherapie[9] hat sich als Zweig der Medizin entwickelt. Es wird allgemein angenommen, die Medizin sei – genau wie die anderen Naturwissenschaften – eine objektive Wissenschaft, das heißt, dass der weltanschauliche, gesellschaftliche oder politische Standpunkt des betreffenden Wissenschaftlers seine Ergebnisse oder seine Methode nicht beeinflusst. Diese – wie so viele – Annahmen stimmen jedoch nicht. Die Ziele und Methoden der Medizin werden teilweise von den besonderen Bedingungen der jeweiligen Gesellschaft beeinflusst. Dies möge ein einfaches Beispiel erläutern. Die Auffassung der Mediziner bezüglich der körperlichen oder seelischen Schäden, die durch eine Abtreibung hervorgerufen werden, unterscheiden sich wesentlich voneinander. In manchen Ländern herrscht die Meinung vor, dass eine Abtreibung höchst gefährlich sei, während man sie in anderen Ländern zu den einfacheren Operationen zählt. Keiner dieser beiden Standpunkte ist völlig falsch; sie repräsentieren nur beide eine unterschiedliche Einstellung zu dem Problem, und es ist nicht schwer, den Zusammenhang zu sehen, der zwischen verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Systemen und ihrer unterschiedlichen Einstellung zur Abtreibung besteht. Ein anderes Beispiel: Man könnte sich vorstellen, dass in einer Kultur Empfängnisverhütung als ein legitimes Mittel zur Geburtenkontrolle angesehen wird und weit bessere wissenschaftliche Methoden zur Empfängnisverhütung als in unserer Kultur entwickelt werden. Natürlich findet man derart unterschiedliche ärztliche Ansichten nur in Bezug auf außergewöhnliche Probleme. Die Behandlung eines Beinbruchs dürfte überall gleich sein ohne Rücksicht auf den gesellschaftlichen Hintergrund und die politischen Ansichten des Arztes.
Auf dem Gebiet der Psychotherapie dagegen ist es nicht mehr so, dass man der Weltanschauung nur geringe praktische Bedeutung beimessen kann. Auf diesem Gebiet hängen die Grundvorstellungen bezüglich des Zieles und der Methode von den religiösen, weltanschaulichen, politischen und gesellschaftlichen Auffassungen des Psychotherapeuten ab. Die Antworten auf Fragen wie, was ein Neurotiker ist, was das Ziel der psychotherapeutischen Behandlung ist und was überhaupt unter seelischer Gesundheit zu verstehen ist, hängen alle davon ab, was nach Überzeugung des Therapeuten für den Menschen „am besten“ ist. Sagt er einfach nur, der Patient solle [VIII-098] „gesund“ werden, so bedient er sich eines Wortes, das vielerlei bedeuten kann. Gesundheit als Ziel der Psychotherapie kann völlige Anpassung an die Regeln unserer Gesellschaft bedeuten, wie sie im Erfolg, in der Popularität und in der Fähigkeit zum Geldverdienen zum Ausdruck kommt. Oder sie kann bedeuten, dass der Neurotiker seine Spontaneität und seine innere Freiheit zurückgewinnen soll, die er verloren hat, aber um die er sich noch immer bemüht. Das bedeutet aber, dass der „Patient“ lernen sollte, zum Subjekt seiner eigenen Gefühle und Gedanken zu werden, dass er in die Lage versetzt werden sollte, das zu fühlen, was er wirklich fühlt, das zu denken, was er wirklich denkt, und das zu wollen, was er wirklich will, anstatt das zu fühlen, zu denken und zu wollen, wovon er annimmt, dass die anderen es von ihm erwarten. Es ist eine Sache der persönlichen Weltanschauung, ob man glaubt, dass das menschliche Glück im spontanen Ausdruck seiner selbst besteht und von innerer Freiheit und Aktivität untrennbar ist, oder ob man glaubt, Erfolg und Anpassung seien die Lebensziele, welche die Psychotherapie den Menschen wieder zugänglich machen solle, die in Gefahr stehen, sie nicht erreichen zu können. Ich möchte damit keineswegs sagen, dass eine mangelnde Anpassung an und für sich ein Ideal sei oder dass die Fähigkeit, sein wahres Selbst zu leben, die Möglichkeit ausschließe, ein sozial wohlgeordnetes Leben zu führen. In seltenen Fällen könnte es dabei zu einem unlösbaren Konflikt kommen, gewöhnlich aber wird ein Mensch, der er selbst und daher stärker wird, in der Lage sein, mindestens mit der Wirklichkeit fertig zu werden und ein würdiges, wenn auch vielleicht unkonventionelles Leben zu führen. Das folgende Beispiel zeigt einen nicht seltenen Fall, wo ein Konflikt zwischen Anpassung und Selbstverwirklichung besteht.
Wenn Ibsens Nora in ihrem Puppenheim einen Analytiker konsultiert hätte, so hätte dessen Meinung darüber, ob sie ihren Mann verlassen solle oder nicht, dessen Behandlungsweise beeinflusst. Hätte er die herkömmlichen Auffassungen über den Wert der Ehe geteilt, so hätte er die Gründe, weshalb sie ihren Mann verlassen will, als „neurotisch“ angesehen, und er hätte deshalb in erster Linie diese Gründe analysiert. Hätte er dagegen Ibsens Überzeugung geteilt, dass die Integrität und weitere Entwicklung ihrer Persönlichkeit davon abhänge, dass sie ihren tyrannischen und engherzigen Mann verlasse, dann hätte er seine Bemühungen darauf konzentriert, jene Ängste zu analysieren, die sie veranlassen könnten, sich mit einer unerträglichen Situation abzufinden.
Ein weiteres wichtiges Problem ist die Einstellung des Analytikers zu seinem Patienten. Er kann sich ihm gegenüber distanziert, autoritär und überlegen verhalten, oder er kann ihm warm und freundlich gegenübertreten. Diese Einstellung bestimmt seine Technik – die Art, wie der Analytiker den Patienten beeinflusst. Die Einstellung des Analytikers zu seinem Patienten ist eine Funktion seiner Persönlichkeit; sie hängt ab von der Art seines Denkens, von seiner Weltanschauung.
Gewöhnlich sind sich die Menschen nicht bewusst, dass sie eine bestimmte Philosophie haben. Psychoanalytiker nehmen gern an, ihr Verfahren sei „wissenschaftlich“, es handle sich dabei um eine Technik, die sich rein objektiv entwickelt habe und die sie dann unabhängig von persönlichen Meinungen und Werturteilen verfolgten. Man kann zum Beispiel feststellen, dass das, was man in der Freudschen Terminologie als [VIII-099] „böse“ zu bezeichnen pflegte, heute „neurotisch“, „irrational“ oder „infantil“ heißt, oder dass das, was früher einfach „schlecht“ war, jetzt oft als „regressiv“ oder ähnlich bezeichnet wird. Diese veränderte Terminologie wäre an sich nicht von besonderer Bedeutung, wenn sie nicht dem Patienten die analytische Arbeit stark erschwerte; wenn er „schlecht“ genannt wird, weiß er wenigstens, was los ist, und kann sich wehren, während er ziemlich hilflos ist, wenn man ihm mit wissenschaftlichen Begriffen kommt. Er hat dann das Gefühl, sie als etwas hinnehmen zu müssen, was ein Wissenschaftler sich ausgedacht hat, der soviel klüger ist als er.
Wenn auch der Hauptzweck dieser Abhandlung die Diskussion der Sozialphilosophie ist, die Ranks „Willenstherapie“ zugrunde liegt[10], so möchte ich doch zunächst Freuds Sozialphilosophie analysieren, um einerseits die allgemeine Tatsache zu veranschaulichen, dass ein psychologisches System in bestimmten weltanschaulichen Voraussetzungen wurzelt, und um andererseits Ranks Weltanschauung im Gegensatz zu der Freuds klarer herausstellen zu können.
Die wichtigste weltanschauliche Prämisse Freuds ist sein Glaube an die Macht der Vernunft. Seine Methode gründet sich auf die Auffassung, dass man Menschen dadurch heilen kann, dass man sie die Wahrheit über sich selbst erkennen lässt. Er versucht den Patienten über dessen Illusionen aufzuklären, um ihn fähig zu machen zu erkennen, welches in Wahrheit seine Probleme sind. Er tut dies in der Hoffnung, auf diese Weise eine Charakterstruktur ändern und überwinden zu können, die jene Illusionen erforderlich machte.
Der Glaube, dass die Wahrheit eine heilsame Wirkung hat, dass die Wahrheit die Dinge ändert und dass die Wahrheit den Menschen glücklich macht, ist eine alte Überzeugung. Das Prinzip des ursprünglichen Buddhismus lautet, dass Wissen zwar nicht glücklich macht, dass es aber das Leiden auslöscht, was das Höchste ist, was der Mensch nach buddhistischer Überzeugung erreichen kann. Sokrates und andere griechische Philosophen glaubten, wenn man die Wahrheit erkenne, werde man ein guter Mensch, und gut sein bedeute nicht nur tugendhaft, sondern auch glücklich zu sein.
In der Neuzeit waren es besonders die deutschen und französischen Philosophen der Aufklärung, die die Macht der Vernunft in den Mittelpunkt ihrer Lehre stellten. Sie waren der Überzeugung, dass man mit Hilfe der Wahrheit zu einer besseren Welt gelangen könne.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121415
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Ödipuskomplex Beiträge Humanismus