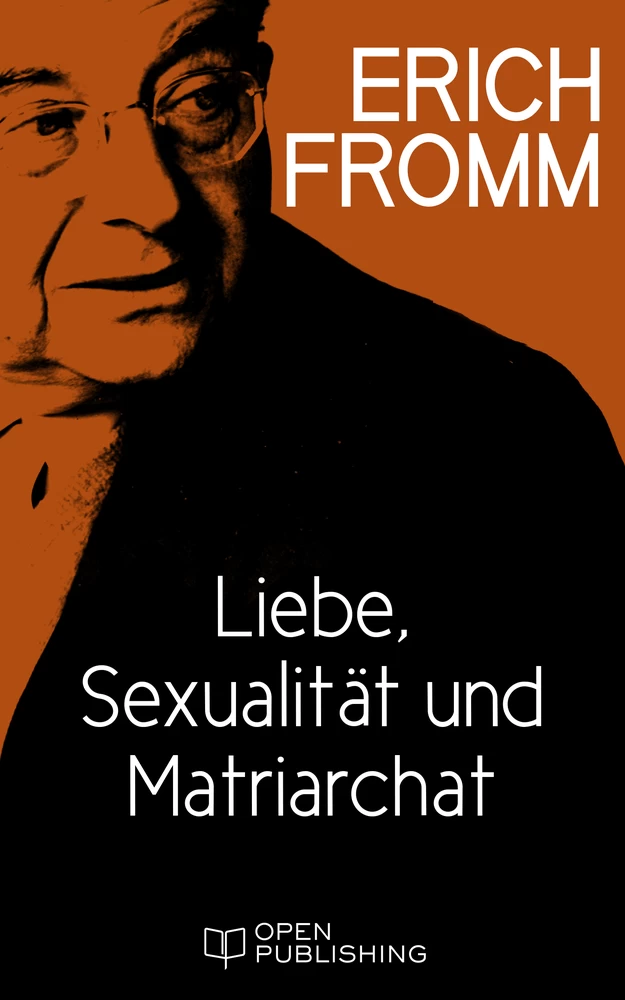Zusammenfassung
Fromm interessiert nicht so sehr die Tatsache des anatomischen und biologischen Unterschieds der Geschlechter, auch nicht die überlebenswichtige Funktion der Sexualität, sondern vielmehr die Funktionalisierung der Genderfrage im Laufe der Menschheitsgeschichte. Die sexuelle Anziehungskraft des jeweils anderen Geschlechts hat dabei offensichtlich nur eine sehr begrenzte Bedeutung und konnte den Menschen nicht daran hindern, den Geschlechtsunterschied zur Ausübung von Herrschaft zu benutzen.
Den Sozialpsychologen Fromm interessiert dabei vor allem die Frage, wie sich die gesellschaftlich geprägte Genderfrage in der psychischen Strukturbildung (Charakter) widerspiegelt und wie sie die Liebesfähigkeit und die Funktion der Sexualität beeinflusst. Über all dies gibt dieser Sammelband umfassend Auskunft.
Aus dem Inhalt
- Bachofens Entdeckung des Mutterrechts
- Die sozialpsychologische Bedeutung der Mutterrechtstheorie
- Die männliche Schöpfung
- Robert Briffaults Werk über das Mutterrecht
- Die Bedeutung der Mutterrechtstheorie für die Gegenwart
- Geschlecht und Charakter
- Mann und Frau
- Sexualität und Charakter. Psychoanalytische Bemerkungen zum Kinsey-Report
- Selbstsucht und Selbstliebe
- Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Liebe, Sexualität und Matriarchat. Beiträge zur Geschlechterfrage
- Inhalt
- Vorwort von Rainer Funk
- Mutterrecht und männliche Schöpfung
- Bachofens Entdeckung des Mutterrechts
- Die sozialpsychologische Bedeutung der Mutterrechtstheorie
- I
- II
- III
- IV
- Die männliche Schöpfung
- Robert Briffaults Werk über das Mutterrecht
- Die Bedeutung der Mutterrechtstheorie für die Gegenwart
- Geschlechtsunterschiede und Charakter
- Geschlecht und Charakter
- Mann und Frau
- Geschlecht und Sexualität
- Sexualität und Charakter. Psychoanalytische Bemerkungen zum Kinsey-Report
- Gesellschafts-Charakter und Liebe
- Selbstsucht und Selbstliebe
- Selbstsucht und Nächstenliebe
- Die Entsprechung von Selbst- und Objektbezug
- Hass und Selbsthass
- Liebe als leidenschaftliche Bejahung
- Selbstliebe und Selbstsucht
- Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben
- Literaturverzeichnis
Mann und Frau
(Man – Woman)
(1951b)[52]
Die Beziehung zwischen Mann und Frau[53] ist offensichtlich ein äußerst schwieriges Problem, sonst würden nicht so viele Menschen mit ihr Schwierigkeiten haben. Ich will deshalb zunächst einige Fragen stellen, die diese Beziehung betreffen. Wenn ich meine Leser durch diese Fragen zu eigenem Nachdenken veranlassen kann, können sie vielleicht aus eigener Erfahrung einige Antworten beisteuern.
Die erste Frage, die ich stellen möchte, lautet: Ist nicht im Thema selbst bereits ein Trugschluss enthalten? Es scheint zu implizieren, dass die Schwierigkeiten in den Beziehungen zwischen Mann und Frau ihrem Wesen nach durch den Geschlechtsunterschied bedingt sind. Das trifft aber nicht zu. Bei der Beziehung zwischen Mann und Frau – zwischen Männern und Frauen – handelt es sich im wesentlichen um eine Beziehung zwischen Menschen. Alles, was in der Beziehung zwischen einem menschlichen Wesen und einem anderen gut ist, ist auch gut in der Beziehung zwischen Mann und Frau, und alles, was in menschlichen Beziehungen schlecht ist, ist auch schlecht in der Beziehung zwischen Mann und Frau.
Die besonderen Mängel in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen sind zum größten Teil nicht ihren männlichen oder weiblichen Charaktermerkmalen zuzuschreiben, sondern ihren zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ich werde gleich noch auf dieses Problem zurückkommen, doch möchte ich zuvor noch eine weitere Qualifizierung des Gesamtthemas vornehmen. Bei der Beziehung zwischen Männern und Frauen handelt es sich um eine Beziehung zwischen einer siegreichen und einer besiegten Gruppe. Das mag im Jahre 1949 in den Vereinigten Staaten sonderbar und merkwürdig klingen; aber wir müssen die Geschichte der Beziehung zwischen Männern und Frauen in den vergangenen fünftausend Jahren berücksichtigen, wenn wir verstehen wollen, wie die Geschichte die heutige Situation und die heutige Einstellung der Geschlechter zueinander und das, was sie voneinander wissen und füreinander fühlen, noch immer beeinflusst. Nur dann können wir an die Frage herangehen, in welcher spezifischen Weise sich Männer und Frauen voneinander unterscheiden, was für die Beziehung zwischen Männern und Frauen kennzeichnend ist, was ein Problem sui generis ist und nicht ein Problem der menschlichen Beziehungen. [VIII-388]
Beginnen wir mit dieser zweiten Frage und definieren wir die Beziehung zwischen Männern und Frauen als die Beziehung zwischen einer siegreichen und einer besiegten Gruppe. Ich sagte bereits, dass dies heutzutage in den Vereinigten Staaten merkwürdig klingt, weil dort – besonders in den großen Städten – die Frauen offensichtlich nicht wie eine besiegte Gruppe wirken, sich auch nicht so fühlen und benehmen.
Es ist viel darüber diskutiert worden – und zwar nicht ohne Grund –, wer nun in unserer gegenwärtigen städtischen Kultur das stärkere Geschlecht sei. Ich halte das Problem jedoch keineswegs für gelöst, wenn man einfach feststellt, die Frauen Amerikas hätten ihre Emanzipation erreicht und stünden daher mit den Männern auf gleicher Stufe. Meiner Ansicht nach spürt man den vieltausendjährigen Kampf noch an der besonderen Art der Beziehung zwischen Männern und Frauen in unserer heutigen Kultur.
Es gibt einige gute Beweise für die Annahme, dass die patriarchalische Gesellschaft, wie sie in China und Indien und in Europa und Amerika während der vergangenen fünf- bis sechstausend Jahre bestanden hat, nicht die einzige Form ist, in der die beiden Geschlechter ihr Leben organisiert haben. Vieles spricht dafür, dass – wenn nicht überall, dann doch vielerorts – den von Männern beherrschten patriarchalischen Gesellschaften matriarchalische vorausgingen. Diese waren dadurch gekennzeichnet, dass die Frauen und Mütter der Mittelpunkt der Familie und der Gesellschaft waren.
Die Frau nahm im Gesellschafts- und Familiensystem die beherrschende Stellung ein. Man findet in den verschiedenen Religionen noch heute Spuren ihrer Vorherrschaft. Spuren der alten Organisation finden sich sogar noch in einem Dokument, mit dem wir alle vertraut sind: im Alten Testament.
Wenn man versucht, die Geschichte von Adam und Eva mit einiger Objektivität zu lesen, dann findet man, dass gegen Eva und indirekt gegen Adam ein Fluch ausgesprochen wird; denn andere zu beherrschen, ist nicht viel besser, als von ihnen beherrscht zu werden. Als Strafe für Evas Sünde soll der Mann über sie herrschen, während sie nach ihm verlangt. (Vgl. Gen 3,17.)
Wenn die Herrschaft der Männer über die Frauen als ein neues Prinzip aufgestellt wird, dann muss es zuvor eine Zeit gegeben haben, wo das nicht so war, und wir besitzen tatsächlich Dokumente, aus denen dies hervorgeht. Wenn wir den babylonischen Schöpfungsbericht mit der biblischen Geschichte vergleichen, so finden wir, dass in dieser babylonischen Geschichte, die der biblischen zeitlich vorangeht, die Situation eine völlig andere ist. Im Mittelpunkt des babylonischen Berichts finden wir keinen männlichen Gott, sondern Tiamat, eine weibliche Gottheit. Ihre Söhne versuchen gegen sie aufzubegehren und besiegen sie schließlich, worauf sie die Herrschaft männlicher Gottheiten unter der Führung des großen babylonischen Gottes Marduk errichten.[54]
Marduk muss in einer Prüfung seine Macht beweisen, dass er in der Lage ist, den Kampf gegen die weibliche Gottheit zu gewinnen. Er muss vorführen, dass er kraft seines Wortes ein Kleid zerstören und wiedererschaffen kann. Vielleicht kommt uns dieser Test etwas töricht vor, doch berührt er etwas Wesentliches. Die Frauen waren in einer matriarchalischen Gesellschaft den Männern in einer Hinsicht deutlich überlegen: Sie konnten Kinder zur Welt bringen, was die Männer nicht konnten. Der [VIII-389] Versuch der Männer, die Frauen zu entthronen, stand im Zusammenhang mit ihrem Anspruch, ebenfalls Dinge schaffen und zerstören zu können – nicht auf natürliche Weise, wie die Frauen, sondern durch das Wort und den Geist.
Die biblische Schöpfungsgeschichte beginnt dort, wo die babylonische Geschichte endet. Gott schafft die Welt mit seinem Wort, und um die Überlegenheit der patriarchalischen über die matriarchalische Kultur nachdrücklich zu betonen, berichtet uns die biblische Geschichte, Eva sei aus einem Mann und nicht der Mann aus einer Frau geboren.
Die patriarchalische Kultur – die Kultur, in der Männer dazu bestimmt scheinen, über Frauen zu herrschen, das stärkere Geschlecht zu sein – hat sich auf der ganzen Welt erhalten. Tatsächlich finden wir heute nur in kleinen primitiven Völkerschaften gewisse Überreste der älteren matriarchalischen Form. Erst in jüngster Zeit beginnt die Herrschaft des Mannes über die Frau zusammenzubrechen.
In einer patriarchalischen Gesellschaft existieren alle typischen Ideologien und Vorurteile, wie sie stets die herrschende Gruppe denen gegenüber entwickelt, die sie beherrscht: etwa dass die Frauen von ihren Gefühlen beherrscht würden und eitel seien, dass sie wie Kinder, keine guten Organisatoren, nicht so stark wie die Männer seien, dafür aber reizend.
Und dennoch widersprechen diese in den patriarchalischen Gesellschaften entwickelten Ideen vom Wesen der Frau ganz offensichtlich der Wirklichkeit. Woher kommt eigentlich die Idee, Frauen seien eitler als Männer? Ich glaube, dass jeder, der ein wenig genauer hinsieht, vor allem von den Männern sagen kann, dass sie eitel sind. Tatsächlich gibt es kaum etwas, bei dem nicht ihre Eitelkeit, anderen imponieren zu können, eine Rolle spielt.
Frauen sind weit weniger eitel als Männer. Freilich sind sie bisweilen gezwungen, eine gewisse Eitelkeit zur Schau zu tragen, weil sie sich als sogenanntes schwächeres Geschlecht die Gunst der Männer erringen müssen oder mussten. Das Märchen, dass die Frauen eitler seien als die Männer, lässt sich aber bei unvoreingenommener Betrachtung nicht aufrechterhalten.
Nehmen wir ein anderes Vorurteil: Angeblich sollen Männer härter sein als Frauen. Jede Krankenschwester wird bestätigen, dass weit mehr Männer als Frauen bei einer Injektion oder Blutentnahme ohnmächtig werden, dass Frauen weit besser Schmerzen ertragen können, während sich die Männer wie kleine Kinder benehmen, die zu ihrer Mutter laufen wollen. Dennoch ist es den Männern im Laufe der Jahrhunderte – oder besser der Jahrtausende – gelungen, die Meinung zu verbreiten, sie seien das stärkere und härtere Geschlecht.
Daran ist weiter nichts Erstaunliches. Es ist eine jener Ideologien, die für jene Gruppe von Menschen typisch ist, die ihr Recht zur Herrschaft beweisen muss. Wenn man nicht die Mehrheit bildet, sondern fast genau die Hälfte der Menschheit ausmacht und jahrtausendelang behauptet hat, man habe das Recht, über die andere Hälfte zu herrschen, dann muss man sich einleuchtende Ideologien ausdenken, um die anderen – und sich selbst – von diesem Anspruch zu überzeugen.
Im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert wurde dann das Problem der Gleichberechtigung von Männern und Frauen tatsächlich akut. Während dieser Zeit [VIII-390] entwickelte sich ein sehr interessantes Phänomen, dass nämlich diejenigen, die behaupteten, die Frauen sollten die gleichen Rechte wie die Männer bekommen, zugleich behaupteten, es bestehe psychologisch kein Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern. Die Franzosen formulierten das so, dass die Seele geschlechtslos sei und dass es daher überhaupt keine psychologischen Unterschiede gebe. Diejenigen, die gegen die politische und gesellschaftliche Gleichstellung der Frauen waren, betonten mit oft sehr gescheiten und spitzfindigen Argumenten, wie stark sich Frauen psychologisch von Männern unterschieden. Natürlich schlossen sie daraus immer wieder, dass Frauen aufgrund dieser psychologischen Unterschiede weit besser daran wären und ihrer Bestimmung besser gerecht werden könnten, wenn sie nicht als Gleichberechtigte am sozialen und politischen Leben teilnähmen.
Wir finden bis zum heutigen Tag bei vielen Feministen, Progressiven und Liberalen und allen Gruppen, die für die Gleichberechtigung aller Menschen im Allgemeinen und der beiden Geschlechter im Besonderen sind, die Ansicht, dass keine Unterschiede bestünden, oder dass sie belanglos seien. Sie sagen, wenn je irgendwelche Unterschiede existierten, so seien diese auf die kulturelle Umgebung und die Erziehung zurückzuführen, aber wesensmäßige psychische Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern, die nicht die Folge von Umwelt- oder Erziehungsfaktoren seien, gebe es nicht.
Dieser bei den Verfechtern der Gleichberechtigung von Männern und Frauen so beliebte Standpunkt stimmt in vieler Hinsicht nicht. Er argumentiert, wie wenn man sagen wollte, es gebe keine psychologischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Volksgruppen, und dass jeder, der das Wort „Rasse“ auch nur in den Mund nimmt, etwas Entsetzliches sage. Wenn auch das Wort „Rasse“ als wissenschaftlicher Begriff vielleicht nicht gut gewählt ist, trifft es doch zu, dass es zwischen den Angehörigen verschiedener Völker in der Tat Unterschiede etwa im Körperbau und Temperament gibt.
Der zweite Grund, weshalb ich diese Art zu argumentieren für unangebracht halte, ist der, dass sie falsche Prinzipien suggeriert. Sie unterstellt die Idee, Gleichheit impliziere, dass ein jeder genauso ist wie jeder andere, dass Gleichheit Identität voraussetze. Tatsächlich aber implizieren Gleichheit und die Forderung nach Gleichberechtigung genau das Gegenteil: dass trotz aller Unterschiede kein Mensch von einem anderen als Werkzeug für seine Zwecke benutzt werden soll, dass jedes menschliche Wesen Selbstzweck ist. Das heißt aber, dass ein jeder die Freiheit haben sollte, seine besondere Individualität als Angehöriger seines Geschlechts und seines speziellen Volkes zu entwickeln. Gleichheit impliziert nicht die Leugnung von Unterschieden, sondern die Möglichkeit zu deren vollster Verwirklichung.
Wenn wir unter Gleichheit verstehen, dass es keine Unterschiede zwischen den Menschen gibt, dann leisten wir eben jenen Tendenzen Vorschub, die zu einer Verarmung unserer Kultur führen – das heißt zur „Automatisierung“ des Einzelnen und zur Schwächung dessen, was der wertvollste Bestandteil der menschlichen Existenz ist: die Entfaltung und Entwicklung der Besonderheiten eines jeden Menschen.
Wenn ich hier von Besonderheiten spreche, möchte ich daran erinnern, welch merkwürdiges Schicksal dieses Wort gehabt hat. Wenn wir heute von jemandem sagen, [VIII-391] er sei „sonderbar“, so meinen wir damit nichts besonders Vorteilhaftes. Und dennoch sollte es das größte Kompliment sein, wenn man von jemandem sagt, er sei „etwas Besonderes“. Denn eigentlich sollte man darunter doch verstehen, dass er nicht klein beigegeben hat, dass er sich den wertvollsten Teil der menschlichen Existenz, seine Individualität, bewahrt hat, dass er eine einzigartige Persönlichkeit ist, die sich von einem jeden anderen unter der Sonne unterscheidet.
Die irrtümliche Annahme, Gleichheit sei gleichbedeutend mit Identität, ist einer der Gründe für eine spezielle Erscheinung in unserer Kultur: dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern immer kleiner werden, dass sie vertuscht und hinwegargumentiert werden. Frauen versuchen sich wie Männer zu benehmen, und gelegentlich auch Männer wie Frauen, und die Polarität zwischen männlich und weiblich, zwischen Mann und Frau, verschwindet langsam.
Ich glaube, die einzige Lösung für dieses Problem ist – allgemein gesprochen – darin zu suchen, dass man auf eine gewisse Polarität in der Beziehung zwischen den Geschlechtern hinarbeitet. Man würde ja auch vom positiven und negativen Pol eines elektrischen Stromkreises nicht behaupten, dass der eine weniger wert sei als der andere. Man würde vielmehr sagen, dass das Potenzial zwischen ihnen durch ihre Polarität erzeugt wird und dass eben diese Polarität die Basis produktiver Kräfte ist.
Im gleichen Sinn sind die beiden Geschlechter und das, was sie symbolisieren – das männliche und das weibliche Prinzip in der Welt, im Universum und in jedem von uns –, zwei Pole, die ihren Unterschied, ihre Polarität behalten müssen, um die fruchtbare Dynamik, die produktive Kraft zu erzeugen, die eben dieser Polarität entspringt.
Ich komme jetzt auf die zweite Prämisse zu sprechen: Die Beziehung zwischen Männern und Frauen ist nie besser als die Beziehung zwischen Menschen in einer bestimmten Gesellschaft, aber auch nie schlechter. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen die Beziehungen zwischen Männern und Frauen am meisten durch das, was ich in Psychoanalyse und Ethik (1947a, GA II, S. 47-56) „Marketing-Orientierung“ genannt habe. In Wirklichkeit sind wir alle schrecklich allein, obwohl wir – oberflächlich gesehen – so gesellig sind und mit so vielen Leuten „Kontakt“ haben.
Der Durchschnittsmensch ist heute schrecklich allein und fühlt sich auch so. Er kommt sich vor, eine Ware zu sein und hat das Gefühl, sein Wert hänge von seinem Erfolg, von seiner Verkäuflichkeit und von der Anerkennung durch andere ab. Er merkt, dass sein Wert weder auf dem inneren oder auf dem Gebrauchswert seiner Persönlichkeit beruht, noch auf seiner Kraft oder Liebesfähigkeit und seinen menschlichen Qualitäten, es sei denn, er kann sie verkaufen oder hat mit ihnen Erfolg und andere anerkennen ihn. Das ist es, was ich mit „Marketing-Orientierung“ meine.
Aus diesem Grunde ist die Selbstachtung der meisten Menschen heute sehr leicht zu erschüttern. Sie haben kein Selbstwertgefühl aus der Überzeugung: „Das bin ich, das ist meine Liebesfähigkeit und meine Fähigkeit zu denken und zu fühlen“; vielmehr fühlen sie sich nur wertvoll, wenn sie von anderen anerkannt werden, wenn sie sich verkaufen können, wenn andere sagen: „Du bist ein wunderbarer Mann“ oder „Du bist eine wunderbare Frau“. [VIII-392]
Ein Selbstwertgefühl, das von anderen abhängig ist, wird immer unsicher sein. Jeder Tag bringt eine neue Bewährungsprobe, und jeden Tag muss man sich selbst und andere davon überzeugen, dass man in Ordnung ist.
Man kann die Situation fast mit der einer Handtasche vergleichen, die auf dem Ladentisch zum Verkauf ausliegt: Jene Handtasche, von deren Art im Laufe eines Tages viele verkauft wurden, könnte am Abend stolz auf sich sein, während eine andere, deren Art nicht mehr ganz der Mode entspricht oder die etwas zu teuer ist oder aus sonst einem Grund nicht so gut verkauft wurde, sich deprimiert fühlen würde. Die eine Handtasche könnte sich sagen: „Ich bin wunderbar“; die andere müsste sich eingestehen: „Ich bin nichts wert“, obwohl die „wunderbare“ Handtasche nicht schöner, brauchbarer oder von besserer Qualität sein muss als die andere. Die nicht-verkaufte Handtasche müsste das Gefühl haben, dass man sie nicht haben will. Der Vergleich zeigt, dass der Wert einer Handtasche von ihrem Erfolg abhängt, also davon, wie viel Käufer aus irgendeinem Grund die eine der anderen vorziehen.
Übertragen wir den Vergleich nochmals auf den Menschen, dann bedeutet das, dass keiner von uns etwas Besonderes sein darf, dass wir unsere Persönlichkeit immer für Veränderungen bereithalten müssen, um uns dem neuesten Stand anzupassen. Deshalb fühlen sich Eltern ihren Kindern gegenüber oft verlegen: Die Kinder wissen weit besser, was gerade „in“ ist. Doch die Eltern sind durchaus bereit, sich belehren zu lassen und zu lernen. Genau wie ihre Kinder hören sie auf die letzten Preisnotierungen auf dem Personalmarkt. Die neuesten Marktnotierungen finden sie in den Kinos, auf den Alkohol- und Modereklamen, in den Angaben darüber, was very important persons (VIP) tragen und sagen.
Was gerade modern ist, ist schon nach kurzer Zeit wieder unmodern. Eben las ich im „Sunday Times Magazine“ von einem vierzehnjährigen Mädchen, das sich darüber beklagte, dass seine Mutter so altmodisch sei und immer noch glaube, wir lebten im Jahre 1945, also vor vier[55] Jahren. Zuerst verstand ich die Klage überhaupt nicht und dachte an einen Druckfehler, bis ich begriff, dass 1945 für dieses Mädchen schon erschreckend lange her war. Ich bin sicher, dass sich die Mutter die Klage zu Herzen nahm und sich auf die Wünsche des Kindes einstellte.
In welcher Weise beeinflusst diese „Marketing-Orientierung“ die Beziehung zwischen den Geschlechtern – zwischen Männern und Frauen? Ich glaube, dass ein großer Teil von dem, was unter der Bezeichnung Liebe läuft, dieses Suchen nach Erfolg und Anerkennung ist. Man braucht jemanden, der einem nicht nur um vier Uhr nachmittags, sondern auch um acht, um zehn und um zwölf Uhr sagt: „Du bist prima, du bist in Ordnung, du machst es richtig.“ Das ist ein Gesichtspunkt. Der andere ist der, dass man seinen Wert auch damit beweist, dass man sich den richtigen Partner auswählt. Man muss selbst das neueste Modell sein, denn dann hat man auch das Recht und die Pflicht, sich in das neueste Modell zu verlieben. Man kann das so grob ausdrücken wie jener Achtzehnjährige, der gefragt wurde, was das Ziel seines Lebens sei. Er sagte, er wolle sich einen besseren Wagen kaufen – er wolle seinen Ford in einen Buick umtauschen –, damit ihm Mädchen von besserer Klasse zur Verfügung stünden. Dieser Junge war wenigstens aufrichtig. Er drückte etwas aus, was – wenn auch in etwas verfeinerter Form – in unserer Kultur großenteils die Partnerwahl bestimmt. [VIII-393]
Die Marketing-Orientierung hat noch eine andere Auswirkung auf die Beziehung zwischen den Geschlechtern. Hier ist alles auf bestimmte Vorbilder ausgerichtet, und wir sind eifrig bemüht, die letzte Mode mitzumachen und ihr entsprechend zu handeln. Aus diesem Grund ist die Rolle, die wir uns auserwählen – besonders unsere Geschlechterrolle – stark vorgeprägt, aber diese Vorbilder sind sich nicht alle gleich und entsprechen sich nicht immer. Häufig stehen sie miteinander in Konflikt. Der Mann soll im Geschäftsleben aggressiv und daheim zärtlich sein. Er soll nur seinem Beruf leben, aber wenn er abends heimkommt, soll er nicht müde sein. Er soll den Kunden und der Konkurrenz gegenüber skrupellos sein, aber seiner Frau und seinen Kindern gegenüber soll er völlig aufrichtig sein. Er soll bei jedermann beliebt sein und dabei doch am meisten für seine Familie übrig haben.
Der moderne Mann versucht all dem gerecht zu werden, und allein die Tatsache, dass es ihm damit nicht allzu ernst ist, bewahrt ihn davor, verrückt zu werden. Das Gleiche gilt für die Frauen. Auch sie müssen gewissen Vorstellungen entsprechen, die sich ebenso wenig miteinander vertragen, wie das bei den Männern der Fall ist.
Natürlich hat es zu jeder Zeit und in jeder Kultur gewisse Idealvorstellungen davon gegeben, was „männlich“ und was „weiblich“ ist; aber früher besaßen diese Vorstellungen wenigstens eine gewisse Stabilität. In einer Kultur aber, wo soviel davon abhängt, dass wir dem neuesten Stand entsprechen, dass wir „in“ sind, dass alle mit uns einverstanden sind, dass wir uns genau so verhalten, wie man es von uns erwartet, bleiben die wirklichen Eigenschaften, die zu unserer männlichen oder weiblichen Rolle gehören, im Dunkeln. Die Beziehungen zwischen Mann und Frau haben nur noch wenig Spezifisches.
Wenn Männer und Frauen ihre Partnerwahl entsprechend der Marketing-Orientierung und entsprechend stark vorgeprägten Rollen treffen, ist es unvermeidlich, dass sie sich miteinander langweilen. Meiner Ansicht nach schenkt man dem Wort Langeweile[56] nicht die Aufmerksamkeit, die ihm zukommt. Wir reden von allen möglichen schrecklichen Dingen, die Menschen zustoßen, aber wir reden nur selten von einem der allerschrecklichsten Dinge: dass man sich mit sich allein und – was noch schlimmer ist – gemeinsam langweilt.
Viele sehen nur zwei Auswege aus dieser Langeweile. Sie vermeiden sie, indem sie eine der vielen Möglichkeiten nutzen, die ihnen unsere Kultur anbietet. Sie besuchen Parties, schließen neue Bekanntschaften, trinken, spielen Karten, hören Radio und betrügen sich so jeden Tag und jeden Abend selber. Oder aber – und das hängt teilweise davon ab, welcher Gesellschaftsklasse sie angehören – sie bilden sich ein, alles werde sich ändern, wenn sie ihren Partner wechseln. Sie denken, mit ihrer Ehe sei es schiefgegangen, weil sie an den falschen Partner geraten seien, und meinen, wenn sie den Partner wechselten, werde ihnen das die Langeweile vertreiben.
Sie sehen nicht, dass die wichtigste Frage nicht lautet: „Werde ich geliebt?“, was weitgehend gleichbedeutend ist mit Fragen wie „Werde ich auch anerkannt?“ – „Werde ich beschützt?“ – „Werde ich bewundert?“ –, sondern dass die Hauptfrage lautet: „Kann ich überhaupt lieben?“
Lieben ist in der Tat schwierig. Geliebt werden und sich verlieben ist eine Zeitlang sehr einfach, so lange bis man den anderen und sich selbst langweilt. Aber zu lieben [VIII-394] und sozusagen „in der Liebe zu verharren“, ist etwas Schwieriges – wenn es auch nichts Übermenschliches von uns verlangt, sondern in Wirklichkeit die wesentlichste menschliche Eigenschaft darstellt.
Wenn man nicht mit sich selbst allein sein kann, wenn man für andere und sich selbst kein echtes Interesse aufzubringen vermag, dann kann man auch mit einem anderen nicht zusammenleben, ohne sich nach einiger Zeit zu langweilen. Wenn die Beziehung zwischen den Geschlechtern zu einer Zuflucht vor der Einsamkeit und Isolation des Betreffenden wird, dann hat das nur wenig zu tun mit den Möglichkeiten, welche die wirkliche Beziehung zwischen Mann und Frau mit sich bringt.
Und noch einen weiteren Trugschluss möchte ich erwähnen. Ich meine den Irrtum, das wirkliche Problem zwischen den Geschlechtern sei die Sexualität. Vor 30 Jahren waren wir – oder doch viele von uns – noch sehr stolz darauf, als es in jener Zeit der sexuellen Emanzipation den Anschein hatte, dass man die Ketten der Vergangenheit gesprengt hätte und nun eine neue Phase menschlicher Beziehungen zwischen den Geschlechtern beginnen würde. Aber die Resultate waren keineswegs so wunderbar, wie viele erwarteten, weil nicht alles, was glitzert, Sexualität ist. Es gibt viele Motivationen für sexuelles Begehren, die nicht-sexuellen Ursprungs sind.
Eitelkeit ist einer der stärksten Antriebe für sexuelles Begehren; vielleicht ist sie sogar stärker als alles andere; aber auch Einsamkeit und das Aufbegehren gegen eine bestehende Beziehung können der Anreiz sein. Ein Mann, der sich getrieben fühlt, neue sexuelle Eroberungen zu machen, meint, er werde durch die sexuelle Anziehung, die Frauen auf ihn ausüben, dazu motiviert, während ihn in Wirklichkeit seine Eitelkeit antreibt: Er möchte beweisen, dass er allen anderen Männern überlegen ist.
Es gibt keine sexuelle Beziehung, die besser wäre als die menschliche Beziehung zwischen den beiden Partnern selbst. Die sexuelle Beziehung ist oft ein Abkürzungsweg, um sich näherzukommen, aber sie ist höchst trügerisch. Sexualität ist zwar ganz sicher ein wichtiger Bestandteil menschlicher Beziehungen, aber sie ist in unserer Kultur derart überbelastet mit allen möglichen anderen Funktionen, dass ich fürchte, dass das, was uns als großartige sexuelle Freiheit vorkommt, keineswegs ausschließlich eine Angelegenheit der Sexualität ist.
Wissen wir denn überhaupt etwas über die wirklichen Unterschiede zwischen Mann und Frau? Alles, was ich bisher dazu sagte, war negativ. Wer eine klare Feststellung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen erwartete, muss sich enttäuscht fühlen. Ich glaube nicht, dass wir sie kennen. Angesichts des bisher Festgestellten können wir gar nichts darüber wissen. Wenn die beiden Geschlechter Tausende von Jahren miteinander gekämpft haben, wenn sie Vorurteile gegeneinander entwickelt haben, die für derartige Kampfsituationen kennzeichnend sind, wie können wir dann zum gegenwärtigen Zeitpunkt wissen, welches die wirklichen Unterschiede sind?
Nur wenn wir nicht an die Unterschiede denken, wenn wir die Klischees vergessen, können wir ein Gefühl für jene Gleichheit entwickeln, bei der jeder Partner Selbstzweck ist. Nur dann können wir etwas über die Unterschiede zwischen Mann und Frau erfahren.
Auf einen Unterschied möchte ich besonders hinweisen. Meiner Meinung nach besitzt dieser Unterschied für den Erfolg einer Beziehung zwischen Mann und Frau eine [VIII-395] gewisse Bedeutung, und wir sollten ihn in unserer Kultur berücksichtigen. Ich habe den Eindruck, dass Frauen die Fähigkeit, zärtlich zu sein, in stärkerem Maße besitzen als Männer. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil Zärtlichkeit in der Beziehung der Mutter zu ihrem Kind etwas sehr Wichtiges ist.
Besonders in psychologischen Vorträgen wird heute betont, wie wichtig es sei, darauf zu achten, wann ein Kind gestillt wird, wann es von der Mutterbrust entwöhnt werden soll und wie man es an Sauberkeit gewöhnt. Man hält sich an diese Vorschriften und glaubt, auf diese Weise zu glücklichen Kindern zu kommen. Dabei wird vergessen, dass in Wirklichkeit nur eines wichtig ist: die Zärtlichkeit der Mutter zum Kind. Zur Zärtlichkeit gehört viel. Es gehört Liebe dazu, Achtung und wissendes Verstehen.[57] Zärtlichkeit ist etwas grundsätzlich anderes als etwa Sexualität, Hunger oder Durst. Psychologisch gesehen sind Triebe wie Sexualität, Hunger und Durst durch eine sich selbst steuernde Dynamik gekennzeichnet: Sie werden immer intensiver, bis sie ziemlich plötzlich einen Höhepunkt erreichen, wo sie befriedigt werden und der Betreffende für den Augenblick nichts weiter will.
Die Zärtlichkeit gehört zu einer anderen Art von Begehren und Trieb. Zärtlichkeit erfolgt nicht selbsttätig, sie hat kein Ziel, sie hat keinen Höhepunkt und ist nicht plötzlich zu Ende. Sie findet ihre Befriedigung im Akt selbst, in der Freude liebevoll und warm zu sein, den anderen wichtig zu nehmen, zu achten und ihn zu beglücken.
Ich habe den Eindruck, dass in unserer Kultur nur noch wenig Zärtlichkeit zu finden ist. Man denke nur an die Liebesgeschichten im Kino. Da werden alle leidenschaftlichen Küsse von der Zensur gestrichen, und trotzdem soll der Zuschauer sich vorstellen, wie wunderbar sie sind. Angeblich wird in den Filmen Leidenschaft geschildert. Für viele dürfte das nicht recht überzeugend sein; aber viele andere schließen daraus, was Liebe angeblich ist. Aber wie oft findet man in einem Film einmal wirkliche Zärtlichkeit zwischen den Geschlechtern oder zwischen Erwachsenen und Kindern oder zwischen menschlichen Wesen? Doch nur sehr selten. Ich behaupte nicht, dass wir nicht die Fähigkeit zur Zärtlichkeit besitzen, sondern nur, dass uns unsere Kultur den Mut zur Zärtlichkeit nimmt. Das liegt teilweise auch daran, dass unsere Kultur zweckorientiert ist. Alles hat seinen Zweck, alles zielt auf etwas Bestimmtes ab; man muss immer etwas erreichen.
Wir versuchen Zeit zu gewinnen – und dann wissen wir nicht, was wir mit der Zeit anfangen sollen und schlagen sie tot. Unser erster Impuls ist immer, etwas zu erreichen. Wir haben kaum noch ein Gefühl für den Lebensprozess selbst, ohne irgendetwas erreichen zu wollen. Wir tun uns schwer, nur zu leben, nur zu essen oder zu trinken oder zu schlafen oder zu denken oder etwas zu fühlen oder zu sehen. Sobald das Leben keinen Zweck verfolgt, sind wir unsicher: Wozu ist es dann da? Auch die Zärtlichkeit verfolgt keinen Zweck. Sie hat nicht den physiologischen Zweck, Entspannung oder eine plötzliche Befriedigung zu bewirken wie die Sexualität. Sie hat keinen anderen Zweck, als sich an dem warmen, lustvollen, fürsorglichen Gefühl für einen anderen Menschen zu freuen.
Deshalb scheuen wir die Zärtlichkeit. Die Menschen – besonders die Männer – fühlen sich unbehaglich, wenn sie Zärtlichkeit offen bekunden. Außerdem hindert eben der Versuch, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu leugnen, so dass Männer [VIII-396] und Frauen möglichst gleich sind, die Frauen daran, all die Zärtlichkeit zu zeigen, deren sie fähig sind und die etwas spezifisch Weibliches ist.
Hier komme ich wieder auf meinen Ausgangspunkt zurück, dass der Kampf zwischen den Geschlechtern noch nicht zu Ende sei. In Amerika haben die Frauen weitgehend ihre Gleichberechtigung errungen. Diese Gleichberechtigung ist noch nicht vollkommen, aber sie ist immerhin viel größer, als es früher der Fall war. Trotzdem müssen die Frauen diese Errungenschaft immer noch verteidigen. Sie suchen voller Eifer zu beweisen, dass sie deshalb ein Recht auf Gleichberechtigung haben, weil sie sich möglichst wenig von den Männern unterscheiden. Und deshalb unterdrücken sie ihre Impulse zur Zärtlichkeit. Die Folge ist, dass die Männer die Zärtlichkeit vermissen und dass sie das Gefühl haben, als Ersatz dafür müssten sie bewundert werden, damit ihr Selbstgefühl zu seinem Recht komme. So befinden sie sich in einem Zustand ständiger Abhängigkeit und Angst. Die Frauen ihrerseits fühlen sich frustriert, weil sie nicht in voller Freiheit die Rolle ihres eigenen Geschlechts spielen dürfen.
Abschließend möchte ich nochmals bezüglich des Unterschieds zwischen Mann und Frau betonen: Wer den Unterschied zwischen Mann und Frau erkennen möchte, sollte nicht darüber nachdenken und sich nicht den Kopf zerbrechen, ob er der typische Mann oder sie die typische Frau ist; vielmehr sollte man sich einfach gestatten, ein volles, spontanes Leben als menschliches Wesen zu führen. Nur wer sich nicht andauernd fragt: „Spiele ich auch die Rolle richtig und mit Erfolg?“ wird die tiefe Polarität zwischen den Geschlechtern und in jedem einzelnen Menschen selbst in ihrer vollen produktiven Kraft erfahren.
Fragen aus dem Publikum
Unterscheidet sich Ihre Vorstellung von der reinen Selbstlosigkeit der Zärtlichkeit von der Auffassung Freuds?
Es war nicht meine Absicht, die Zärtlichkeit als etwas Selbstloses[58] zu kennzeichnen. Ich halte Zärtlichkeit für eines der freudvollsten und das Selbst am meisten bestätigenden Erlebnisse, die man haben kann. Die meisten Menschen sind auch zur Zärtlichkeit fähig und haben beileibe nicht das Gefühl, dass Zärtlichkeit etwas mit Selbstlosigkeit oder Sich-Aufopfern zu tun habe. Nur für den, der nicht zärtlich sein kann, ist Zärtlichkeit ein Opfer.
Für eine zärtliche, liebevolle Mutter oder einen zärtlichen Menschen im allgemeinen ist Zärtlichkeit genauso befriedigend und beglückend wie die Befriedigung von Sexualität, Hunger oder einem anderen Trieb. Übrigens räumt Freud der Zärtlichkeit in seiner Doktrin nur sehr wenig Raum ein. Das ist verständlich, denn seine gesamte Arbeit konzentrierte sich so sehr auf eine andere Art von Trieben, dass für die Zärtlichkeit in seinem System kaum Platz war.
Was ist besser für die seelische Gesundheit der Bevölkerung: eine patriarchalische oder eine matriarchalische Gesellschaft?
Dieses ist natürlich eine müßige Frage, weil sich tatsächlich keiner dazu entschließt, [VIII-397] die Dinge so zu ändern, wie es für die seelische Gesundheit der Bevölkerung besser wäre. Es gibt Fragen, auf die es weit definitivere Antworten gibt als auf diese, zum Beispiel, ob es für das Wohlergehen der Bevölkerung besser wäre, wenn es keinen Krieg mehr gäbe. Hier lautet die Antwort entschieden ja, und dennoch macht es uns offenbar die größten Schwierigkeiten, dafür zu sorgen, dass das, wovon wir wissen, dass es zutrifft, auch durchgeführt wird.
Die Frage, ob ein matriarchalisches oder ein patriarchalisches System besser sei, ist schwer zu entscheiden. Tatsächlich halte ich die Frage in dieser Form für falsch gestellt. Man kann sagen, das matriarchalische System betont mehr die natürlichen Bindungen, die natürliche Gleichberechtigung und die Liebe, und das patriarchalische System legt – verglichen mit der alten matriarchalischen Kultur – größeren Wert auf die Zivilisation, das Denken, den Staat, auf Erfindungen, auf die Industrie und alles, was dem Fortschritt dient.
Meines Erachtens kann man die Frage nur so beantworten, dass es das Ziel der Menschheit sein muss, keinerlei Hierarchie zu haben, weder eine matriarchalische noch eine patriarchalische. Wir müssen eine Situation erreichen, in der die Geschlechter in ihrer Beziehung zueinander nicht den Versuch machen, sich zu beherrschen. Nur so können wir ihre wirklichen Unterschiede, ihre wirkliche Polarität entwickeln.
Es ist wichtig zu sehen, dass unser Kultursystem nicht die Erfüllung dieses Zieles darstellt, wenn es auch so scheinen möchte. Es ist das Ende der patriarchalischen Herrschaft, aber es ist noch kein System, in dem beide Geschlechter sich gleichberechtigt gegenüberstehen. Immer noch findet weitgehend ein Kampf zwischen ihnen statt. Ich bin überzeugt, dass es sich bei diesem Kampf bis zu einem gewissen Grade nicht um einen individuellen Kampf zwischen zwei Menschen handelt, sondern dass es immer noch um den uralten Kampf zwischen den Geschlechtern geht. Immer noch geht es um den Konflikt zwischen Mann und Frau, die beide voller Verwirrung nicht recht wissen, welches ihre jeweilige Rolle ist. Sollte er stark, sollte sie reich an Phantasie, sollte er gefügig sein und ihr nachlaufen, sollte sie dies und er jenes tun? Immer wieder stellen Männer und Frauen sich derartige Fragen. Sie zerbrechen sich den Kopf darüber, weil sie am Ende eines Kampfes stehen, der sich über sehr lange Zeiten hingezogen hat.
Ist es einfacher, eine Liebesbeziehung aufzulösen als sich zu verlieben? Wie kann ein Ehepaar dieses fast urvermeidliche Ende vermeiden?
Hinter der Frage verbirgt sich eine ziemlich pessimistische Ansicht, doch besitzen wir keine entsprechenden Statistiken, mit denen wir ihre Gültigkeit nachprüfen könnten. Wir haben Statistiken über alles mögliche, aber nicht über das menschliche Glück, nicht darüber, was sich in einer Ehe abspielt und wie glücklich oder unglücklich die Betreffenden sind. Tatsächlich existieren zwar auch einige Statistiken über das Glück, aber sie sind nicht besonders aufschlussreich, weil sie sich auf falsche Voraussetzungen gründen. Sie gründen sich auf eine Methode, bei der danach gefragt wird, was sich die Menschen über ihr Glück denken. Wenn man jemanden, der gern die richtige Antwort geben möchte, fragt: „Halten Sie sich für glücklich verheiratet?“, dann wird [VIII-398] er natürlich „ja“ sagen. Tatsächlich wird das sogar sein Gefühl sein. Fragt man jedoch jemanden, der weniger an Klischees gebunden ist, dann sagt er vielleicht: „Ich weiß nicht“ oder sogar „nein“. So bekommt man bei diesen Antworten nicht sosehr zu hören, ob die Befragten wirklich glücklich oder unglücklich sind, sondern man erfährt, wieweit sie noch an Klischees festhalten.
Auf den ersten Teil der Frage weiß ich keine Antwort. Ich würde meinen, dass es leicht ist, sich zu verlieben, und dass es traurig ist, wenn die Liebe zu Ende ist. Aber wenn ich die Frage richtig verstehe, so geht es hauptsächlich darum, wie es sich vermeiden lässt, dass man den anderen nicht mehr liebt. Wenn man in der Liebe oder in der Beziehung zwischen Mann und Frau eine Zuflucht vor einer unerträglichen Einsamkeit sucht, dann hegt man unrealistische Erwartungen, macht man den anderen für etwas verantwortlich, und erwartet man etwas von ihm, was wohl keiner geben kann. Wer nicht auf eigenen Füßen stehen kann, wer immerzu die Anerkennung anderer braucht und bevatert oder bemuttert werden muss, wer ständig bewundert werden möchte, der bekommt seine Erwartungen natürlich nur selten erfüllt. So kommt es dann zur Enttäuschung.
Ich glaube, die einzige Antwort auf die Frage, wie die Beziehungen zwischen Männern und Frauen zufriedenstellender gestaltet werden können, lautet, das Leben für beide Teile reicher zu machen. Wer ein interessanter Mensch sein will, muss selbst interessiert sein. Wer auf die Dauer anziehend sein will, muss fähig sein, zu lieben und den anderen gern zu haben. Eine andere Antwort auf diese Frage weiß ich nicht.
Ist nicht New York schuld an der Kommerzialisierung der Persönlichkeit durch seine Hochbewertung des Dollars?
Ich glaube, das stimmt so nicht. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine Entwicklung, die wir in den Industriegesellschaften der ganzen Welt antreffen. Es dürfte da zwischen den verschiedenen Ländern oder Teilen eines Landes keinen wesentlichen Unterschied geben. New York lässt als eine der typischen Großstädte des modernen Industriekapitalismus natürlich gewisse Tendenzen deutlicher erkennen als eine Kleinstadt.
Wie ist es den Männern gelungen, die matriarchalische Gesellschaft zu stürzen?
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959121286
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Dezember)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Sexualität Liebe