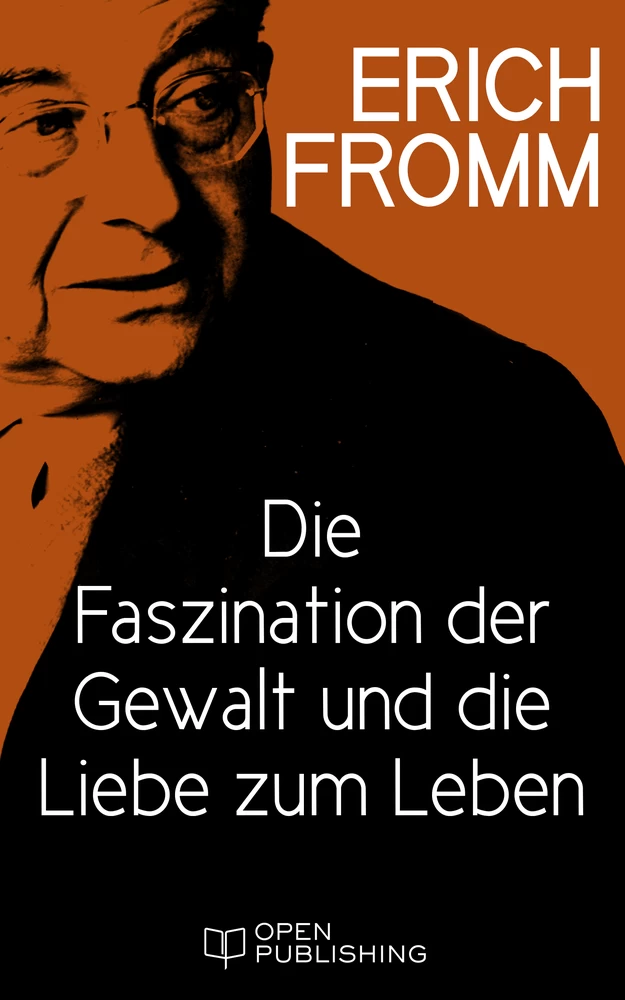Zusammenfassung
Der Beitrag ‚Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben‘ veranschaulicht diese Grundkräfte der „Biophilie“ und „Nekrophilie“ in einfachen Worten und mit anschaulichen Beispielen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben
- Literaturverzeichnis
- Impressum
- Der Herausgeber
- Der Autor
Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben
(Do We Still Love Life?)
Erich Fromm
(1967e)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk
Übersetzungen aus dem Amerikanischen von Rainer Funk.
Erstveröffentlichung unter dem Titel Do We Still Love Life?, in: McCalls, New York, Vol. 94 (August 1967), S. 57 und 108-110. In deutscher Übersetzung wurde der Beitrag erstmals 1994 unter dem Titel Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben publiziert in dem Sammelband Liebe, Sexualität, Matriarchat. Beiträge zur Geschlechterfrage beim Deutschen Taschenbuch Verlag in München, S. 211-224. In verbesserter Übersetzung fand der Beitrag Eingang in die Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, Band: XI, S. 339-348.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, GA XI, S. 177-187.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1994 by The Estate of Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2016 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2016 by Rainer Funk.
Lieben wir wirklich noch das Leben?[1] – Für manchen mag diese Frage verwirrend, wenn nicht gar unsinnig klingen. Lieben nicht alle Menschen das Leben? Ist diese Liebe zum Leben nicht der Beweggrund für alles, was wir tun? Könnten wir überhaupt am Leben bleiben, wenn wir nicht das Leben liebten und all die vielen Anstrengungen unternähmen, das Leben zu erhalten und seine Bedingungen zu verbessern? Vielleicht können jene, die so denken, und ich, der ich so frage, uns ohne große Schwierigkeiten gegenseitig verstehen, wenn wir es nur versuchen.
Mit anderen kann es schon schwieriger sein, zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Ich denke da vor allem an Menschen, die auf meine Frage mit einer gewissen Empörung reagieren. Entrüstet fragen sie, wie ich es nur wagen kann, daran zu zweifeln, dass wir das Leben lieben. Wurzeln nicht unsere gesamte Zivilisation, unsere Art zu leben, unsere religiösen Gefühle, unsere politischen Vorstellungen in dieser Liebe zum Leben? Rüttelt nicht der, der dies in Frage stellt, an den Fundamenten unserer Kultur? Es ist viel schwieriger, mit dem, der sich entrüstet, zu einem Einverständnis zu kommen, denn Entrüstung ist ihrem Wesen nach immer eine Mischung aus Ärger und Selbstgerechtigkeit, die jedes Verstehen erschwert. Ein Mensch, der sich ärgert, ist leichter mit vernünftigen und freundlichen Worten erreichbar als einer, der sich entrüstet. Dieser versucht nämlich seinen Ärger dadurch zu verdecken, dass er von seiner eigenen Rechtschaffenheit überzeugt ist. Vielleicht sind einige, die auf die Eingangsfrage mit Entrüstung reagieren, eher bereit, sich auf sie einzulassen, wenn sie spüren, dass ich mit dieser Frage niemanden angreife, sondern auf eine Gefahr hinweisen will, die nur dadurch überwunden werden kann, dass man sich ihr stellt.
Zweifellos könnten kein Mensch und keine Kultur ohne ein bestimmtes Minimum an Liebe zum Leben existieren. Wir beobachten, dass Menschen, die dieses Minimum an Lebensliebe verloren haben, verrückt werden, sich das Leben nehmen, zu hoffnungslosen Alkoholikern oder Drogenabhängigen werden. Wir kennen auch ganze Gesellschaften, die so bar jeder Liebe zum Leben und so voller Destruktivität wurden, dass sie zerfielen und untergingen beziehungsweise fast untergingen. Ein Beispiel sind die Azteken, deren Macht vor einer kleinen Gruppe von Spaniern wie Staub zerfiel. [XI-340] Oder man denke an das Nazi-Deutschland, das einem Massensuizid zum Opfer gefallen wäre, wenn es nach dem Willen Hitlers gegangen wäre. Wir in der westlichen Welt sind bisher noch nicht am Zerfallen, doch es gibt Anzeichen dafür, dass es dazu kommen kann.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959121293
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Januar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Liebe Hass Nekrophilie Biophilie