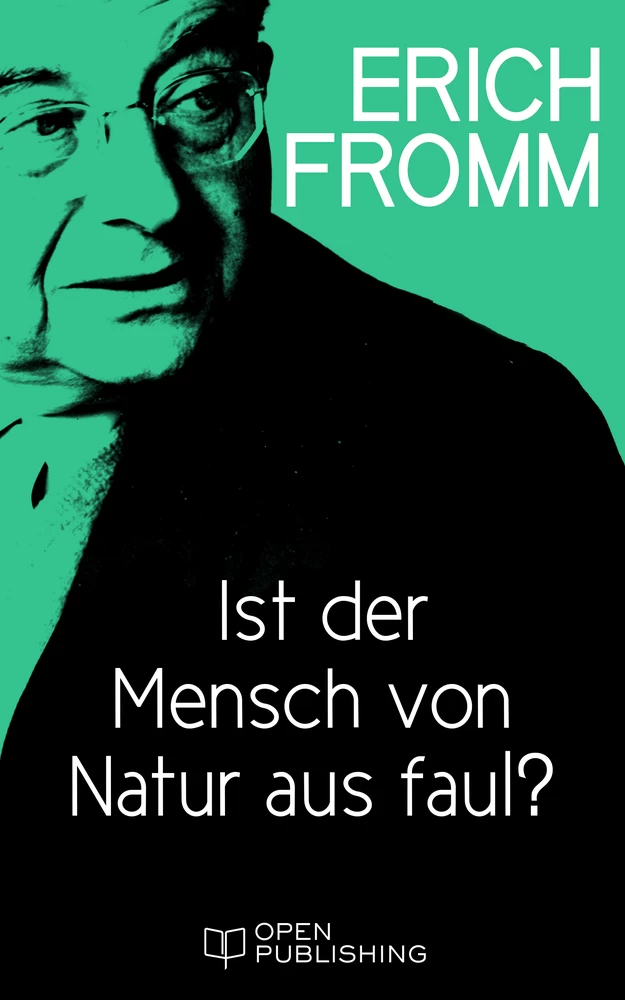Zusammenfassung
Die Frage, ob der Mensch von Natur aus faul ist, erweist sich bei näherem Hinsehen als höchst aktuell. Die heutige Entfremdung des Menschen von seinen eigenen motivationalen, kognitiven und emotionalen Antriebskräften führt dazu, dass der Mensch sich zunehmend passiv, leer, antriebslos und langweilig erlebt, sofern er nicht animiert und stimuliert wird. Ist der Mensch also von Natur aus faul? Oder ist diese „Faulheit“ eine gesellschaftlich erzeugte Pathologie, die als „normal“ erlebt wird, weil es heute den meisten Menschen so geht?
Erich Fromm sucht in dieser aus dem Jahr 1974 stammenden Abhandlung Hinweise in den verschiedensten Wissenschaftszweigen, vor allem aber in der Neurobiologie, zu finden, dass der Mensch prinzipiell die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit hat, aus der ein in ihm selbst wurzelndes aktives Interesse an der Wirklichkeit resultiert – das allerdings durch gesellschaftliche Einflüsse deaktiviert werden kann.
Aus dem Inhalt
• Das Axiom von der angeborenen Faulheit des Menschen
• Neurologische Erkenntnisse
• Erkenntnisse auf Grund von Tierversuchen
• Ergebnisse sozialpsychologischer Versuche
• Die kreative Kraft des Träumens
• Ergebnisse der Beobachtung von Säuglingen und Kleinkindern
Erich Fromm sucht in dieser aus dem Jahr 1974 stammenden Abhandlung Hinweise in den verschiedensten Wissenschaftszweigen, vor allem aber in der Neurobiologie, zu finden, dass der Mensch prinzipiell die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit hat, aus der ein in ihm selbst wurzelndes aktives Interesse an der Wirklichkeit resultiert – das allerdings durch gesellschaftliche Einflüsse deaktiviert werden kann.
Aus dem Inhalt
• Das Axiom von der angeborenen Faulheit des Menschen
• Neurologische Erkenntnisse
• Erkenntnisse auf Grund von Tierversuchen
• Ergebnisse sozialpsychologischer Versuche
• Die kreative Kraft des Träumens
• Ergebnisse der Beobachtung von Säuglingen und Kleinkindern
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Ist der Mensch von Natur aus faul?
- Inhalt
- 1. Das Axiom von der angeborenen Faulheit des Menschen
- a) Sozio-ökonomische Aspekte des Axioms
- b) Wissenschaftsimmanente Aspekte des Axioms
- c) Das heutige Selbstverständnis von Arbeit und das Axiom
- 2. Argumente gegen das Axiom
- a) Neurologische Erkenntnisse
- b) Erkenntnisse auf Grund von Tierversuchen
- c) Ergebnisse sozialpsychologischer Versuche
- d) Die kreative Kraft des Träumens
- e) Ergebnisse der Beobachtung von Säuglingen und Kleinkindern
- f) Psychologische Einsichten
- Literaturverzeichnis
- Impressum
- Der Herausgeber
- Der Autor
Der Herausgeber

Rainer Funk (geb. 1943) promovierte über die Sozialpsychologie und Ethik Erich Fromms und war von 1974 an Fromms letzter Assistent. Fromm vererbte dem praktizierenden Psychoanalytiker Funk seine Bibliothek und seinen wissenschaftlichen Nachlass. Diese sind jetzt im Erich Fromm Institut Tübingen untergebracht, siehe www.erich-fromm.de.
Darüber hinaus bestimmte er Funk testamentarisch zu seinem Rechteverwalter. 1980/1981 gab Funk eine zehnbändige, 1999 eine zwölfbändige „Erich Fromm Gesamtausgabe“ heraus. Die Texte dieser Gesamtausgabe liegen auch der von Funk mit editorischen Hinweisen versehenen „Edition Erich Fromm“ als E-Book zugrunde.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959121255
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (November)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Faulheit Träume Neurobiologie