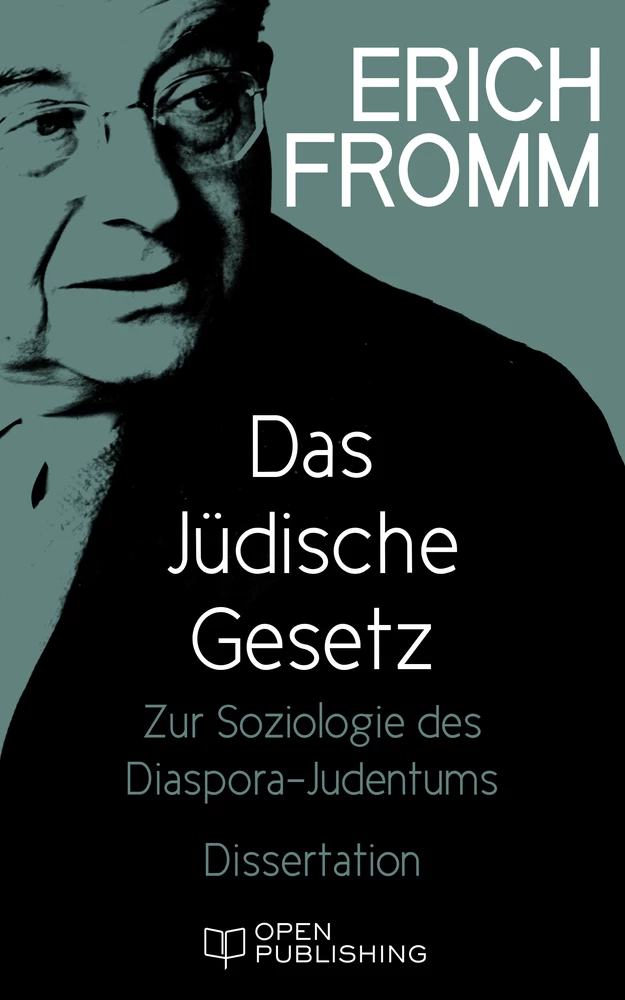Zusammenfassung
Im Kontext des Frankfurter Instituts für Sozialforschung hat Fromm zehn Jahre später diese Fragen mit seiner Gesellschafts-Charaktertheorie detailliert beantwortet; die Ursprünge seines sogenannten „Freudo-Marxismus“ lassen sich aber bereits in der Dissertation und in Fromms spezifisch jüdischem Denken ausmachen.
Fromms Dissertation "Das jüdische Gesetz" ist deshalb nicht nur für jene eine Pflichtlektüre, die in ihm einen Ideengeber für die Programmatik der Frankfurter Schule sehen; sie ist darüber hinaus auch eine Fundgrube für alle, die mehr über das Jüdische in Fromms Denken und Werk erfahren wollen.
Aus dem Inhalt
• Die Bedeutung des Gesetzes im Judentum
• Arbeit und Beruf im rabbinischen Judentum
• Die gesellschaftlich-religiöse Struktur des Karäismus
• Das Reformjudentum
• Das jüdische Gesetz und der bürgerlich-kapitalistische Geschichtskörper
• Die Neoorthodoxie als Reaktion auf die Reform
• Der Chassidismus
• Die Bedeutung des Gesetzes im Chassidismus
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Das Jüdische Gesetz. Zur Soziologie des Diaspora-Judentums. Dissertation
- Inhalt
- Vorwort von Rainer Funk
- 1. Die Bedeutung des Gesetzes im Judentum
- a) Das erkenntnisleitende Interesse und der Erkenntnisgegenstand der vorliegenden Arbeit
- b) Das jüdische Volk und sein Gesetz
- 1. Die Bedeutung des Religiösen im Judentum
- 2. Der religiöse Inhalt des Gesetzes
- 3. Der antidogmatische Charakter des Gesetzes
- c) Von der Form im allgemeinen und dem jüdischen Gesetz im besonderen
- Exkurs I: Arbeit und Beruf im rabbinischen Judentum
- a) Die Wirtschaftsethik des Puritanismus
- b) Zum Verhältnis von Berufsarbeit und Religionspraxis im rabbinischen Judentum
- c) Die rechtliche Stellung des Arbeiters im biblischen und rabbinischen Judentum
- Exkurs II: Der christliche Offenbarungsbegriff und das Verständnis der „Göttlichkeit“ der Thora im Judentum
- 2. Der Karäismus
- a) Der geschichtliche Kontext
- b) Die wirtschaftlichen Ursachen für die Entstehung des Karäismus
- 1. Die wirtschaftliche, politische und kulturelle Situation zum Zeitpunkt der Entstehung des Karäismus
- 2. Der wirtschaftliche Hintergrund der Entstehung der karäischen Sekte
- c) Die gesellschaftlich-religiöse Struktur des Karäismus
- d) Zusammenfassung: Zur Soziologie des Karäismus
- 3. Das Reformjudentum
- a) Die Emanzipation der Juden
- 1. Die Lage der Juden vor der Emanzipation
- 2. Die Emanzipation der Juden im Achtzehnten und Neunzehnten Jahrhundert
- b) Die Entwicklung der Reformbewegung
- 1. Das jüdische Gesetz und der bürgerlich-kapitalistische Geschichtskörper
- 2. Die Laien als Träger der Reform
- 3. Die Rabbiner und die Reform
- c) Die Entwicklung der Reformideologie
- 1. Die Reformideologie bei Moses Mendelssohn
- 2. Die Ideologie der Reformbewegung
- 3. Die Reformideologie im liberalen Judentum
- d) Die Stellung der Reform zum jüdischen Gesetz
- 1. Die Angleichungstendenzen der Reform
- 2. Die Unverbindlichkeit und Individualisierung des Gesetzes in der Reform
- 3. Die Prinzipienlosigkeit der Reform
- 4. Zusammenfassung: Soziologische Aspekte der Reform
- e) Die Neoorthodoxie als Reaktion auf die Reform
- 4. Der Chassidismus
- a) Gesellschaftsstruktur und Religiosität im Chassidismus
- 1. Die wirtschaftliche Situation der Juden zur Zeit der Entstehung des Chassidismus
- 2. Die gesellschaftliche Situation und die religiöse Ideenwelt des Chassidismus
- 3. Vom Niedergang des Chassidismus
- b) Die traditionalistische Wirtschaftsgesinnung des Chassidismus
- 1. Die Betonung der Kontemplation
- 2. Die antikapitalistische Tendenz
- 3. Die Ablehnung bürgerlicher Emanzipationsbestrebungen
- c) Die Bedeutung des Gesetzes im Chassidismus
- 1. Die neuen religiösen Inhalte und Ideen
- 2. Die Stellung des Chassidismus zur Verbindlichkeit des Gesetzes
- 3. Schneur Salman: Der Versuch einer Synthese von Chassidismus und Rabbinismus
- Zusammenfassung
- Glossar
- Literaturverzeichnis
- Impressum
- Der Herausgeber
- Der Autor
Vorwort von Rainer Funk
Die Doktorarbeit Erich Fromms entstand zwischen 1920 und 1922 bei dem Soziologen Alfred Weber an der Badischen Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, wurde aber erst posthum im Jahre 1989 als Band 2 der nachgelassenen Schriften veröffentlicht.[1]
Warum Fromm sein Studium in Heidelberg mit einer soziologischen Dissertation abschloss, hat verschiedene Gründe.[2] Der Wunsch, über die soziologische Funktion des jüdischen Gesetzes im Diasporajudentum zu schreiben, ergab sich zum einen aus der persönlichen Problematik des zu dieser Zeit noch ganz nach den Vorschriften der jüdischen Orthodoxie lebenden Promovenden Fromm. Sicher haben die Persönlichkeit und das Forschungsgebiet seines Doktorvaters Alfred Weber bei der Wahl des Themas eine wichtige Rolle gespielt. Den stärksten Einfluss auf die Fragestellung und die Ausarbeitung der Dissertation hatte aber sicher sein Talmudlehrer Salman Baruch Rabinkow, in dessen Wohnung in der Rahmengasse 34 Erich Fromm zwischen 1920 und 1925 fast täglich war, um mit ihm den Talmud und die jüdische Geschichte zu studieren, aber auch soziologische und kulturhistorische Fragestellungen zu erarbeiten.[3] Gleichwohl zeigt die Dissertation vor allem die Rezeption der Begriffe und Konzepte seines Doktorvaters Alfred Weber.[4]
Dass die Dissertation Fromms fast 70 Jahre nach ihrer Entstehung doch noch veröffentlicht wurde, ergibt sich aus der Bedeutung, die dieses frühe Dokument Frommschen Denkens für sein späteres wissenschaftliches und humanistisches Denken hat.[5] Auch wenn Fromm für seine Doktorarbeit noch nicht das Instrumentarium der psychoanalytischen Theorie Freuds kannte, so ist sein erkenntnisleitendes Interesse bei der Untersuchung dessen, was das Diasporajudentum gesellschaftlich zusammenkittet, bereits eindeutig sozialpsychologisch. Die Doktorarbeit zeigt nicht nur, wie Fromm den einzelnen Menschen als gesellschaftliches Wesen versteht und deshalb Ende der Zwanziger Jahre zu einer ganz eigenständigen Verbindung von Psychoanalyse und Soziologie kommen konnte. Sie illustriert auch, dass Fromm von Anfang an eine bestimmte Option für die Beurteilung gesellschaftlicher Erscheinungen kennt. Wo gesellschaftliche Entwicklungen dem „Geist“ des jüdischen Gesetzes zuwiderlaufen, gilt es, sich gegen den gesellschaftlichen Zeitgeist zu entscheiden.
Der „Geist“ des jüdischen Gesetzes lässt sich am besten umschreiben mit der „Option für das Humanum“. Freilich spricht Fromm in seiner Dissertation noch nicht von Humanismus und humanistischer Religions- und Gesellschaftskritik. Dem „Geist“ nach – und hier manifestiert sich unausgesprochen der Einfluss von Fromms Talmudlehrer Rabinkow – geht es bei seinem theologischen Verständnis des jüdischen Gesetzes um nichts anderes als um die Sicherung des Humanum. Fromms spätere humanistische Wendung des Offenbarungsbegriffs ist hier (vgl. seinen Exkurs II, S. 47-52) bereits klar vorgezeichnet. Ebenso wird Fromms Affinität zu einer bestimmten Art des Konservativen in seinem Verständnis von jüdischer Orthodoxie plausibler (vgl. S. 51°f.).
Die Arbeit Fromms über die soziologische Funktion des jüdischen Gesetzes beim Diasporajudentum ist nicht nur für jeden, der sich mit dem späteren Schrifttum Fromms und mit den Quellen seines Denkens ernsthaft auseinandersetzt, ein erhellendes Dokument.[6] Sie ist darüber hinaus ein eindrucksvolles Beispiel für die Frommsche Lesart jüdischer Geschichte (ein weiteres Dokument ist das 40 Jahre später entstandene Buch Ihr werdet sein wie Gott. Eine radikale Interpretation des Alten Testaments und seiner Tradition, 1966a). In der Dissertation gilt dies besonders für Fromms kritische Einschätzung der Reformbewegung und des liberalen Judentums um die Jahrhundertwende und für seine (lebenslange) Vorliebe für den Chassidismus. Schließlich gibt die Dissertation zu erkennen, wie umfassend Fromms Kenntnisse der jüdischen Geschichte, der Bibel- und Talmudkenntnis, der jüdischen Religionspraxis und Religionsphilosophie waren. Für Leserinnen und Leser, die mit der jüdischen Religion und Lebenswelt nicht vertraut sind, mag das am Ende beigefügte Glossar zum besseren Verständnis beitragen.
Die unter dem Rektorat von Professor Karl Hampe ausgestellte und von Professor Curtius als Dekan der Philosophischen Fakultät unterzeichnete Promotionsurkunde hat den Wortlaut:
Die Philosophische Fakultät hat dem Herrn Erich Fromm, geboren 1900 zu Frankfurt a. M., Titel und Würde eines Doktors der Philosophie verliehen. Die vorgelegte wissenschaftliche Abhandlung ›Das jüdische Gesetz. Ein Beitrag zur Soziologie des Diasporajudentums‹ ist genehmigt und die mündliche Prüfung am 20. Juli 1922 abgelegt worden. Die Fakultät hat das Gesamtergebnis beider Leistungen als sehr gut (2. Grad) anerkannt. Fachvertreter war Professor Dr. Alfred Weber. Gegenwärtige Urkunde ist zu Heidelberg im 540. Jahr seit der Gründung der Universität am 4. September 1925 vollzogen worden. (Original im Erich Fromm Institut Tübingen.)
1. Die Bedeutung des Gesetzes im Judentum
a) Das erkenntnisleitende Interesse und der Erkenntnisgegenstand der vorliegenden Arbeit
Seit der Zerstörung des zweiten Tempels ragt das jüdische Volk in die Welt der vorderasiatisch-europäischen Völker hinein als eine geheimnisvolle und unfassbare Tatsache geschichtlichen Lebens. Geheimnisvoll und unfassbar deswegen, weil sich keine Möglichkeit zu bieten scheint, Parallelen zu ihr aufzufinden oder sie in bekannte historische Bezüge einzuordnen. Das Grauen, das der einfache vorwissenschaftliche Mensch beim Anblick der Juden empfand, hat in der Gestalt des Ahasver, des ewigen Juden, seinen erschütternden Ausdruck gefunden. Die Unmöglichkeit, diese scheinbar nicht zugängliche Erscheinung zu erfassen, zeigte sich und zeigt sich noch heute in der Tatsache, dass auch die „wissenschaftliche“ Beschäftigung mit dem Judentum politischen Interessen (anzugreifen oder zu verteidigen) nur selten entrückt ist.
Die Eigenart des Diasporajudentums lässt sich etwa so kennzeichnen: Trotz Verlustes von Staat, Territorium und einer Profansprache hat das Judentum als verwandtschaftliche und schicksalsmäßig einheitliche und kontinuierliche Gruppe fortbestanden, die ihre Kraft vornehmlich auf Durchtränkung des Gesellschaftskörpers mit der ihr aufgegebenen religiösen Idee konzentrierte. Das Festhalten an der angestammten Religion geschah, ohne dass es zu einer Kirchenbildung führte. Das Judentum konnte mitten unter den anderen Völkern weiterleben, innerhalb und doch außerhalb ihrer Welt stehend.
Ich will mit Euch handeln und wandeln, mit Euch stehen und gehen und was dergleichen mehr ist; aber ich will nicht mit Euch essen, mit Euch trinken, noch mit Euch beten. (Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig, 1. Akt, 3. Szene.)
In der Terminologie von Alfred Weber (1921) ausgedrückt, heißt dies: Das Diasporajudentum als solches hat, obwohl es stets in den Zivilisationsprozess der Wirtsvölker eingebettet war, in seinem Gesellschafts- und in seinem Kulturkosmos ein Eigenleben und eine Eigengesetzlichkeit entfaltet, die seinen Fortbestand als einheitlicher Geschichtskörper gewährleistet haben.
In der vorliegenden Arbeit soll zunächst die Beziehung des „Gesellschaftskörpers“ zur „Seele“ des jüdischen „Geschichtskörpers“ analysiert werden, um dann [XI-022] aufzuzeigen, in welch außerordentlich hohem Maße hier eine Durchtränkung stattgefunden hat. Hierbei werden wir auf das jüdische Gesetz als Ausdruck dieser soziologischen Struktur des Geschichtskörpers stoßen und es im Hinblick sowohl auf seine religiösen Grundlagen als auch auf seine Funktion innerhalb der Korrelation zwischen Volk und religiöser Idee analysieren.
Das Schicksal, das der jüdische Gesellschaftskörper bei seinem Zusammenstoß mit fremden Geschichtskörpern genommen hat, wird deutlich am Schicksal des Gesetzes; es soll bei drei besonders charakteristischen Tatsachen der jüdischen Geschichte näher untersucht werden: dem Karäismus, der Reform und dem Chassidismus.
Der Karäismus, eine Sektenbewegung auf babylonischem Boden, die im Achten Jahrhundert entstand, entwickelte sich, wie gezeigt werden soll, aus der Einwirkung wirtschaftlicher Tatsachen auf die Struktur der jüdischen Gesellschaft und die hierbei hervorgerufenen Veränderungen. Zwar blieb der jüdische Gesellschaftskörper als Ganzer intakt, doch entstand in der Folge eine Sekte, deren soziologische Differenz vom Judentum noch eine geringe ist.
Ganz anders verhält es sich mit der Reform der westeuropäischen Juden im Achtzehnten und Neunzehnten Jahrhundert. Hier prallen zwei Geschichtskörper aufeinander: der jüdische und der bürgerlich-kapitalistisch-europäische. Hier wird sich die Richtigkeit der These von Alfred Weber erweisen, dass die Kulturbewegung einmalig und in sich geschlossen ist, so dass es hier auch keine Kompromisse gibt. Es wird zu zeigen sein, wie der Zusammenprall mit dem Sieg der bürgerlich-kapitalistischen Kultur endet, und es wird festzustellen sein, dass mit dem Siege der fremden Kultur auch der Gesellschaftskörper entscheidend verändert wird. Schließlich gilt es zu untersuchen, in welcher Weise diese Veränderung vor sich geht und in der Reform des Gesetzes ihren Ausdruck findet.
Beim Chassidismus soll gezeigt werden, dass tatsächlich der jüdische Geschichtskörper so sehr sein Eigenleben bewahrt hat, dass er im Achtzehnten Jahrhundert in einem völlig fremden Gesellschaftskörper, von dem er allein die Zivilisationselemente übernommen hatte, eine gesellschaftliche und kulturelle Bewegung hervorbringen konnte, die völlig dem Kultur- und Gesellschaftskosmos des Judentums entquoll.
Mit der vorliegenden Arbeit wird erstmals versucht, das Diasporajudentum als Erkenntnisobjekt einer Kultursoziologie zu verstehen und es soziologisch zu untersuchen. Von den bisher vorliegenden Arbeiten seien neben einer Fülle journalistisch-politischer Versuche nur folgende charakteristische erwähnt: die soziologische Untersuchung Max Webers (1921), die dem antiken Judentum gilt, nicht aber das Diasporajudentum zum Gegenstand hat, obwohl sie in mancher Hinsicht bereits die Problemstellungen für die vorliegende Arbeit aufzeigt. Werner Sombarts Arbeit Die Juden und das Wirtschaftsleben (1911) versucht zwar, das Diasporajudentum soziologisch zu erfassen, doch wird er dabei dem Judentum als religiös-gesellschaftlicher Erscheinung nur mit so unzureichenden Mitteln gerecht, dass diese Seite des Problems von ihm lediglich eine geringe Förderung erfahren hat.
Einen vorsoziologischen Versuch stellen manche Schriften von Martin Buber (1916 und andere) dar; diese Schriften leiden aber daran, dass Buber nicht das Judentum selbst zum Erkenntnisobjekt macht, sondern nur besondere, von ihm geschätzte [XI-023] Erscheinungen innerhalb des Judentums. Das Judentum als ganzes, in seiner nationalen und religiösen Eigenart und Totalität, hat Hermann Cohen zum Objekt nicht einer soziologischen, sondern seiner philosophischen Erkenntnis gemacht in seinem nachgelassenen Werk Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums (1920). Dieses Werk hat der vorliegenden Arbeit manche fruchtbare Anregung gegeben.
b) Das jüdische Volk und sein Gesetz
1. Die Bedeutung des Religiösen im Judentum
Der jüdische Geschichtskörper stellt eine Korrelation dar zwischen der verwandtschaftlichen und schicksalsmäßigen Einheit einerseits und der religiösen andererseits, oder anders ausgedrückt, zwischen der physischen und der metaphysischen Einheit des Volkes. Beide Bindungen sind ihrer Entstehung nach voneinander unabhängig, entstammen verschiedenen Sphären, und die Geschichte des Volkes ist die Geschichte ihrer Wechselwirkung. Auf Grund des selbständig bestehenden Volkskörpers wurde der „Religion“ jene Aufgabe abgenommen, die etwa die katholische Kirche übernehmen musste, nämlich für die Erhaltung und Ausbreitung der gesellschaftlichen Gruppe, von der die Religion getragen wird, zu sorgen. Im Judentum muss der religiöse Inhalt nicht aus sich heraus die gesellschaftlichen Bedingungen schaffen, die die Erhaltung der Gruppen garantieren. Vielmehr war der Bestand der Gruppe durch die Tatsache ihrer autonomen, blutsverwandtschaftlichen und völkischen Bindungen gewährleistet. Es brauchte keine Dogmatik und keine Kirche, um das Gruppenverhalten zu sichern. Der religiöse Inhalt konnte seinem Wesen entsprechend eine individuelle Kategorie bleiben. Die der Kirche immanente Problematik der Vergesellschaftung des Religiösen und des dauernden Kampfes dagegen (vgl. Reformation!) blieb dem jüdischen Volk erspart.
Auf der anderen Seite gab der religiöse Inhalt dem Volk als physischer Einheit eine ganz bestimmte Richtung des Schaffens. Er nahm ihm die Tendenz einer Ausbreitung in der Sphäre „dieser Welt“, in der Sphäre wirtschaftlicher und militärischer Macht, und lenkte all seine Kraft auf das Gebiet religiösen Schaffens. Die Frage, ob der Zwang der weltpolitischen Situation oder der freie Wille des Volkes die prima causa ist, bleibt hier unerörtert. Offensichtlich wich das Ideal des mächtigen weltlichen Königs dem Ideal des Messias. Durch diese Hinlenkung aller Kräfte des Volkes auf die Sphäre des religiösen Schaffens, die mit den Propheten beginnt, deren praktische Durchführung Esra einleitet und die Männer der Mischna abschließen, wird der Volkskörper befähigt, selbst die schwersten politischen Schläge zu ertragen, die zweifellos den Untergang anderer, vorwiegend diesseitig orientierter Völker zur Folge gehabt hätten. Der entscheidende Kampf zwischen Rom und dem zweiten jüdischen Staat war nur scheinbar der Kampf zwischen zwei Staaten. In Wirklichkeit zerstörten die Römer nur eine Attrappe, ein Gehäuse, das für den jüdischen Geschichtskörper im Gegensatz zum römischen ganz unwichtig war, so dass der jüdische Geschichtskörper auch nicht ernsthaft in Gefahr kam. [XI-024]
Eine wirkliche Gefahr drohte immer erst dann, wenn dem jüdischen Volk die natürlichen Grundlagen seiner Existenz genommen wurden, nicht aber, wenn ihm die politisch wertvollen Grundlagen reduziert wurden, etwa durch die Zusammensiedlung auf einem verhältnismäßig geschlossenen Gebiet bei wirtschaftlich und rechtlich gerade noch erträglichen Lebensbedingungen. Diesen Zustand gab es schon immer in der jüdischen Geschichte. Auf das Zentrum in Palästina (bis etwa 200 n. Chr.) folgte das in Babylonien (bis 1000 n. Chr.), dann das in Spanien (bis 1500 n. Chr.), dann das in Russland und Polen (bis 1800 n. Chr.). In all diesen Zentren war bei verschiedener Gestaltung der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Situation der Juden doch der Bestand des Volkskörpers als physischer Einheit gewährleistet. Erst seit über einem Jahrhundert fehlt ein solches Zentrum, und damit wird in immer steigendem Maße dem religiösen Inhalt des jüdischen Volkes eine Funktion zugemutet, die ihm fremd ist: die äußere Erhaltung der Gruppe zu garantieren, das heißt, zur Kirche zu werden.
Auf Grund der Wechselwirkung zwischen religiösem Inhalt und blutsverwandtschaftlicher und völkischer Bindung brauchte es weder die Bildung einer Kirche noch eines Staates als Ausdrucks wirtschaftlicher und militärischer Machtentfaltung. Vielmehr kam es auf Grund dieser Wechselwirkung zu einer Durchdringung des Gesellschaftskörpers durch die „Seele“ des Geschichtskörpers, und zwar mit einer so ungeheuren Penetranz, dass der Gesellschaftskörper in seiner ganzen Breite und Tiefe von der Kultur des ethischen Monotheismus erfasst und geformt wurde.
Das Bindeglied der Korrelation zwischen dieser physischen und metaphysischen Einheit, der Ausdruck also der Durchdringung des Gesellschaftskörpers durch die „Seele“ des Kulturkörpers, ist das Gesetz. Es hat nicht die Aufgabe, der Kirche den Bestand der Gruppe zu garantieren, sondern es rechnet mit dem autonomen Bestand des Volkes als Voraussetzung und hat dann vielmehr die Funktion, das Volk als blutsverwandtschaftlich gebundene Gruppe mit der ihm immanent sein sollenden religiösen Idee zu verbinden und diese Idee zu einer dauernden und unzerreißbaren Idee zu gestalten.
Es ergibt sich von vornherein folgender Charakter des Gesetzes: Es soll seinem Inhalt nach ein für alle Glieder des Volkes verbindliches und in Anbetracht der Wahrung der religiösen Individualität des Einzelnen mögliches Normensystem sein, das seinerseits seine Wurzeln in der religiösen Idee hat, die dem Volk innewohnen soll. Die religiös-sittliche Grundeinstellung wird nicht zu einem theologischen System geformt, sondern geht unmittelbar in die Halacha, das Gesetz, ein. Dieses wird so stärkster Ausdruck des religiösen Gefühls, welches seine Formung nicht im Reich der Gedanken findet, sondern in einem nationalen, gesellschaftlichen, „wertrationalen“ (Max Weber) Handeln.
Der Zeit nach liegt die physische vor der religiösen Bindung. Als blutsverwandtschaftlich gebundene Sippe wandert das Volk Israel nach Kanaan, von dort nach Ägypten. „Die Söhne Israels wurden fruchtbar, so dass das Land von ihnen wimmelte. Sie vermehrten sich, wurden sehr zahlreich und füllten das Land.“ (Ex 1,7) Doch
erst in der bewegten Zeit, die dem Auszuge aus Ägypten voraufging, und während des Aufenthaltes in der Wüste, der darauf folgte, entstand der Bund der Stämme, die später das Volk Israel ausmachten. (J. Wellhausen, 1895, S. 16.) [XI-025]
Zu der physischen Bindung des Blutes tritt die Gemeinsamkeit ihrer ökonomischen Lage und ihres äußeren Schicksals. Als ihre unerträgliche wirtschaftliche Lage sie zur Revolution treibt, zum gemeinsamen Befreiungskampf gegen Ägypten, haben wir durchaus noch den Typus der rein physischen Truppe vor uns. Aber in dieser aus rein ökonomischen Ursachen entstandenen Revolution liegt die Entstehung der metaphysischen Bindung des Volkes. Diese geschah durch das Ereignis am Sinai, die Verkündigung des Gesetzes und den Willen des Volkes, sich als Volk Gottes zu fühlen. „Moses hat den idealen Charakter des Volkes begründet und normiert dadurch, dass er ihm das Gesetz gab“ (J. Wellhausen, 1895, S. 16). Diese physisch-religiöse Einheit, diese religiöse und völkisch gebundene Doppelheit wird wohl nirgends stärker ausgedrückt als in Ex 19,6: „Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören.“
Die endgültige Loslösung des jüdischen Gesellschaftskörpers vom Staat und damit der Verzicht auf alle „Diesseits“-Ausdehnung ist die Tat Rabbi Jochanan ben Zakkais. Als Jerusalem im Jahre 70 n. Chr. von den römischen Heeren belagert wurde, gehörte er zur Friedenspartei und mahnte zur einstweiligen Unterwerfung, um Jerusalem und den Tempel vor der Zerstörung zu bewahren. Aber alle Versuche, die Kriegspartei zum Nachgeben zu bewegen, schlugen fehl. Da griff er zu einem Gewaltmittel und ließ sich von seinen Jüngern in einem Sarg durch Jerusalems Tore in das feindliche Lager der Römer tragen, um auf eigene Faust mit dem Feind zu verhandeln. Er bat um die Stadt Jamnia mit ihren Weisen zur Rekonstituierung des Synhedrions und zur Begründung eines Lehrhauses. Die Bitte wurde ihm gewährt. Er übersiedelte mit seinen Schülern nach Jamnia, wohin ihm dann die Nachricht vom Fall Jerusalems überbracht wurde. Damit ist die grundlegende Eigenart des rabbinischen Judentums geschaffen. Das Volk lebt ohne Staat und späterhin ohne gemeinsames Territorium und ohne gemeinsame lebendige Sprache. Es vermag zu leben, physisch allein durch das Blut und das Schicksal gebunden, weil seine Schwerkraft in der Sphäre des Metaphysisch-Religiösen liegt. Rabbi Jochanan ben Zakkai drückte das klar aus, wenn er sagt: „Wohin Israel vertrieben wird, zieht Gott mit.“ Rabbi Jochanan ben Zakkai und seine Nachfolger zogen auch die praktischen Konsequenzen aus der veränderten Situation. Das Synhedrion zu Jabne [Jamnia] erhielt die volle Autorität einer Oberbehörde der Juden Palästinas. Das Tempelopfer wurde endgültig durch das Gemeindegebet ersetzt und so die völlige Loslösung vom Staat vollzogen.
2. Der religiöse Inhalt des Gesetzes
Fragt man, was der metaphysische Sinn, also der religiöse Inhalt des jüdischen Volkes sei, so findet man eine ganze Anzahl von Formulierungen, die in der Sache immer ein gleiches, einfaches Großes ausdrücken: den Gedanken der metaphysischen Realität der Wirklichkeit und Einheit Gottes im Gegensatz zur Unwirklichkeit von allem nur physisch Seienden, wie er sich im Glauben an den Messias ausdrückt. Dieser Glaube an den Messias ist ein Glaube an einen Zustand, in dem alle Menschen Gott als Einheit und Wirklichkeit erkennen; er verpflichtet das jüdische Volk, auf dieses Ziel als den Sinn und Zweck aller Geschichte hinzuarbeiten. [XI-026]
Gott offenbart sich Moses als der Gott seiner „Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs“ (Ex 3,6). Erst als Moses ihn auf die Unfähigkeit des Volkes hinweist, einem namenlosen Gott zu glauben, offenbart er seinen Namen mit: „Ich bin der ich bin“ (Ex 3,14), der Seiende. Am Sinai offenbart sich Gott dem Volk mit: „Ich bin der Ewige, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Lande Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft“ (Ex 20,2). Endlich sei noch eine dritte Formulierung aus dem Pentateuch erwähnt: „Höre Israel, der Ewige unser Gott, der Ewige ist einzig.“ (Dtn 6,4) Dieser Satz ist das Bekenntnis, mit dem der Jude stirbt. Er ist der stärkste und tiefste Ausdruck biblischer Religiosität, und doch ist er alles andere als ein Dogma, das den Glauben einer ganz bestimmten Aussage über Gott fordert.
Bei den Propheten treten zu den Sätzen, die den Glauben an Gott als den wahrhaft Seienden ausdrücken, noch solche hinzu, die den Glauben an den Messias – an die Gotteserfülltheit aller Menschen – ausdrücken. So sagt Hosea:
Dann werden zurückkehren die Kinder Israels und sie werden suchen den Ewigen, ihren Gott und damit ihren König, und sich hinängstigen zum Ewigen und seiner Güte am Ende der Tage. (Hos 3,5)
Amos sagt:
An jenem Tage werde ich aufrichten die Hütte Davids, die zerfallene, und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten und sie wieder bauen, wie in den Tagen der Vorzeit. (...) Dann sollen Tage kommen – Spruch des Ewigen –, da holt der Pflüger den Schnitter ein und der Traubenkelterer den Sämann, da werden die Berge von Most triefen und alle Hügel zerfließen; dann bringe ich zurück die Gefangenen meines Volkes Israel, und sie werden verwüstete Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge aufpflanzen und Wein davon trinken, Gärten machen und Früchte daraus essen, und ich will sie in ihr Land einpflanzen, dass sie nicht mehr ausgerottet werden sollen, aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben. (Am 9, 11.13-15)
Der Prophet Micha sagt:
Am Ende der Tage wird der Berg des Hauses des Ewigen gegründet stehen auf dem höchsten Berge und er wird erhaben sein über die Hügel, und es werden zu ihm strömen die Völker und viele Völker werden gehen und sprechen: Auf, lasst uns hinaufsteigen zum Berge des Ewigen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und dass wir wandeln in seinem Pfade, denn von Zion geht die Lehre aus und das Wort Gottes von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen zwischen mächtigen Nationen bis in die Ferne, und sie werden umschmieden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Winzermessern. Nicht wird erheben ein Volk das Schwert gegen das andere, und sie werden nicht mehr lernen den Krieg, und sie werden sitzen ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken. (Micha 4,1-4)
Den höchsten Ausdruck findet der prophetische Universalismus wohl in den Worten Jesajas:
An jenem Tage wird ein Weg führen von Ägypten nach Assyrien, und Assyrien kommt nach Ägypten und Ägypten nach Assyrien und Ägypten wird mit Assyrien Gott dienen. An jenem Tage wird Israel das Heil sein zu Ägypten, und Assyrien ein Segen inmitten der Erde, den der Gott Zebaoth ausgesprochen: Gesegnet sei mein Volk Ägypten und meiner Hände Werk Assyrien und mein Erbe Israel. (Jes 19,23-25)
Jeremia ruft:
Fürwahr, es kommt die Zeit – Spruch Gottes –, da will ich mit dem [XI-027] Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Darin soll der Bund bestehen, den ich nach dieser Zeit mit dem Hause Israel schließen will – Spruch Gottes: Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und schreibe es ihnen ins Herz, und so will ich ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. (Jer 31,31-33)
Hören wir noch Ezechiel:
Und ich werde sprengen über euch reines Wasser, dass ihr rein werdet von all euren Unreinheiten, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen; und ich werde euch geben ein neues Herz, und einen neuen Geist werde ich geben in euer Inneres; und ich werde entfernen das Herz von Stein aus eurem Fleische und werde euch geben ein Herz von Fleisch, und ich werde meinen Geist geben in euer Inneres. (Ez 36,25-27)
Aus den hier wiedergegebenen Prophetenstellen wird ohne weiteres klar, was als der metaphysische Inhalt des Prophetismus anzusehen ist: Gotteserkenntnis und deren Ausbreitung auf Israel und die Menschheit, eine Gottesidee, die weit davon entfernt ist, dogmatisch zu sein. Hier ist der starke Glaube an Gott, der Glaube an den Messias, aber kein Glaube an Aussagen über Gott oder an Aussagen über den Messias.
3. Der antidogmatische Charakter des Gesetzes
Die religiösen Inhalte der Bibel und der Propheten sind auch die des ganzen späteren Judentums. Man hat immer wieder auf die biblisch-prophetischen Formulierungen zurückgegriffen und in ihnen die eigenen religiösen Inhalte ausgedrückt. Dabei war es für den jüdischen Geschichtskörper auf Grund seiner charakteristischen Korrelation von „Gesellschaftskörper“ und „Kultur“ weder notwendig noch möglich, eine Dogmatik zu entwickeln. Allerdings sollte man sich hüten, Dogmen mit gewissen bereits in der Bibel vorkommenden Formulierungen – etwa das „Höre, Israel, der Ewige unser Gott, der Ewige ist einzig“ (Dtn 6,4) – zu verwechseln. Solche Formeln enthalten im Unterschied zu Dogmen keine Aussagen über Gott, die geglaubt werden sollen, sondern sind nur Ausdruck der religiösen Grundhaltung des Volkes und zugleich die Voraussetzung für alles andere Gebotene, bei dem es auch nicht um Glauben, sondern um das Handeln geht. H. von Schubert (1919, S. 76°f.) sieht demgegenüber das Wesen des Dogmas in nachbiblischer Zeit nicht mehr im Glauben an eine Person begründet; Glaube wird vielmehr „die Zustimmung zu den Aussagen über diese Person“.
Noch ein Zweites ist zu bedenken: Natürlich hat jeder Jude und zumal jeder geistige Führer des Volkes seine ihm eigene individuelle Weltanschauung gehabt. Es ist dann nicht verwunderlich, wenn mancher den Anspruch erhebt, seine Weltanschauung im Volke durchsetzen zu wollen. Unter soziologischen Gesichtspunkten ist aber nicht dieser Anspruch wichtig, sondern die Frage, ob er sich tatsächlich durchgesetzt hat, ob also der Glaube des Einzelnen zum Glauben der Gesamtheit geworden ist. Schließlich gilt es zu bedenken, dass der Anspruch auf dogmatische Glaubensbekenntnisse – mit einer Ausnahme vielleicht – erst im Mittelalter erhoben wurde, und zwar aus apologetischen und politischen Gründen im Zusammenhang mit der Abwehr fremder Religionen und Kulturen. Die Glaubensformulierungen wurden – wie in der Philosophie [XI-028] üblich – wie eine Waffe ergriffen, um den Kampf gegen die fremden Gegner möglich zu machen. Das Ganze war eine Art Mimikry, die beim Zusammenstoß mit fremden Kulturen nötig wurde. (Zur Frage der Dogmenbildung vgl. S. Schechter, 1889, S. 48-61 und 115-127.)
Etwas Ähnliches wie eine Glaubensformulierung finden wir in der jüdischen Literatur erstmals im Traktat Sanhedrin des Talmud, wo es heißt:
Dies sind die, die keinen Anteil an der kommenden Welt haben, die die Wiederauferstehung der Toten leugnen, die sagen, dass die Tora nicht von Gott gegeben ist, und die Epikuräer.
Abgesehen davon, dass dieser Satz schon seiner Unvollständigkeit wegen nicht als vollständige Dogmatik des Judentums angesehen werden kann, geht aus ihm auch hervor, dass die drei Glaubenserfordernisse aus polemischen Gründen angeführt werden. Auch S. Schechter (1889, S. 58), der den Glaubenscharakter des Judentums verteidigt, muss zugeben: „Wenn die Rabbinen die drei Punkte aufstellten, so muss das irgendeinen historischen Grund gehabt haben.“ Denn es gibt auch diese Aussagen im Talmud (zit. nach S. Schechter, 1889, S. 57): „Wer den Götzendienst leugnet, wird Jude genannt. Der Jude, auch wenn er gesündigt hat, bleibt Jude.“
Von Dogmen im eigentlichen Sinne kann erstmals bei der Sekte der Karäer, die sich vom Judentum abspaltete, gesprochen werden. Wir finden sie im Eschkol Ha-Kofer des Jehuda Hadassi (um 1150 n. Chr.), der sie seinerseits möglicherweise von dem Karäer Josef Alfasir (um 950 n. Chr.) ganz oder teilweise übernommen hat. Auch der Gründer des Karäismus, Anan ben David, hat offenbar eine dogmatische, in Arabisch geschriebene „Summe“ verfasst.
Lassen sich zum ersten Mal Dogmen bei einer vom Judentum abgefallenen Sekte finden, so stellen kurze Zeit später repräsentative Gelehrte des Judentums selbst Dogmen auf. Der Grund hierfür wird, wie auch S. Schechter (1889) annimmt, in den engeren Kontakten der Juden zu neueren philosophischen Schulen und Glaubensbekenntnissen zu suchen sein, sowie in dem Bemühen einzelner Gelehrter, sich mit diesen Glaubensbekenntnissen und Philosophien persönlich in der Weise auseinanderzusetzen, dass sie die Autorität des Judentums in Form eines theologischen Systems einbringen zu müssen glaubten.
Der erste Vertreter des Judentums, der ein Dogmensystem aufstellte, war der jüdische Religionsphilosoph Maimonides. Er formulierte dreizehn Glaubensartikel, von deren Anerkennung er die Zugehörigkeit zum Judentum abhängig machen wollte. Die Glaubensartikel von Maimonides fanden teilweise Anerkennung, teilweise wurden sie ergänzt oder gekürzt, teilweise wurde ihnen heftig widersprochen. So stellte Nachmanides nur drei Grundprinzipien des Judentums auf (die creatio ex nihilo, die Allwissenheit und die Vorsehung); Rabbi David ben Samuel d’estella (1320) sprach von sieben Glaubenssätzen, Rabbi David ben Jomtof Bilia fügte den dreizehn von Maimonides weitere dreizehn hinzu. Rabbi Josef kennt nur eine Grundglaubensforderung des Judentums. Endlich vertritt Rabbi Saul aus Berlin (gestorben 1794), ein Kritiker von Maimonides, dass Dogmen überhaupt nur mit Rücksicht auf die Notwendigkeit der Zeit gemacht werden können.
Die Dogmen haben tatsächlich keine weiterreichende Bedeutung bekommen, als individuelle Meinungsäußerungen einzelner Führer des jüdischen Volkes zu sein. Dies [XI-029] beweist vor allem die Tatsache der völligen Verschiedenheit der aufgestellten Dogmen. Während das Gesetz nur wenige eindeutige Kodifizierungen gefunden hat, die für das ganze Volk in praxi verbindlich waren, entstand unter den jüdischen Gelehrten eine große Auseinandersetzung um die Glaubensartikel. Doch darüber ist es nie auch nur zur geringsten nationalen Spaltung und Absonderung gekommen. Es war ein rein theoretischer Streit, der heute nur noch historische und literarische Bedeutung hat. Das jüdische Volk selbst hat die Dogmen längst vergessen mit Ausnahme der dreizehn Glaubensartikel des Maimonides, die – zu einem Gedicht umgearbeitet – nach Beendigung des Gottesdienstes am Abend der Feiertage gesungen werden. Vergleicht man hiermit etwa die Rolle des Glaubensbekenntnisses im Islam oder in der katholischen bzw. protestantischen Kirche, so springt einem der Unterschied sofort in die Augen.
Um den rein theoretischen Charakter der Dogmen und ihre gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit im jüdischen Volk zu illustrieren, mag die Kontroverse zwischen Maimonides und Rabbi Abraham ben David typisch sein. Auf die Bemerkung des Maimonides, dass derjenige, der nicht an die völlige Unkörperlichkeit Gottes glaube, keinen Anteil an der zukünftigen Welt habe, bemerkt Rabbi Abraham in seinem Kommentar zum Werk von Maimonides kurz: „Bessere und Größere als Du haben daran geglaubt!“
c) Von der Form im allgemeinen und dem jüdischen Gesetz im besonderen
Das jüdische Volk wird durch die gemeinsame Form des Gesetzes konstituiert, wobei das Gesetz der Träger des religiösen Inhalts ist. Welches ist die allgemeine Bedeutung der Form, als gesellschaftliches Handeln – als formaler Ausdruck religiösen Inhalts – verstanden, und welches ist ihre Beziehung zum Sinn?
Die Bedeutung der Form ist zunächst – negativ – in dem Schutz zu sehen, den sie gewährt. Sie schützt das Heilige, das sich in ihr birgt, den Inhalt, dem sie als Hülle dient. Der heilige Inhalt darf nur in seltenen Augenblicken unmittelbar ausgesprochen und enthüllt werden. In der Geschichte lässt sich immer wieder beobachten, dass dann, wenn heiligste Inhalte unverhüllt der Masse übergeben werden, sie immer mehr ihre Heiligkeit verlieren und schließlich als Plattheiten enden, die nur noch von Unwissenden im Munde geführt werden. Das Heilige darf nur im Augenblick der Weihe oder in der Heimlichkeit intimer Menschengemeinschaft gefahrlos ausgesprochen werden. Dies ist der tiefere Sinn des jüdischen Verbots, den Namen Gottes auszusprechen, und erklärt zugleich, warum es dennoch dem hohen Priester einmal im Jahr, in der Weihestunde des Versöhnungstages, erlaubt war, den Namen Gottes auszusprechen.
Die Form schützt den in ihr geborgenen heiligen Inhalt; sie schützt aber auch die Individualität des von diesem Inhalt erfüllten Menschen. Zwar lässt schon die Sprache, insofern sie die Form ist, in der ein Inhalt ausgedrückt wird, der Individualität des Einzelnen eine gewisse Freiheit, den Inhalt so zu verstehen und ihn sich neu zu schaffen, wie er allein es kann und muss; um wieviel größer ist aber die Freiheit, wenn der [XI-030] ungesagte Inhalt in der Form verhüllt bleibt. Erst dann kann der Einzelne diesen Inhalt ganz seiner Eigenart entsprechend gestalten, ohne dennoch – und hierin liegt eine weitere Bedeutung der Form – den Zusammenhang mit den Menschen seiner Generation, mit der Gesamtheit des Volkes und mit den Generationen vor ihm und nach ihm, also den Zusammenhang mit der Geschichte, zu verlieren. Formen sind unmittelbare Träger des „Sinns“, sie sind Vermittler zwischen religiöser Idee und Gesamtheit. Sie wahren ebenso die Individualität des Einzelnen im Rahmen der Idee, wie den Zusammenhang der Gesamtheit und die Kontinuität der Geschichte.
Die Form gibt nicht den Inhalt selbst, sie deutet ihn nur an. Der Einzelne muss sie mit Inhalt erfüllen und immer wieder von neuem erfüllen. Er selbst muss Inhalt schaffen, muss schöpferisch, muss Künstler sein. Die Form erzieht Menschen, erzieht ein Volk zum Schöpfertum. Und nur ein schöpferisches Volk kann sinnvoll Formen leben. Ist ein Volk unschöpferisch, dann wird das Formensystem zum Formalismus. Versteht das Volk nicht mehr, dass die Form nur ein Vorletztes ist, wird sie ihm selbst zum In-halt – und es müssen neue Propheten kommen, es zu erwecken.
Gemeinsame Formen erziehen zur Liebe. Liebe zielt auf den Menschen an sich, unabhängig von seiner Eigenart und Qualifikation. Die Form ist eine Bindung, die unabhängig von der Eigenart des Einzelnen ist. Sie schafft Gemeinsames zwischen den Menschen, zwischen guten und schlechten, armen und reichen, klugen und dummen. An der Fülle gemeinsamer Formen sind sowohl die Verbundenheit eines Volkes zu erkennen wie auch das Maß der Liebe, das in ihm ist. Aus der Gemeinsamkeit der sinnerfüllten Form erklärt sich auch die Eigenart der durch die Form gebundenen Masse. Dort, wo eine Masse durch keine oder nur durch unwesentliche Formen verbunden ist, da ist ihr gerade das triviale Geringwertige gemeinsam. Der Einzelne mag in ihr der Wertvolle, Sittliche sein, doch die Masse vieler solcher Einzelner ist unsittlich, ist zu Handlungen fähig, deren der Einzelne nie fähig wäre, weil jeder nur einen Teil der Verantwortung trägt und den größeren Teil auf alle anderen abwälzt.
Hat jedoch die Masse eine Gemeinsamkeit von Formen, die zum Heiligsten und Höchsten in Beziehung stehen, wird die Psychologie der Masse gerade umgekehrt sein. Mag der Einzelne zu Schlechtem fähig sein, die Masse, die Gemeinde ist heilig, weil die Menschen dadurch, dass ihnen gerade ihr Heiligstes gemeinsam ist, tiefe Ehrfurcht voreinander haben; sie wälzen auch nicht die Verantwortung auf den anderen ab, vielmehr wird ihre eigene Verantwortung durch seine Gegenwart noch erheblich verstärkt. Hierin liegt die Gegensätzlichkeit der Psychologie der formlosen europäischen Masse und der formgebundenen jüdischen Masse. Die Liebe schaffende Bedeutung des Gesetzes drückt Leopold Zunz (1843, S. 174°f.) besonders schön aus:
So oft dann an unserm äußern Menschen das Symbol sichtbar wird, regt in dem innern sich die alte Liebe und zieht in ihre geweiheten Kreise Alle, die in gemeinschaftlicher Überzeugung mit uns sich erbauet, die mit dem religiösen Brauch uns Tugenden eingepflanzt haben; ja, es werden Alle uns nahe gerückt, die mit uns dasselbe Weh gefühlt, oder mit denen wir gleiches Leid tragen, und in ein Meer glühender Liebe versinkt und schmilzt die kalte Selbstsucht. (...) Dahingegen wirst du, wenn deine Seele an dem religiösen Gesetze Ergötzen hat, denen zugethan bleiben, welche in demselben Gesetze dasselbe Heiligthum verehren. [XI-031]
Was für die Form im allgemeinen gilt, gilt natürlich auch für das jüdische Gesetz im besonderen. Das Gesetz, das – wie bereits gezeigt wurde – Handeln, und nicht Glauben verlangt, ist für die Gesamtheit geschaffen, nicht für den Einzelnen, für das Volk, nicht für eine Schicht. Vor ihm sind alle gleich; es besagt einen inhaltlichen, nicht einen formalen Demokratismus. Das Judentum verneint prinzipiell eine nur für eine gesellschaftliche Schicht mögliche oder bestimmte Kultur; das Gesetz ist stärkster Ausdruck dieses Prinzips. Es soll dem ganzen Volke die Wege zum Ziel bahnen. Deshalb hat sich ihm auch der zu unterwerfen, der die Stützen des Gesetzes gar nicht nötig hätte, weil er den Weg zum Ziel alleine finden könnte. Gerade die Führer der Nation haben diesen Grundsatz mit ihrem Blute besiegelt, als sie zur Zeit der Hadrianischen Verfolgungen dem Volk erlaubten, bei Todesgefahr das Gesetz zu verletzen (es sei denn, es ging um Mord, Unzucht oder Götzendienst), und selbst aber, die sie gewiss am wenigsten des Gesetzes bedurften, von dieser Erlaubnis Gebrauch zu machen verschmähten.
Das Gesetz will Möglichkeiten schaffen, zum Ziel zu kommen, doch ist es nicht selbst das Ziel. Es ist, wie das Wort „Halacha“ (von haloch = gehen) besagt, ein Weg. Dies bedeutet auch, dass man ohne ihn zum Ziel der Erkenntnis Gottes kommen kann. Er ist gewiss nicht das Ziel selbst. Er will vielmehr gegangen sein, verlangt dabei ein Schaffen des Menschen.
Während nun aber nur wenige sich den Weg zum Ziel selbst bahnen können, ist der einmal gebahnte Weg für die Gesamtheit des Volkes gangbar. Das Gesetz will die Umwelt verändern, nicht unmittelbar die Menschen. Dies wird wohl am deutlichsten beim Sabbatgesetz. Es ist in dem Gesetz – was sehr wohl denkbar wäre – nicht vorgeschrieben, welcher Stimmung der Jude am Sabbat sein soll, welcher Geist ihn beseelen und wie die Art seiner Freude und seiner Ruhe sein soll. Aber es wird ihm bis ins einzelne befohlen, was er zu tun und zu lassen hat. Es verbietet nicht nur allgemein, dass er irgendwelche Arbeit verrichtet, sondern bis in kleinste Kleinigkeiten wird kasuistisch festgestellt, was erlaubt und was verboten ist. So ist dem Juden nicht nur verboten, zu kaufen und zu verkaufen, selbst das Berühren des Geldes und aller irgendwie werktäglichen Gegenstände ist ihm untersagt. Das Gesetz verändert die Umwelt des Juden am Sabbat. Es trennt ihn radikal von der werktäglichen Welt, die ihn sonst umgibt, und will ihm so die Möglichkeit zur inneren schöpferischen Ruhe geben. Das Gesetz will die Umwelt verändern, um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu ändern.
Träger des Gesetzes als Ganzes ist das Volk. Die Ausübung des einzelnen Gesetzes ist dem Einzelnen, der Männergemeinschaft und der Familie übertragen. Die Stellung von Mann und Frau zum Gesetz ist verschieden. Für die Frau gilt das Gesetz mit Ausnahme all jener Pflichten, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind. Dies hat wohl seinen Grund darin, dass gerade jene Gesetze, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind, den Sinn haben, den Menschen aus seiner Zeitgebundenheit herauszureißen und ihn so zum Beherrscher der Zeit zu machen. Diese Notwendigkeit besteht für den Mann bei weitem mehr als für die Frau.
Soweit Gesetze nur den Einzelnen betreffen und ihn nicht gleichzeitig als Glied der Männergemeinschaft erfassen, sind sie an Gelegenheiten geknüpft, die ihrer Eigenart [XI-032] nach auch jeweils nur den Einzelnen betreffen wie etwa die Reinheitsgesetze, die Gesetze für die Eheschließung oder für den Todesfall.
Das Gesetz, dessen eigentlicher Träger die Männergemeinschaft ist, ist das Gebet. Es gilt zwar, dass auch der Einzelne es mit einigen Abänderungen verrichten darf, doch ist seine eigentliche Stätte die Gemeinde der zehn Männer. In der Gemeinde ruht Gottes Herrlichkeit und in ihr drückt sich der gesellschaftliche Charakter des Judentums am deutlichsten aus. Dies wird vor allem am Versöhnungstag deutlich. Diesen Tag verbringt die Gemeinde, von Abend zu Abend fastend und betend, in ihre Sterbekleider gehüllt, um an ihm zu Gott zurückzukehren. Der Versöhnungstag hat ein bestimmtes Datum im Jahr. Doch wenn immer eine Gemeinde beschließt, in Gemeinschaft „die Rückkehr zu vollziehen“ und diesen Tag zu feiern, ist ihr dies möglich und gestattet, weil nicht der bestimmte Termin, sondern die Tatsache der Rückkehr der Gemeinde wesentlich ist. Der Talmud sagt, dass viele Vergehen, die durch die Buße des einzelnen keine Versöhnung finden können, erst in der Rückkehr der Gemeinde ihre individuelle Sühne und Aufhebung finden.
Als Trägerin des Gesetzes steht die Familie der Gemeinschaft der Männer gegenüber. Für sie ist wohl die Feier des Seder, die Erinnerungsfeier an die Befreiung aus Ägypten, besonders typisch. Alle nationale Schönheit und Größe ist hier zusammengefasst, damit ihr im Kreis der Familie gedankt wird. Dies wird bereits im biblischen Gebot deutlich:
Da sprach Gott zu Aaron und Moses in Ägypten folgendermaßen: „Der gegenwärtige Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, als erster unter den Monaten des Jahres soll er euch gelten. Sprecht zur ganzen Gemeinde Israels folgendermaßen: Am zehnten des gegenwärtigen Monats, da sollen sie sich je ein Stück Kleinvieh für jede Familie anschaffen.“ (Ex 12,1-3)
Auch am Chanukkafest, dem Fest zur Erinnerung an die siegreichen Kämpfe der Makkabäer und der Einweihung des Tempels, befiehlt der Talmud, dass es in besonderer Weise in der Familie gefeiert werde.
Es lässt sich sagen, dass das, was seinen Grund in den individuellen Beziehungen zwischen Mensch und Gott hat, wie das Gebet, in die Gemeinschaft der Männer hineinverlegt wird, und dass umgekehrt das, was seinen Grund im Gemeinschaftlichen, Nationalen hat, im Kreis der Familie beheimatet ist. Durch diese Wechselbindung wurde die Verschmelzung des Volkskörpers mit dem Gesetz und damit mit dem religiösen Inhalt befestigt und verstärkt.
Für das Judentum steht die „diesseitige Welt“, die Welt der Körperlichkeit und Stofflichkeit, nicht im Kampf mit der „jenseitigen Welt“, der Welt der metaphysischen Realität, sondern „diese“ Welt steht im Dienste „jener“ Welt, sie wird von ihr geformt und erfüllt. Das Verhältnis des Menschen zu beiden Welten wird am besten mit dem Begriff der „tätigen Weltheiligung“ ausgedrückt. Das Gesetz soll hierfür den Weg bahnen; denn die Beherrschung dieser Welt und die Ermöglichung religiösen Schaffens sind die Bedingungen der Erkenntnis Gottes.
Bei den Gesetzen, deren Sinn die religiöse Beherrschung und Heiligung dieser Welt ist, sind zwei Gruppen zu unterscheiden: solche, die diese Beherrschung symbolisieren und dadurch mittelbar wirksam sind, sei es am Einzelnen, sei es an der Nation, und solche, die diese Beherrschung unmittelbar schaffen sollen. Jene Gesetze, die in erster Linie die In-Dienst-Stellung des einzelnen symbolisieren, haben gleichzeitig [XI-033] die Eigenart, Abzeichen des Bundes zwischen Gott und dem Volk zu sein. Zu ihnen gehört das Beschneidungsgebot, das wohl am stärksten die Heiligung des Menschen durch den Bund Gottes mit dem Volk Israel ausdrückt. Ferner gehört zu ihnen das Gebot, an den vier Ecken der Gewänder Schaufäden zu tragen: Denn
ihr sollt sie sehen und aller Gebote Gottes gedenken und sie befolgen; und ihr sollt eurem Herzen und eurem Auge nicht folgen, denen ihr nachbuhlt, damit ihr denkt und befolgt alle meine Gebote und heilig seid eurem Gotte. (Num 15,39°f.)
Endlich gehört hierher das Gebot der Tefillin [Gebetsriemen], jener Symbole, die in einem kleinen Würfel einzelne Abschnitte der Thora, auf Pergament geschrieben, enthalten; sie werden morgens beim Gebet um Kopf und Arm gebunden und sind ein Ausdruck von deren Heiligung. Auch beim Gebot der Mezuza [Türpfosten] werden Behälter mit kleinen Pergamentrollen, die Textstellen aus der Thora enthalten, an alle Türen des Hauses angebracht.
Jene Gesetze, die Ausdruck der göttlichen Bestimmung des Volkes sind, tragen historischen Charakter, weil mit ihnen an die großen historischen Ereignisse erinnert wird: die Feste zur Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten, an die Gesetzgebung am Sinai und an manche andere bedeutsamen Ereignisse der Geschichte.
Gesetze, die erst in zweiter Linie einen symbolischen Charakter haben, in erster Linie jedoch selbst unmittelbar den Menschen zur Beherrschung dieser Welt erziehen wollen, sind vor allem das Speisegesetz, das Ehegesetz und das soziale Gesetz. Das Speisegesetz, das den Genuss von Tieren einschränkt und den Blutgenuss verbietet, will zur Beherrschung des Essens erziehen. Es will den Menschen zum Herrscher über die sich ihm zum Genuss darbietende Tierwelt machen, indem sie ihn zum Diener eines Gesetzes macht. Dieselbe prinzipielle Bedeutung, den Menschen zur Beherrschung zu erziehen, hat für den Bereich der Sexualität das Ehegesetz mit seiner schroffen Regelung der Beziehung zwischen Mann und Frau. Endlich gehört hierher auch das soziale Gesetz, das die Abgabe des Zehnten fordert, das Stehenlassen der Ecken des Feldes befiehlt und die Nachlese verbietet. Anders als bei den vorgenannten Gesetzen wird hier nicht die Person, sondern das Vermögen in den Dienst des sittlich-religiösen Ziels gestellt.
Dass der Mensch als Bürger dieser Welt in den Dienst Gottes oder – wie die bevorzugte Wendung lautet – unter „das Joch des Göttlichen Reiches“ gestellt ist, wird am eindrucksvollsten mit dem biblischen Satz ausgedrückt: „Du sollst lieben den Ewigen, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen.“ (Dtn 6,5)
Eine zweite Forderung des jüdischen Gesetzes will dem Menschen so viel wie möglich an Ruhe, an Freisein vom Getriebe und an Freisein von der Sorge für die Welt geben, so dass er selbständig, religiös schaffen kann. Mit ihr soll dem Menschen die Möglichkeit gegeben werden, sich aus dem Getriebe der Welt herauszulösen, um selbst in das Reich des Religiösen vorzudringen. Der stärkste und gewaltigste Ausdruck dieser Tendenz zur Ruhe, zur Beherrschung der Zeit, zur Unterbrechung der Hastigkeit und des diesseitigen Betriebs ist der Sabbat. Mit Recht hat das jüdische Volk das Sabbatgebot (neben dem Gebot zur Beschneidung gehört es zur ersten Art der Gesetze) als sein größtes und heiligstes Gut angesehen, als den Grundpfeiler seiner Existenz. [XI-034] Dadurch, dass der Sabbat die Krönung der Weltschöpfung durch Gott selbst ist, wird er schon in der Bibel mit der höchsten Heiligkeit bekleidet.[7]
Die Sabbatheiligung ist (wie auch die Beschneidung) schon vor der Gesetzgebung am Sinai ein Gebot. Als bei der Wüstenwanderung das Manna fällt, wird den Israeliten befohlen: „Sechs Tage sollt ihr sammeln, aber der siebte ist der Sabbat, da wird es nicht sein.“ (Ex 16,26) Also feierte das Volk den siebten Tag. Seine endgültige Fixierung findet das Sabbatgebot in der Bibel in den Zehn Geboten:
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke verrichten, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. (...) Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drinnen ist, und ruhte am siebten Tage; darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. (Dtn 5,13-15)
Das rabbinische Judentum hat das Sabbatgesetz mit demselben Rigorismus, der schon für das biblische Verbot typisch ist (sogar die Arbeit des Sklaven und der Tiere wird verboten), ausgebaut und erweitert. Vor allem in der mündlichen Tradition war man bestrebt, im einzelnen festzustellen, welche Arbeiten am Sabbat verboten sind. Es werden 39 Hauptarbeiten für verboten erklärt (wobei unter eine Hauptarbeit jeweils eine Vielzahl von speziellen Tätigkeiten fallen). Die mündliche Tradition erreichte mit diesem System von Verboten schließlich, dass der Jude am Sabbat von der Welt des Werktags völlig abgetrennt und losgelöst ist. Die angestrebte Ruhe will dem Menschen jede Möglichkeit nehmen, irgendwie auf die Welt schöpferisch einzuwirken. Die ganze Welt der Stofflichkeit, der der Mensch sonst als schaffender und verändernder gegenübersteht, ist für den Juden am Sabbat und in dieser Beziehung nicht existent.
Für das rabbinische Gesetz bedeutet Ruhe nicht „Ausruhen“, sondern Schaffen in der Sphäre des Religiösen und Unterlassen allen Schaffens in der Sphäre der stofflichen Welt. Nur von diesem Prinzip aus sind die Einzelbestimmungen über die Arten der verbotenen Arbeiten zu verstehen. Hierin liegt auch der tiefere Sinn der Analogie von Sabbatruhe und Ruhe Gottes am siebten Tag der Schöpfung. Seine ganze Schöpferkraft soll und muss sich infolge dieses Gesetzes auf die geistig-religiöse Sphäre erstrecken und hier wirken.
Der Sabbat ist auf Grund dieses Gesetzes weit mehr und etwas völlig anderes als ein Tag des Nichtarbeitens. Er ist ein Tag höchster geistiger Schöpfertätigkeit des Einzelnen. Mit ungeheurem Radikalismus hat das Gesetz dieses Prinzip des Abbruchs aller tätigen Beziehung zur Welt durchgeführt. Dies führt so weit, dass das Löschen eines Brandes, bei dem das ganze Vermögen eines Juden auf dem Spiel steht, verboten wird. Nur bei Lebensgefahr ist die Übertretung des Sabbatgesetzes – wie auch anderer Gesetze – gestattet.
Die Tendenz, den Menschen aus der Gebundenheit der werktäglichen Welt zu lösen und ihm die Möglichkeit religiösen Schaffens zu geben, drückt sich nicht minder deutlich im Sabbatjahr aus. Es befiehlt, jedes siebte Jahr den Boden unbestellt zu lassen und den wild wachsenden Ertrag den Armen zu lassen. Gewöhnlich wird das Sabbatjahr nur unter einem sozialfürsorglichen und agrarischen Aspekt gesehen. Die Bedeutung des Sabbatjahrgesetzes liegt jedoch darin, dass es in größeren Zeiträumen in [XI-035] das Leben eingreift, um dann auch einen verhältnismäßig großen Zeitraum ganz für das religiöse Schaffen in Beschlag zu nehmen.
Die Gesetze, die die Gebetszeiten regeln, haben ebenfalls vor allem den Sinn, je neu Ruhe und Abgetrenntheit von der Welt inmitten der Welt zu erreichen. Dreimal am Tag verpflichtet das Gesetz den Juden zu beten, also sein Tagwerk zu unterbrechen, um religiös zu schaffen. Diese Pflicht gilt gleichermaßen für den Gelehrten, der sein Studium unterbricht, wie für den Arbeiter, der seine Arbeit unterbrechen muss, um dieser Pflicht zu genügen. Es erhellt ohne weiteres, wie stark diese Gesetzesbestimmung dem werktäglichen Leben die Hast nimmt und dem Einzelnen immer wieder die Herrschaft über die Zeit und dadurch religiöses Schaffen sichert. Das Pflichtgebet ist in ganz besonderem Maße der Ausdruck „tätiger Weltheiligung“. Es wird dem Einzelnen nicht überlassen, dann zu beten, wenn er in religiöser Stimmung dazu ist; es wird ihm vielmehr auferlegt, sich selbst immer wieder in Unterbrechung seines Tagwerks die seelische Haltung zu „schaffen“, in der Gebet möglich ist.[8]
Ein anderer Aspekt des Gebets hängt mit dem zuvor Gesagten zusammen: Das Gebet des Judentums ist das Gemeindegebet, von dem sich außerhalb des Judentums (außer später im Christentum) nur kümmerliche Spuren und Keime aufweisen lassen. (Vgl. F. Heiler, 1920, S. 421°ff.) Der Mittelpunkt des Gebetes ist das Achtzehngebet, das in seiner heutigen Form erst nach dem Untergang des zweiten Tempels (70 n. Chr.) abgefasst wurde, dessen Grundlagen aber schon in die Zeit vor der Entstehung des Christentums zurückreichen. Wie F. Heiler (1920) richtig bemerkt, ist das Achtzehngebet ein „Gebetsformular“, das von jedem einzelnen Beter mit seinem individuellen religiösen Inhalt erfüllt werden soll. Der kollektiv gültige Gebetstext ist nur Motiv und Möglichkeit individuellen religiösen Schaffens, wie übrigens das gottesdienstliche Gemeindegebet überhaupt. Innerlich im Geiste prophetischer Frömmigkeit wurzelnd, ist es ein unmittelbarer Ausfluss des individuellen prophetischen Gebetslebens. So fügt sich das Gebet durchaus in den Rahmen des gesamten Gesetzes ein, insofern dieses ja auch als eine Form anzusehen ist, die dem religiösen Eigenleben des Einzelnen Freiheit lässt.
Es ist außerordentlich bezeichnend, dass sowohl der Karäismus wie die Reformbewegung das Gesetz in seiner objektiv gültigen Form aufheben wollten und deshalb sofort einen Angriff gegen das jüdische Gemeindegebet unternahmen, indem sie an die Stelle des Achtzehngebets solche Gedichte und Psalmen setzten, die einen viel individuelleren religiösen Charakter tragen als das „Gebetsformular“ des Achtzehngebets. Ebenso bezeichnend ist es, dass der Chassidismus mit seiner Bejahung des Gesetzes auch das Achtzehngebet beibehielt, obwohl angesichts seiner neuen schöpferischen religiösen Kraft eine Änderung des Gebets verständlich gewesen wäre.
Das Gesetz hat die Aufgabe, jedem Menschen aus dem Volke den Weg zur Erkenntnis Gottes zu bahnen. Es will keine „innerweltliche Askese“, sondern „tätige Weltheiligung“.[9] Was die Erkenntnis Gottes selbst sei, darüber schweigt das Gesetz. Jenseits des ganz elementaren Glaubens an die Einzigkeit Gottes ist im Gesetz nichts gedanklich formuliert, was für die Gesamtheit verbindlich wäre. Nur im geheimen, vertrauten Kreise werden „die Geheimnisse enthüllt“ (vgl. H. Cohen, 1920, S. 399).
Exkurs I:
Arbeit und Beruf im rabbinischen Judentum
Wir haben als eine wesentliche religiöse Grundlage des Gesetzes die Tendenz festgestellt, dem Menschen Ruhe und damit die Möglichkeit zu Kontemplation und zu religiösem Schaffen zu geben. Für eine ganze Gruppe von Gesetzen haben wir gerade darin ihr Spezifikum gesehen, wobei wir hier nur den Sabbat, das Sabbatjahr und das Pflichtgebet hervorgehoben haben.
Es liegt deshalb nahe, nach der Stellung zu fragen, die das rabbinische Judentum überhaupt zu Beruf und Arbeit eingenommen hat. Diese Aufgabe wird durch die Arbeiten von Max Weber erleichtert, der in klassischer Weise den Zusammenhang zwischen der Wertschätzung und Bedeutung des Berufes und der Arbeit einerseits und den vorherrschenden religiös-sittlichen Anschauungen andererseits am Beispiel der Wirtschaftsethik des Protestantismus aufgewiesen hat. Er hat dabei sogar schon in wenigen Sätzen das Problem und die Lösung im Hinblick auf das Judentum angedeutet:
Wenn also, wie mehrfach schon die Zeitgenossen, so auch neuere Schriftsteller die ethische Grundstimmung speziell des englischen Puritanismus als „English Hebraism“ bezeichnen, so ist dies, richtig verstanden, durchaus zutreffend. Man darf dabei nur nicht an das palästinensische Judentum aus der Zeit der Entstehung der alttestamentlichen Schriften, sondern an das Judentum, wie es unter dem Einfluss der vielen Jahrhunderte formalistisch-gesetzlicher und talmudischer Erziehung allmählich wurde, denken und muss auch äußerst vorsichtig mit Parallelen sein. (M. Weber, 1920, Band I, S. 180°f.)
Die insgesamt unbefangene Wertschätzung des Lebens im alten Judentum liegt weit ab von der spezifischen Eigenart des Puritanismus; ebenso fern lag dem alten Judentum – und das darf nicht übersehen werden – die Wirtschaftsethik des mittelalterlichen oder neuzeitlichen Judentums, die bei der Entwicklung des kapitalistischen Ethos eine wichtige Rolle spielte. Dieses Judentum stand nämlich auf der Seite des politisch oder spekulativ orientierten Abenteurerkapitalismus. Sein Ethos war das des „Pariakapitalismus“. Der Puritanismus vertrat das Ethos des rationalen bürgerlichen Betriebs und der rationalen Organisation der Arbeit. Er entnahm dabei der [XI-037] jüdischen Ethik nur, was in seinen Rahmen passte.
Wir wollen im Folgenden näher untersuchen und zeigen, dass der Gegensatz, den Max Weber zwischen dem Wirtschaftsethos des Puritanismus und dem des Judentums empfindet und andeutet, tatsächlich besteht. Es gibt ihn nicht nur für das Alte Testament, sondern gerade auch für das rabbinisch-talmudische Judentum. Zunächst sollen in Kürze die Hauptpositionen Max Webers über den Puritanismus nachgezeichnet werden, um sie dann dem jüdischen Verständnis gegenüberzustellen.
a) Die Wirtschaftsethik des Puritanismus
Schon bei Martin Luther bekommt der Beruf eine im katholischen Mittelalter unbekannte Bedeutung. Er gewinnt einen religiös-ethischen Sinn.
Nun ist unverkennbar, dass schon in dem deutschen Worte „Beruf“ ebenso wie in vielleicht noch deutlicherer Weise in dem englischen „calling“, eine religiöse Vorstellung – die einer von Gott gestellten Aufgabe – wenigstens mitklingt und, je nachdrücklicher wir auf das Wort im konkreten Fall den Ton legen, desto fühlbarer wird. Und verfolgen wir nun das Wort geschichtlich durch die Kultursprachen hindurch, so zeigt sich zunächst, dass die vorwiegend katholischen Völker für das, was wir „Beruf“ (im Sinne von Lebensstellung, umgrenztes Arbeitsgebiet) nennen, einen Ausdruck ähnlicher Färbung ebenso wenig kennen wie das klassische Altertum. (M. Weber, 1920, Band I, S. 63.)
Den Trieb zur hastigen, ruhelosen Arbeit leitet Max Weber von dem Streben ab, ein Zeichen für die Außenweltheit zu gewinnen. Dies sei die den Puritaner dauernd quälende Frage. In der Hast der täglichen Arbeit und im Erfolg der Arbeit suche er einen Beweis für die Gnade Gottes zu gewinnen. Die Arbeit selbst sei absolutes Gebot Gottes. Sie sei heilig und werde zum Selbstzweck:
Aber die Arbeit ist darüber hinaus, und vor allem, von Gott vorgeschriebener Selbstzweck des Lebens überhaupt. Der paulinische Satz: „Wer nicht arbeitet, soll nicht essen“, gilt bedingungslos und für jedermann. Die Arbeitsunlust ist Symptom fehlenden Gnadenstandes. (M. Weber, 1920, Band I, S. 171.)
Reich zu werden und den Reichtum zu Gottes Ehre zu verwenden, ist göttliches Gebot. John Wesley (zit. nach M. Weber, 1920, Band I, S. 197) sagt: „Wir müssen alle Christen ermahnen zu gewinnen, was sie können, und zu sparen, was sie können, das heißt im Ergebnis: reich zu werden.“
Weiterhin beruhte die Bedeutung der Arbeit im Puritanismus auf ihrer Verwendbarkeit als asketisches Mittel und als Ablenkung vom „unreinen Leben“:
Demgemäß zieht sich eine immer wiederholte, zuweilen fast leidenschaftliche Predigt harter, stetiger körperlicher oder geistiger Arbeit durch Baxters Hauptwerk. Die Arbeit ist zunächst das alterprobte asketische Mittel, als welches sie in der Kirche des Abendlandes, im scharfen Gegensatz nicht nur gegen den Orient, sondern gegen fast alle Mönchsregeln der ganzen Welt, von jeher geschätzt war. (M. Weber, 1920, Band I, S. 169.)
Die außergewöhnliche Einschätzung der Arbeit als eines verbindlichen Gottesgebotes, als eines Selbstzwecks und als eines asketischen Mittels sowie die Auffassung des Berufs als einer sittlich-religiösen Aufgabe und des Reichtums als eines gottgewollten, all dies führt nach Max Weber zu einer notwendig negativen Tendenz:
Wertlos [XI-038] und eventuell direkt verwerflich ist daher auch untätige Kontemplation, mindestens wenn sie auf Kosten der Berufsarbeit erfolgt. Denn sie ist Gott minder wohlgefällig als das aktive Tun seines Willens im Beruf. (M. Weber, 1920, Band I, S. 168.)
b) Zum Verhältnis von Berufsarbeit und Religionspraxis im rabbinischen Judentum
Wir wenden uns nun der Stellung des rabbinischen Judentums zur Arbeit und zum Beruf zu. Die bereits oben ausgeführte prinzipielle Einstellung des Judentums sei als Voraussetzung zu den Einzelfragen nochmals zusammengefasst:
Das Judentum bejaht „diese“ Welt, es verlangt Gotteserkenntnis in ihr. Es will Heiligung der Welt durch Erkenntnis und Tat, nicht Zurückhaltung von Welt und Askese. Alles in der Welt verlangt nach Heiligung und wird als Geheiligtes bejaht. Das Judentum geht von der Idee „tätiger Weltheiligung“ aus. Dieser Aufgabe dient das Gesetz. Die Einstellung der „innerweltlichen Askese“, wie sie Max Weber beim Puritanismus aufzeigte, wo der Mensch sich gleichsam gegen die Welt wehren muss und die Arbeit zu einem Mittel des Sichwehrens wird, ist dem Judentum ganz fremd, da es der Welt gegenüber eine positiven religiösen Sinn verleihende Einstellung hat. Anstelle des negativen Systems der innerweltlichen Askese steht im Judentum das positive System des Gesetzes.
Höchstes und alleiniges Ziel des Lebens ist im Judentum die Erkenntnis. So wie die Welt Gott untergeordnet ist, so ist die Arbeit dem Erkennen untergeordnet. Die dem Puritanismus eigene Anschauung von der Heiligkeit der Arbeit als solcher fehlt im rabbinischen Judentum völlig. Oberster Zweck des Lebens ist Erkenntnis, und Arbeit ist notwendig zur Erhaltung des Lebens, sie ist ein notwendiges Übel. Sie darf deshalb auch nur geschehen, um den Bedarf zu decken, nicht aber um zu sammeln.
Die Wirtschaftsethik des Judentums ist – in der Sprache Max Webers – „traditionalistisch“. In der biblischen Erzählung von der Vertreibung aus dem Paradies wird die Arbeit als Fluch dargestellt, während Ruhe die Krönung und Heiligung der Arbeit ist. Den Kindern Israels wird das Sammeln von Manna über den augenblicklichen Bedarf hinaus verboten. Besonders im Buch Kohelet wird der wirtschaftliche Traditionalismus im Gegensatz zum Puritanismus deutlich. Dort steht, dass Gott „dem Sünder den Sinn zu sammeln und aufzuspeichern gab“ (Koh 2,26) und dass eine Handvoll in Ruhe besser sei, als zwei Hände voll in Hast, usw.
Die Einstellung des Alten Testaments kennzeichnet Max Weber mit folgenden Worten:
Speziell das Alte Testament, welches eine Überbietung der innerweltlichen Sittlichkeit in der genuinen Prophetie gar nicht und auch sonst nur in ganz vereinzelten Rudimenten und Ansätzen kannte, hat einen ganz ähnlichen religiösen Gedanken streng in diesem Sinne gestaltet: ein jeder bleibe bei seiner „Nahrung“ und lasse den Gottlosen nach Gewinn streben: das ist der Sinn aller der Stellen, welche direkt von weltlicher Hantierung handeln. Erst der Talmud steht darin teilweise – aber auch nicht grundsätzlich – auf anderem Boden. (M. Weber, 1920, Band I, S. 74.)
Wie die nachfolgenden Zitate aus der talmudischen Literatur zeigen, ist auch das [XI-039] rabbinische Judentum nach der maßgebenden Literatur ganz traditionalistisch eingestellt. Zunächst ein Zitat aus der Mischna, der ältesten und autoritativsten Quelle des nachbiblischen Judentums. Dort sagt Rabbi Simeon ben Eleasar:
Hast du in deinem Leben ein Tier oder einen Vogel ein Handwerk ausüben sehen? Diese werden ohne Mühsal ernährt, obgleich sie erschaffen worden sind, nur um mich zu bedienen; um wieviel mehr sollte ich, wo ich erschaffen worden bin, um meinem Schöpfer zu dienen, ohne Mühsal ernährt werden. Aber ich habe meine Werke verdorben (das heißt meine Taten sind schlecht geworden) und mich um meine Ernährung gebracht. (Traktat Kidduschin 4,14 [Fol. 82a])
Einen ähnlichen Gedanken finden wir im Talmud, wo Arbeit auch dann, wenn sie bejaht wird, doch immer nur als notwendiges Übel angesehen wird, so dass der Gegensatz zu einem puritanischen Verständnis von Arbeit als Gebot Gottes oder gar als Selbstzweck (vgl. die oben zitierte Position von Richard Baxter) ganz offensichtlich ist. In einer religiösen Akademie wurde über die Pflicht der Arbeit und des Studiums der Lehre Gottes disputiert. Es ging um die Auslegung von Jos 1,8: „Das Buch des Gesetzes weiche nie von deinen Lippen.“ Rabbi Ismael erhob sich und sprach: „Das heilige Gesetz trifft viele Vorkehrungen in betreff der bürgerlichen Ordnung und stellt viele Normen für die Arbeit, das Gewerbe etc. auf. Allein diese bürgerliche Ordnung könnte sich mit der Verpflichtung, sich immer mit dem Studium der Thora zu beschäftigen, unmöglich vertragen. Es folgt daraus, dass diese Verpflichtung sich den bürgerlichen Bedürfnissen anbequemen müsse.“ (zit. nach M. H. Friedländer, 1890).
Rabbi Simeon ben Jochaim wies die Erklärung Rabbi Ismaels entschieden zurück:
Wie könnt ihr zur gleichen Zeit Gott und der Welt entsprechen? Die Welt raubt euch alle eure Stunden, so dass euch für das Studium der Lehre Gottes keine Zeit übrig bleibt. Da heißt es bald Pflügen, bald Säen, bald Ernten, bald Dreschen etc. Wenn wir studieren und getreu den göttlichen Vorschriften leben, dann wird der Himmel uns mit Reichtümern und Gutem segnen. Wir werden schon Leute haben, die für uns arbeiten werden. (Traktat Berachot 6,1 [Fol. 35b].)
Die Diskussion wurde noch lange fortgesetzt, ohne dass man sich einigen oder zu einem entschiedenen Schluss kommen konnte. Eine andere Akademie, die ebenfalls über diese Frage verhandelte, beschloss so:
Wir haben Beispiele von vielen, die der Ansicht des Rabbi Simeon ben Jochaim huldigen, seinem Rate Folge leisteten und ihre ganze Zeit und Kraft ausschließlich dem Studium der Gotteslehre widmeten, ohne dass es ihnen gelungen wäre, zum Ziele zu gelangen, während wieder andere, die der Ansicht des Rabbi Ismael sind und daher einen Teil ihrer Zeit der Arbeit, den anderen Teil dem Studium der Tora weihen, ihr Ziel erreichten. (Traktat Berachot 6,1 [Fol.35b].)
Es ist auch sehr bezeichnend, dass die jüdische Tradition, die sonst jedes in der Bibel vorkommende oder auch nur angedeutete Gebot aufs Genaueste zählt und bearbeitet, den Satz „Sechs Tage sollst du arbeiten!“ nicht unter die Gebote aufgenommen hat.
In schroffem Widerspruch zur Ansicht des Puritanismus, dass es eine sittliche Pflicht sei, Reichtum zu Gottes Ehre zu erwerben, steht der Satz des Midrasch, zu dem es viele Parallelen gibt: „Besser ist der, der nur kleine milde Gaben spendet, aber von [XI-040] dem Seinigen, als der, welcher raubt, erpresst und bedrückt und große Gaben spendet.“ (Kohelet Rabbot 4,6.) – „Ebenso sprach auch Gott: Mir ist eine Hand voll freiwilliger Gaben des Armen lieber als Hände voll Räucherwerk des Hohenpriesters. Warum? Weil durch jene, nicht aber durch dieses die Sühne kommt, vgl. Lev 23,1.“ [Zit. nach A. Wünsche, 1880, S. 60°f.]
Für unseren Zusammenhang sehr bezeichnend sind auch folgende Sätze des Midrasch [Kohelet Rabbot] zum Satz „Lieber eine Hand voll in Ruhe, als beide Hände voll in Mühsal und Jagd nach Wind“ (Koh 4,6):
Besser ist der, welcher nur zehn Goldstücke besitzt und damit handelt und sich ernährt, als der, welcher Geld von andern nimmt und Schaden und Verlust erleidet. Das Sprichwort sagt: Er verliert Eigenes und Fremdes. Sein Jagen ist Wind, das heißt sein Streben geht nur darauf, Kaufmann genannt zu werden.
Und Rabbi Chija bar Abba sagte:
Besser ist eine Hand voll Gemütsruhe, die der Sabbat bietet, als Hände voll Mühseligkeit und quälende Sorge in den sechs Werkeltagen; denn derselbe hat ferner gesagt: Israel wird nur in Folge der Sabbatheiligung erlöst, s. Jes 30,15.“ [Zit. nach A. Wünsche, 1880, S. 60.]
Sehr deutlich zeigt folgender Midrasch (Kohelet Rabbot) zu Koh 2,26 [zit. nach A. Wünsche, 1880, S. 36] die radikale Tendenz gegen das Sammeln:
Dem einen Menschen, der ihm gefällt, das heißt unserem Vater Abraham, gab er Weisheit, dem Sünder hingegen, das heißt dem Nimrod, gab er Geschäftigkeit zu sammeln und zu häufen, um es dem Gottgefälligen, das heißt Abraham, zu geben, s. Gen 24,1°ff.
Oder: Unter „dem gottgefälligen Menschen“ sind die Israeliten zu verstehen, als sie in Ägypten waren. Ihnen verlieh Gott Weisheit und Erkenntnis,“ dem Sünder aber, „das heißt den Kanaanitern, gab er den Trieb, Reichtümer zusammenzuhäufen.“ (Ähnlich lauten vier weitere Varianten.)
Zum Schluss sei noch ein Midrasch aus Kohelet Rabbot angeführt, bei dem die traditionalistische Einstellung besonders an der Stelle deutlich wird, wo die Arbeit empfohlen wird, ihr aber ein auffallend geringer Platz beigemessen wird: „Sei bemüht und bestrebt, dir neben dem Torastudium als Erwerbsquelle ein Handwerk zu eigen zu machen“, lehrt Rabbi Jehuda Hanassi im Namen der heiligen Gemeinde. Diese Gemeinde wurde deshalb heilig genannt, weil ihre Mitglieder die Werktage in drei Abschnitte teilten: sie widmeten einen Abschnitt dem Studium, einen dem Gebet und den dritten der Arbeit.
Das rabbinische Judentum hatte – dies sollte mit den Beispielen gezeigt werden – eine traditionalistische (oder wie Max Weber sagen würde: nicht-kapitalistische) Einstellung zur Wirtschaft. Dennoch finden wir im rabbinischen Judentum eine starke Wertschätzung der Arbeit, wie auch die einschlägige Literatur immer wieder betont. Stellen wie die folgenden sind durchaus nicht selten: „Das Handwerk ist von großer Wichtigkeit, denn es ehrt und lobt den Meister“ (Traktat Nedarim 6,1°f. [Fol. 49b]); „Groß ist die Arbeit, denn sie ehrt ihren Herrn.“ – „Von der Erde wird gesättigt der, welcher ihr dient.“ – „Die Arbeit ernährt nicht bloß, sondern adelt und erhöht den Menschen.“
Die vorstehenden Aussprüche stehen durchaus nicht im Widerspruch zu den oben zitierten. Die Wertschätzung der Arbeit entspringt hier nämlich ganz anderen Motiven als beim Puritanismus. In der geschilderten Diskussion um die Frage, ob Arbeit im [XI-041] Widerspruch zum Gebot stehe, sich Tag und Nacht mit der Lehre zu beschäftigen, ist das Motiv der jüdischen Wertschätzung deutlich zu erkennen. Auf die Frage, wovon man leben solle, antwortete Rabbi Schimon ben Jochai: „Der Himmel wird uns mit Reichtümern und mit Gutem segnen, und andere Leute werden für uns arbeiten“, so lehnt das rabbinische Judentum diese Antworten ab. Die erste wird als rein utopisch angesehen und mit dem die Realität bejahenden Charakter des Judentums unverträglich; die zweite – und hier liegt der wesentliche Punkt – wird als mit dem demokratischen Charakter des Judentums unvereinbar angesehen.
Das rabbinische Judentum lehnt es ab, dass eine Schicht arbeiten soll, um einer anderen Schicht die Kultur zu ermöglichen. Alle sollen zur Erkenntnis kommen. Der Gedanke, der schon in der Bibel seine klassische Formulierung gefunden hat, dass Gott das ganze Volk zu einem Volk von Propheten macht, durchzieht das ganze rabbinische Judentum. Dies hat auch zur Konsequenz, dass keiner sich der nun mal notwendigen Arbeit entziehen kann. So wie das ganze Volk zur Erkenntnis kommen soll, so ist auch das ganze Volk zur Arbeit verpflichtet. „Es durfte niemand sagen, ich bin zu dieser Arbeit zu vornehm.“ „Vermiete dich lieber zu jeder Arbeit, mag sie noch so niedrig sein, als an die Munifizenz anderer Menschen zu appellieren.“ (Traktat Baba Batra 8,1 [Fol. 110a])
Gerade die jüdischen Gelehrten sprechen von der Wertschätzung der Arbeit, die bis zur Bestimmung gehen kann: „Jeder Vater hat die Pflicht, seinen Sohn ein Handwerk lernen zu lassen.“ (Kidduschin 1,7 [Fol. 29a]) – Rabbi Josua ben Chananja lehrt: „Wer des Morgens und des Abends je zwei Halachas studiert, die übrige Zeit aber für das Gewerbe verwendet, hat der Pflicht, täglich das Gesetz zu studieren, entsprochen.“
Es ist auch bezeichnend, dass gerade unter den jüdischen Gelehrten eine große Zahl von Handarbeitern sind, die in ihrem Leben dieses Prinzip der Arbeit als notwendiger Pflicht für alle verwirklichen. Auch der Ackerbau war für viele hervorragende Lehrer aus talmudischer Zeit eine Lieblingsbeschäftigung. In Palästina war es Rabbi Eliezer ben Hyrkan, der stets eine Furche pflügte, bevor er das Lehrhaus des Rabbi Jochanan ben Zakkai besuchte. Ackerbauern waren Rabbi Ismael, Rabbi Eliezer ben Asarja, Rabbi Juda ben Schamma, Rabbi Gamliel und andere mehr. In Babylonien waren Samuel, Huna Abaia, Raba [Josef ben Chama], Rabbi Pappa u.a. Ackerbauern.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959121200
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (November)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Jüdisches Gesetz Judentum Karäismus Chassidismus Neoorthodoxie