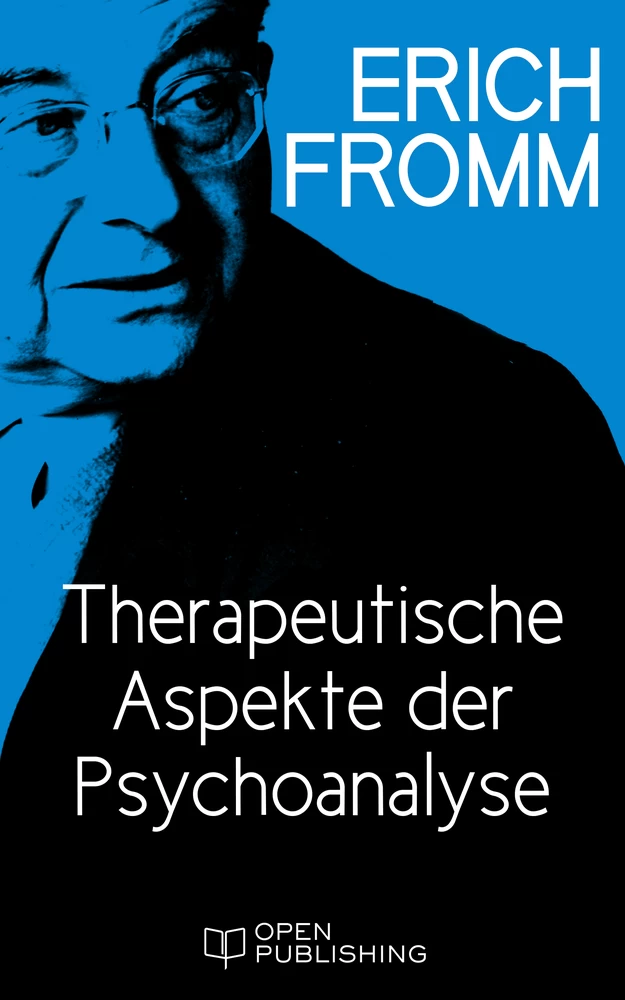Zusammenfassung
Für Fromm ist die Kunst des Therapierens eine Kunst des Zuhörens und eine Frage des Bezogenseins. Eine solche therapeutische „Technik“ lässt sich nicht mit Hilfe von störungsspezifischen Behandlungsmanualen erlernen; vielmehr ist sie das Ergebnis eines sehr direkten, urteilsfreien Bezogenseins auf einen anderen Menschen und auf sich selbst. Patienten werden von Fromm nicht als ein fremdes, „gestörtes“ Gegenüber gesehen; vielmehr ist die Beziehung von einer tief reichenden Solidarität bestimmt. Dies setzt voraus, dass der Analytiker und die Analytikerin mit sich selbst umzugehen gelernt haben und noch immer – durch tägliche Selbstanalyse – zu lernen bereit sind.
Aus dem Inhalt
• Wirkfaktoren der psychoanalytischen Behandlung
• Voraussetzungen der psychoanalytischen Therapie
• Die prägende Kraft von Gesellschaft und Kultur
• Die therapeutische Beziehung im psychoanalytischen Prozess
• Die Bearbeitung des Widerstands
• Übertragung, Gegenübertragung und reale Beziehung
• Besondere Methoden bei der Therapie der modernen Charakterneurosen
• Sich selbst analysieren
• Psychoanalytische „Technik“ oder die Kunst des Zuhörens
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Therapeutische Aspekte der Psychoanalyse
- Inhalt
- 1. Zum Selbstverständnis und zum Menschenbild der Psychoanalyse
- a) Welches Ziel hat die Psychoanalyse?
- b) Sigmund Freuds therapeutische Zielsetzung und ihre Kritik
- c) Das Freudsche Bild vom Kind und seine Kritik
- d) Der Stellenwert der Kindheitserfahrungen im therapeutischen Prozess
- e) Die Rezeption der Psychoanalyse in der therapeutischen Praxis
- f) Der Beitrag Harry Stack Sullivans zum Menschenbild der Psychoanalyse
- g) Die Krankheit unserer Zeit als Herausforderung für die Psychoanalyse
- 2. Voraussetzungen der psychoanalytischen Therapie
- a) Die Fähigkeit zu psychischem Wachstum
- b) Die Verantwortung jedes Einzelnen für sein psychisches Wachstumspotenzial
- c) Die Fähigkeit zur subjektiven Wirklichkeitswahrnehmung
- d) Die prägende Kraft von Gesellschaft und Kultur
- e) Die Dynamik psychischer Entwicklung und die Freiheit des Menschen
- 3. Die Wirkfaktoren der psychoanalytischen Therapie
- 4. Die therapeutische Beziehung im psychoanalytischen Prozess
- a) Das Geschehen zwischen Psychoanalytiker und Analysand
- b) Voraussetzungen beim Psychoanalytiker
- c) Fragen des Umgangs mit dem Analysanden
- 5. Aufgaben und Methoden des psychoanalytischen Prozesses
- a) Die Mobilisierung unbewusster Kräfte und das Aufzeigen von Alternativen
- b) Sublimierung, Triebbefriedigung und Triebverzicht am Beispiel sexueller Perversionen
- c) Die Bearbeitung des Widerstands
- d) Übertragung, Gegenübertragung und reale Beziehung
- e) Hinweise zur Arbeit mit Träumen
- 6. Christiane. Bemerkungen zur therapeutischen Methode und zum Traumverstehen anhand eines Fallberichts
- a) Die ersten drei Stunden und der erste Traum
- b) Der zweite Therapiemonat und der zweite Traum
- c) Der weitere Verlauf der Therapie und der dritte Traum
- d) Der vierte Traum und generelle Überlegungen zum Verlauf der Therapie
- 7. Besondere Methoden bei der Therapie der modernen Charakterneurosen
- a) Das eigene Handeln ändern
- b) Interesse an der Welt entwickeln
- c) Kritisch denken lernen
- d) Sich selbst erkennen und seines Unbewussten gewahr werden
- e) Des eigenen Körpers gewahr werden
- f) Sich konzentrieren und meditieren
- g) Den eigenen Narzissmus entdecken
- h) Sich selbst analysieren
- 8. Psychoanalytische „Technik“ oder die Kunst des Zuhörens
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
1. Zum Selbstverständnis und zum Menschenbild der Psychoanalyse
a) Welches Ziel hat die Psychoanalyse?
Die Frage, mit der ich beginnen möchte[1], ist zugleich auch die Grundfrage für alles weitere: Welches Ziel hat die Psychoanalyse? Dies ist eine einfache Frage, und es gibt auch eine einfache Antwort: Die Psychoanalyse zielt darauf, sich selbst zu erkennen. Selbsterkenntnis ist ein sehr altes menschliches Bedürfnis. Von den Griechen über das Mittelalter bis zur Gegenwart lässt sich die Vorstellung nachweisen, dass die Selbsterkenntnis die Grundlage der Erkenntnis der Welt ist – oder um es mit einer drastischen Formulierung von Meister Eckhart auszudrücken: „Es gibt nur einen einzigen Weg, Gott zu erkennen: sich selbst zu erkennen.“ Selbsterkenntnis ist eine der ältesten Sehnsüchte der Menschen. Sie ist eine Sehnsucht oder eine Zielsetzung, die ihre Wurzeln sehr wohl in objektiven Gegebenheiten hat.
Wie kann jemand die Welt erkennen, wie vermag jemand zu leben und richtig zu reagieren, wenn uns das Instrument zum Handeln und zur Entscheidung nicht bekannt ist? Wir sind der Führer dieses „Ichs“, das es irgendwie fertigbringt, dass wir in der Welt leben, Entscheidungen fällen, Prioritäten setzen und uns zu Werten bekennen. Wenn dieses Ich, dieses Subjekt, das entscheidet und handelt, uns nicht genügend bekannt ist, bedeutet dies, dass all unsere Handlungen und Entscheidungen halbblind oder nur in einem halbwachen Zustand erfolgen. Es gilt, in Betracht zu ziehen, dass der Mensch im Unterschied zum Tier keine solchen Instinkte hat, die ihm sagen, wie er zu handeln hat, so dass das Tier auch gar nichts außer dem, was ihm die Instinkte sagen, wissen muss. Allerdings gilt diese Feststellung nur mit der Einschränkung, dass auch im Tierreich die Tiere etwas lernen müssen, und zwar selbst die auf niedrigem Evolutionsniveau. Instinkte funktionieren nicht ohne wenigstens ein Minimum an Lernen. Dieser Aspekt ändert aber nichts daran, dass die Tiere im Großen und Ganzen nicht viel „wissen“ müssen. Das Tier muss sehr wohl einige Erfahrungen gesammelt haben, die durch die Erinnerung vermittelt werden.
Der Mensch hingegen muss Erkenntnis haben, um entscheiden zu können. Seine Instinkte sagen ihm nicht, wie er sich entscheiden soll. Sie sagen ihm nur, dass er essen, trinken, sich verteidigen und schlafen muss, und nach Möglichkeit auch, dass er Kinder [XII-262] hervorbringen soll, wobei der Trick der Natur darin besteht, dass sie den Menschen mit einem bestimmten Vergnügen oder einer Lust auf sexuelle Befriedigung ausgestattet hat. Doch das sexuelle Verlangen ist bei weitem kein so starkes instinktives Verlangen wie die anderen Triebe und Impulse. Das Verlangen, sich selbst zu kennen, ist deshalb nicht nur unter einer spirituellen, religiösen, moralischen oder menschlichen Perspektive eine Bedingung des Menschen, sondern auch bei biologischer Betrachtungsweise.
Das Optimum an Lebensfähigkeit hängt vom Grad der Kenntnis über uns selbst ab. Diese Kenntnis ist das Instrument, mit dem wir uns in der Welt orientieren und unsere Entscheidungen treffen. Offensichtlich ist es so: Je besser wir uns selbst bekannt sind, desto richtiger sind unsere Entscheidungen, die wir treffen. Und je weniger wir uns kennen, desto unklarer müssen unsere Entscheidungen ausfallen.
Die Psychoanalyse eignet sich nicht nur zur Therapie, sondern ist auch ein Instrument, sich selber zu verstehen, das heißt, sich selber zu befreien. Als Hilfsmittel bei der Kunst des Lebens hat die Psychoanalyse unter persönlichen und praktischen Gesichtspunkten meiner Meinung nach sogar die wichtigste Bedeutung.
Der Hauptwert der Psychoanalyse liegt darin, dass sie zu einer spirituellen Veränderung der Persönlichkeit verhelfen kann, und weniger darin, Symptome zu heilen. Solange es keine bessere und kürzere Methode gibt, Symptome zu heilen, hat die Psychoanalyse auch hier ihre Bedeutung; ihre tatsächliche historische Bedeutung liegt in Richtung jener Erkenntnis, die man auch im buddhistischen Denken findet: Es geht der Psychoanalyse um eine bestimmte Art des Gewahrwerdens seiner selbst, um „Achtsamkeit“, wie sie in der buddhistischen Praxis eine zentrale Rolle spielt, mit dem Ziel, einen besseren Zustand des Seins zu erreichen und sinnvoller leben zu können als der durchschnittliche Mensch.
Die Psychoanalyse behauptet, dass Selbsterkenntnis eine heilende Wirkung hat. Diesen Anspruch erhob bereits das Evangelium: „Die Wahrheit wird euch frei machen.“ [Jo 8,32] Warum soll die Kenntnis des eigenen Unbewussten, also eine umfassende Selbsterkenntnis, dazu verhelfen, einen Menschen von seinen Symptomen zu befreien, ja ihn sogar glücklich machen?
b) Sigmund Freuds therapeutische Zielsetzung und ihre Kritik
Ich möchte zuerst auf die therapeutische Zielsetzung der klassischen, der Freudschen Psychoanalyse, zu sprechen kommen. Freud sah das therapeutische Ziel darin, den Menschen arbeitsfähig und sexuell genussfähig zu machen, so dass er sich der Sexualität erfreuen kann und fähig ist, sexuell zu funktionieren. Um es mit anderen Worten zu sagen, das Ziel ist, zu arbeiten und sich fortzupflanzen. Dies sind zugleich die zwei großen Forderungen, die die Gesellschaft an jeden Einzelnen stellt. Die Gesellschaft muss den Menschen Gründe liefern und sie indoktrinieren, warum sie arbeiten und Kinder hervorbringen sollen. Wir tun dies schlecht und recht aus vielerlei Gründen. Der Staat tut im allgemeinen nichts besonderes, um die Menschen dazu anzuhalten; braucht der Staat aber mehr Kinder, als derzeit hervorgebracht werden, dann wird er alle möglichen Anstrengungen dazu unternehmen. [XII-263]
Freuds Definition von psychischer Gesundheit ist in Wirklichkeit eine gesellschaftliche Definition. Sie zielt auf eine Normalität im gesellschaftlichen Sinne ab. Es geht darum, dass der Mensch der gesellschaftlichen Norm gemäß funktioniert; dementsprechend ist auch die Definition des Symptoms eine gesellschaftliche: Ein Symptom liegt dann vor, wenn es für den Einzelnen schwierig ist, der gesellschaftlichen Norm gemäß zu funktionieren. Deshalb wird der Konsum von Drogen als schweres Symptom angesehen, das zwanghafte Rauchen dagegen nicht, obwohl es vom Psychologischen her das gleiche Phänomen ist. Gesellschaftlich gesehen gibt es einen großen Unterschied, denn wenn jemand bestimmte Drogen nimmt, dann hindern diese ihn in vielen Situationen daran, gesellschaftlich angemessen zu funktionieren. Jemand kann sich zu Tode rauchen – wen kümmert es? Stirbt er an Lungenkrebs, dann ist dies kein gesellschaftliches Problem. Die Menschen sterben so oder so. Und wenn jemand mit fünfzig Jahren an Lungenkrebs stirbt, dann ist er gesellschaftlich gesehen auch nicht mehr wichtig. Immerhin hat er die gewünschte Zahl von Kindern gehabt, hat seine Arbeitskraft der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und sein Bestes getan. Sein Rauchen und der Lungenkrebs sind uninteressant, weil sie die genannten gesellschaftlichen Funktionen nicht stören.
Wir erklären etwas zu einem Symptom, wenn es der gesellschaftlichen Funktion des Menschen abträglich ist. Weil dies so ist, gilt der Mensch als gesund, der unfähig ist, etwas von seinem eigenen Erleben zu spüren, und stattdessen alles immer nur ganz „realistisch“ sieht. In Wirklichkeit ist er genauso krank wie der Psychotiker, der unfähig ist, die äußere Wirklichkeit als etwas wahrzunehmen, mit dem er umgehen kann und das er gestalten kann, der stattdessen aber alles in sich wahrnimmt, was für den sogenannten normalen Menschen unzugänglich ist: Gefühle, selbst die äußerst feinen Gefühlsregungen, und das innere Erleben.
Freuds Definition von seelisch-geistiger Gesundheit ist im wesentlichen eine gesellschaftliche. Dies ist keine Kritik an Freud im engeren Sinne, denn Freud war so sehr ein Kind seiner Zeit, dass er seine Gesellschaft nie infragestellte. Die einzige Ausnahme betraf die Sexualität; hier war ihm das sexuelle Tabu zu streng, weshalb er es gemildert sehen wollte. Freud selbst war ein sehr prüder Mensch, und er wäre außerordentlich geschockt, wenn er sehen würde, zu welchem sexuellen Verhalten angeblich seine Lehren geführt haben. In Wirklichkeit hat Freud wenig mit dieser Entwicklung zu tun, denn das gegenwärtige Sexualverhalten ist Teil eines allgemeinen Konsumverhaltens.
Wie begründet Freud das beschriebene Ziel der Psychoanalyse? Die Freudsche Auffassung von dem, was in der Therapie geschieht, lässt sich im Kern von seiner Trauma-Theorie her so skizzieren: Freud nimmt ein traumatisches Ereignis in der frühen Kindheit an, das verdrängt wurde und, eben weil es verdrängt wurde, noch immer am Werk ist. Der sogenannte „Wiederholungszwang“ bindet den Menschen an dieses frühe Ereignis, und zwar nicht nur auf Grund seines Beharrungsvermögens und weil das traumatische Ereignis von damals noch immer seine Wirkung zeigt, sondern weil der Wiederholungszwang den Menschen dazu anhält, das gleiche Verhalten je neu zu wiederholen. Wird dieses Verhalten zu Bewusstsein und seine Energie in Erfahrung gebracht, und zwar nicht nur intellektuell, sondern, wie Freud bald erkannte, affektiv [XII-264] erlebt (was er „durcharbeiten“ nannte), dann hat dies die Wirkung, die Macht des Traumas zu brechen, so dass der Mensch von seinem verdrängten Einfluss befreit ist.
Ich habe schwerwiegende Zweifel an der Richtigkeit dieser Theorie. Als erstes möchte ich ein persönliches Erlebnis aus der Zeit mitteilen, als ich in Ausbildung am Psychoanalytischen Institut in Berlin war [1928 bis 1930].[2] Dort gab es einmal unter den Professoren eine lange Diskussion, an denen die Lehranalysanden gewöhnlich teilnahmen, wie oft es eigentlich vorkomme, dass ein Patient sich wirklich seiner frühen traumatischen Ereignisse erinnere. Die Mehrheit der Professoren sagte, dass dies äußerst selten geschehe. Ich war völlig überrascht, denn ich war ein guter und gutgläubiger Schüler und hatte an die Theorie geglaubt. Und plötzlich hörte ich, dass das, was als Grundlage für die Heilung galt, so selten vorkam. – (Die Professoren fanden natürlich einen Ausweg aus dem Dilemma, indem sie sagten, dass das Trauma aber in der Übertragung wiederkehre. Doch darauf möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen.)
Das Trauma ist in Wirklichkeit sehr selten und es ist tatsächlich ein einzelnes Erlebnis; es muss außerordentlich und wirklich traumatisch sein, um eine so starke Wirkung zu haben. Vieles, was für traumatisch gehalten wird – wenn etwa der Vater den dreijährigen Jungen im Zorn einmal verprügelt hat –, ist überhaupt kein traumatisches Ereignis, weil der Einfluss, den das Ereignis hat, nicht im einzelnen Ereignis begründet liegt, sondern in der gesamten und kontinuierlichen Eltern- und Familienatmosphäre. Auch wenn man heute bereits dann von traumatischen Situationen spricht, wenn man den Zug verpasst hat oder irgendwo einige unerfreuliche Erlebnisse hatte, so gilt doch, dass das wirkliche Trauma per definitionem ein Ereignis ist, das über die Belastbarkeit des menschlichen Nervensystems hinausgeht. Dies ist der Grund, warum es eine tiefe Störung verursacht und dann auch eine Wirkung zeitigt. Die meisten Ereignisse zeigen keine solche Wirkung und sind deshalb auch keine Traumata. Vielmehr ist das, was eine Wirkung zeigt, die beständige Atmosphäre.
Das Alter, in dem es zu einer Traumatisierung kommt, spielt nur bedingt eine Rolle. Einerseits kann es in jedem Alter zu einer Traumatisierung kommen, andererseits hat das gleiche traumatische Ereignis eine stärkere Wirkung, je früher es sich zuträgt. Gleichzeitig sind dann aber auch die Kräfte, mit denen sich der Mensch davon wieder erholen kann, noch stärker. Das Problem ist also sehr verwickelt, und ich möchte nur vor dem heute so häufig praktizierten ungenauen Gebrauch des Wortes Trauma warnen.
Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die sich im Laufe des psychoanalytischen Prozesses verändert haben. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die sich dabei nicht verändert haben. Es ist aber eine Tatsache, dass es auch ohne Psychoanalyse zu tiefgreifenden Änderungen in einem Menschen kommt. Die Erfahrungen mit dem Vietnamkrieg sind hier ein gutes Beispiel. Da gab es viele, die in ihrer Einstellung bezüglich des Vietnamkriegs Falken waren; ich denke hier etwa an konservative Offiziere der Luftwaffe. Diese Leute waren in Vietnam und bekamen dort alles mit; sie sahen die Sinnlosigkeit, die Ungerechtigkeit, die Grausamkeit – und plötzlich kam es zu dem, was man in früheren Zeiten eine „Konversion“ genannt hat: Plötzlich sahen diese Menschen ihre Welt völlig anders und wandelten sich von Befürwortern des [XII-265] Krieges zu Menschen, die ihr Leben und ihre Freiheit riskierten, den Krieg zu beenden. Solche Menschen sind fast nicht wiederzuerkennen. Sie sind selbst andere Menschen geworden, und zwar nur auf Grund eines eindrucksvollen Erlebnisses und auf Grund der Tatsache, dass sie die Fähigkeit hatten, eigenständig zu reagieren. Diese Fähigkeit haben die meisten Menschen nicht, weil sie bereits zu unsensibel geworden sind. – Tiefgreifende Änderungen gibt es also innerhalb und außerhalb der Psychoanalyse, und für beide Möglichkeiten lassen sich hinreichend Beispiele finden.
c) Das Freudsche Bild vom Kind und seine Kritik
Wie jeder, der sich ein wenig mit Freud befasst hat, weiß, war Freud äußerst kritisch, wenn es um sein besonderes Thema ging: um die Beziehung des bewussten Denkens zur unbewussten Motivation. Man kann Freud sicherlich nicht vorwerfen, dass er kein radikaler Kritiker des bewussten Denkens war. Sobald es aber um die Gesellschaft, deren Regeln und Werte ging, in der Freud selbst lebte, war er von Grund auf ein Reformist. Er hatte die gleichen Einstellungen, wie sie die liberale Mittelklasse im allgemeinen vertrat, nämlich dass diese Welt die beste von allen sei, aber dass sie noch verbessert werden könne. Es könnte zum Beispiel noch längere Zeiten des Friedens geben, oder die Gefangenen könnten noch besser behandelt werden. Die Mittelklasse stellte aber nie radikale Fragen; sie fragte zum Beispiel nie – um bei der Kriminologie zu bleiben – nach dem Zusammenhang zwischen dem ganzen kriminologischen System des Strafens und seiner Verankerung in der Klassenstruktur. Ist der Kriminelle nicht deshalb kriminell, weil es für ihn keinen anderen Weg gibt, um zu einem Optimum an Befriedigung zu kommen? Ich will hier nicht das Stehlen und Rauben verteidigen. Dennoch ist unser ganzes strafrechtliches System in der Gesamtstruktur unserer Gesellschaft verankert, die es als selbstverständlich und gegeben ansieht, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen – wie man gebildet sagt – unterprivilegiert ist oder dass – wie man ehrlicher sagen müsste – die Minderheit überprivilegiert ist. Eine gleiche Linie verfolgte man mit dem nicht-radikalen Pazifismus: Man war für eine Reduktion der Armeen und schloss Verträge ab, die den Frieden sichern sollten. In ähnlicher Weise wurde auch die Psychoanalyse zu einer Bewegung, bei der man mit Hilfe einiger Reformen im Bewusstsein das Leben verbessern wollte, ohne radikal nach den Werten und der Struktur der bestehenden Gesellschaft zu fragen.
Freuds Sympathien waren auf Seiten der Regierenden, beim Establishment. Dies lässt sich vielfach belegen. So glaubte er während des Ersten Weltkriegs noch bis 1917, dass die Deutschen gewinnen würden. 1917 war allen, die ein wenig informiert waren und nachdachten, der Glaube an einen deutschen Sieg bereits abhanden gekommen. Freud aber schrieb zu diesem Zeitpunkt noch immer Briefe – ich denke zum Beispiel an einen aus Hamburg –, in denen er sich glücklich wähnte, in Hamburg zu sein, weil er in Deutschland von „unseren Soldaten“ und „unseren Siegen“ sprechen konnte. Dies klingt für uns heute geradezu beängstigend, wenn man den phantastischen Effekt und die Signalwirkung in Betracht zieht, die eine solche Äußerung auf das Gewissen gerade der besonders intelligenten und ehrbaren Menschen hatte. Die Bedeutung [XII-266] lässt sich nur richtig begreifen, wenn man die Situation damals mit den schlimmsten Zeiten in Vietnam vergleicht. Es gab zu der Zeit – und darin zeigt sich die ganze Tragik – so gut wie keine Opposition gegen den Ersten Weltkrieg. Die große Mehrheit der deutschen und der französischen Intellektuellen befürwortete den Krieg. Einstein war eine der wenigen Ausnahmen und weigerte sich, den Krieg zu billigen. Vor diesem Hintergrund ist Freuds Äußerung nicht so ungewöhnlich und schockierend, wie sie ohne Berücksichtigung der Umstände klingen würde; doch sie ist immer noch schlimm genug, wenn man in Betracht zieht, zu welcher Zeit sie gemacht wurde und dass sie von einem Menschen stammt, der sich 1925 in einem Briefwechsel mit Einstein einen „Pazifisten“ nannte.
Als Freud in Berichten von Patienten hörte, dass diese verführt wurden – die Mädchen von ihren Vätern, die Jungen von ihren Müttern –, glaubte er zunächst, dass diesen Berichten wirkliche Vorkommnisse entsprachen. Und nach allem, was ich weiß, war dies vermutlich auch so. Sándor Ferenczi kam am Ende seines Lebens zu der gleichen Überzeugung. Freud hingegen änderte schon bald seine Betrachtungsweise und behauptete, dass dies alles Phantasien seien: Die Eltern konnten so etwas nicht getan haben; die Berichte mussten unwahr sein. Kinder würden nur deshalb von diesen Vorkommnissen erzählen, weil sie über ihre eigenen Phantasien sprachen. Sie wünschten sich diese inzestuöse Phantasie, mit dem Vater oder mit der Mutter zu schlafen oder worum es auch ging. Freud sah in diesen Geschichten einen Beweis für die inzesthaften halb-kriminellen Phantasien des Kindes.
Bekanntermaßen ist diese Vorstellung ein Grundstein der psychoanalytischen Theorie: Das Kind, ja schon das Kleinkind, ist bereits mit dem gefüllt, was Freud polymorph-perverse Phantasien genannt hat. Freud sah also im Kind etwas ganz Schlechtes: Das Kind sei so gierig, dass es am liebsten darüber phantasiere, wie es den Vater oder die Mutter verführen könne, um mit ihnen zu schlafen. Dies gab der gesamten psychoanalytischen Betrachtungsweise eine schräge Richtung: Einerseits führte es zu der theoretischen Annahme, dass die inzestuösen Phantasien ein wesentlicher Teil der kindlichen Ausstattung seien. Andererseits führte es bei der Therapie zu der Annahme, dass alles, was ein Patient in dieser Hinsicht einbringt, seinen eigenen Phantasien zuzuschreiben ist und deshalb nicht ein reales Vorkommnis wiedergibt, sondern analysiert werden muss.
Freud war im Kern davon überzeugt, dass das Kind schuldig ist und – ich ergänze – nicht die Eltern. Dies kommt in Freuds eigenen Fallgeschichten deutlich zum Vorschein. Ich selbst habe diese Sicht Freuds zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen in der Fallgeschichte vom „Kleinen Hans“ aufgezeigt (Der Ödipuskomplex. Bemerkungen zum „Fall des kleinen Hans“, 1966k, GA VIII, S. 143-151); sie lässt sich bei allen Fallgeschichten nachweisen. Die Eltern werden bei Freud immer in Schutz genommen, auch wenn sie offensichtlich noch so selbstsüchtig, widerstreitend und feindselig sind. Die Schuld und die Last liegen immer auf Seiten des Kindes. Das Kind mit seinen inzesthaften Phantasien ist nicht nur inzestuös, es will auch den Vater umbringen und die Mutter vergewaltigen. Für Freud war das Kind ein kleiner Krimineller.
Diese Sicht des Kindes bei Freud muss man dynamisch als Folge seiner Verteidigung der Eltern und der Autorität verstehen. Betrachtet man das Leben der meisten Kinder [XII-267] näher, lässt sich erkennen, dass die „Elternliebe“ eine der größten Fiktionen ist, die jemals erfunden wurde. Gewöhnlich wird mit der Elternliebe, wie Ronald Laing ganz zutreffend gesagt hat, nur die Gewalt vertuscht, die die Eltern über das Kind ausüben möchten. Natürlich gibt es echte Ausnahmen, und ich kenne auch einige wirklich liebende Eltern. Wenn man aber aufs Ganze gesehen die Geschichte des Umgangs der Erwachsenen mit den Kindern durch die Jahrhunderte verfolgt und wenn man sich die Lebensgeschichte der Menschen von heute ansieht, dann haben zumindest ich und einige andere gesehen, dass das Hauptinteresse der meisten Eltern in Wirklichkeit das Ausüben von Herrschaft ist. Ihre Liebe ist ganz seltsamer Natur, eine Art sadistischer Liebe nach dem Motto: „Ich will ja nur dein Bestes!“ Sie lieben die Kinder in dem Maße, in dem diese sich nicht gegen die elterliche Bevormundung wenden.
Die Art, wie die Eltern ihre Kinder lieben, entspricht dem Verständnis der Liebe des Mannes zu seiner Frau in der patriarchalischen Gesellschaft: Kinder werden als Besitz angesehen. Sie waren seit der Römerzeit Besitz und sind es noch heute. Noch immer haben die Eltern das uneingeschränkte Recht, über ihr Kind zu verfügen. Es gibt inzwischen in einigen Ländern zaghafte Versuche, dies zu ändern und die Möglichkeit vorzusehen, dass Eltern von Gerichts wegen das Erziehungsrecht genommen wird, wenn ernste Gründe dafür sprechen, dass sie unfähig sind, ein Kind großzuziehen. Doch ist hier viel Augenwischerei dabei, denn es dauert lange, bis ein Gericht zu der Entscheidung kommt, dass Eltern unfähig sind; außerdem sind die meisten Richter selbst Eltern und, was die Erziehung betrifft, meist ebenso unfähig wie andere Eltern. Wie sollen sie also entscheiden können?
Sieht man einmal von der halb-instinktiven und etwas narzisstischen Liebe der Mütter zu ihren Säuglingen ab, dann kann man, wie auch Ronald Laing und andere es tun, sagen, dass ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder die ersten Anzeichen eines eigenen Willens bekunden, die Tendenz dominiert, über die Kinder zu herrschen und sie zu besitzen. Für die meisten Menschen bedeutet das Kinderhaben, dass sie sich selbst mächtig erleben, Herrschaft ausüben können, sich wichtig vorkommen, etwas bewegen können, sich so fühlen, dass sie etwas zu sagen haben. Ich zeichne hier kein böswilliges Bild von den Eltern. Was ich sage, entspricht den Gegebenheiten. In der britischen Oberschicht gab es diesen Fluch über die Kinder im allgemeinen nicht. Die europäische Oberschicht hatte ihre Gouvernanten und Erzieherinnen, und den Müttern waren ihre Kinder völlig egal, denn sie hatten jede Menge anderer Befriedigungen im Leben. Sie hatten ihre Liebesaffären, feierten Partys, interessierten sich für Pferde usw.
Kinder werden wie ein Besitz betrachtet, solange der Wunsch zu haben die beherrschende Qualität der Charakterstruktur von Menschen ist. Es gibt auch Menschen, in denen dieser Wunsch zu haben nicht vorherrschend ist, doch sind sie heute in der Minderzahl. Auch die Kinder sind so sehr daran gewöhnt, der Besitz der Eltern zu sein, dass sie es als gegeben ansehen, zumal die ganze Gesellschaft dies als das Natürliche ansieht. Diesen Konsens gibt es schon seit den Tagen der Bibel. Die Bibel sagt bereits, dass der rebellierende Sohn gesteinigt und getötet werden muss. Wir tun dies zwar heute nicht mehr, doch noch im Neunzehntem Jahrhundert passierte mit einem rebellierenden Sohn Schlimmes. [XII-268]
Die elterliche Liebe ist etwas, für das man viel Sympathie und Mitgefühl, ja selbst Sorge und Mitleid haben kann. Und doch ist sie bei vielen Menschen im besten Fall eine gutartige Besitzhaltung, in der überwiegenden Zahl der Fälle aber ein malignes Besitzen, bei dem geschlagen und verletzt wird. Das Verletzen geschieht dabei auf vielerlei Weisen, ohne dass es als solches bewusst ist: Das Ehrgefühl des Kindes wird verletzt, die stolze Selbstachtung wird verletzt, das so sensible und zugleich so intelligente Kind lässt man spüren, dass es ein Einfaltspinsel und dumm sei und nichts verstehe. Selbst manche ganz wohlmeinenden Eltern stellen ihre Kinder zur Schau, wie wenn diese in Gegenwart anderer Menschen kleine Clowns wären. Alles Mögliche wird getan, um das Selbstvertrauen des Kindes zu drücken und sein Gespür für Würde und Freiheit zu unterdrücken.
Freuds Parteinahme für die, die dominieren, für die herrschende Klasse, sein Konformismus mit dem Establishment trug meiner Ansicht nach tatsächlich viel zur Entstellung seiner Theorie über Kinder und auch zur Entstellung seiner Therapie bei. Freud machte den Psychoanalytiker zum Verteidiger der Eltern. Der Analytiker sollte aber eine objektive Betrachtungsweise haben und deshalb die Eltern anklagen. Macht er sich aus dem Geist des Establishments blindlings zum Verteidiger der Eltern, dann tut er dem Patienten nichts Gutes. Um noch genauer zu sein, muss man noch einen Schritt weiter gehen: Man sollte nicht nur die Eltern und das Familiensystem im Auge haben, sondern das gesamte gesellschaftliche System, denn die Familie ist ja nur ein Ausschnitt, ein Beispiel davon.
Wenn ich Freud vorwerfe, dass er das Kind schuldig spricht, dann meine ich natürlich nicht, dass das Kind immer unschuldig ist und die Eltern immer schuldig sind. Selbstverständlich muss man in jedem Einzelfall die gesamte Konstellation im Auge behalten und sich auch fragen, welchen Anteil das Kind an den Reaktionen der Eltern hat. Es gibt Eltern, die gegen einen bestimmten Typ von Kind geradezu allergisch sind. Wenn zum Beispiel eine sehr sensible Mutter, die ein wenig zurückhaltend ist, einen Jungen zur Welt bringt, der aggressiv und etwas grob ist – und so etwas zeigt sich bereits, wenn ein Baby erst acht Wochen alt ist –, dann ist dies das Temperament des Jungen, das diese Mutter nie wird aushalten können, weder bei dem kleinen Kind noch später irgendwann. Dies ist ziemlich schlimm, und man kann weder sagen, dass der Junge dafür verantwortlich ist, denn er ist eben so geboren, noch kann man die Mutter dafür verantwortlich machen, weil sie einfach nicht anders kann.
Es gibt Kinder, die von Anfang an schwierig sind; andere sind von Anfang an sehr arrogant. Freud selbst zum Beispiel war schon als Kind sehr arrogant gegenüber seinem Vater. Er wettete mit seinem Vater um sein Bett und tröstete seinen Vater damit, dass er ihm das schönste Bett der ganzen Stadt kaufen werde, wenn er groß sei. Er kam gar nicht auf die Idee, dass es ihm leidtun und er sich entschuldigen könnte, wie dies die meisten Kinder tun würden, derart eingenommen war er von sich. Für manche Väter wäre dieses arrogante Verhalten ihres Jungen absolut unerträglich. Die Kinder tragen also sehr wohl auf Grund ihres Soseins einiges zu den Verhaltensreaktionen der Eltern gegenüber ihren Kindern bei. Die Annahme, das Kind müsste einem sympathisch sein, weil es ja das eigene Kind ist, ist schlichtweg eine Fiktion. Immer noch ist es das Lotteriespiel der Gene, die hier am Werk sind, und man ist nicht immer der Gewinner [XII-269] bei diesem Lotteriespiel. Davon aber abgesehen, kommt es zu vielen Entwicklungen im Laufe des Lebens eines Kindes, für die die Eltern sehr wohl verantwortlich zu machen sind.
d) Der Stellenwert der Kindheitserfahrungen im therapeutischen Prozess
Es ist meine Überzeugung, dass ein Großteil der Prägung in den ersten fünf Lebensjahren stattfindet und dass diese Jahre deshalb für die Entwicklung eines Menschen besonders wichtig sind, doch bin ich auch davon überzeugt, dass viele andere Dinge, die sich später ereignen, ebenso wichtig sind und den Menschen verändern können.[3]
Ich unterscheide mich hier von Freud und seiner Theorie des Wiederholungszwangs, derzufolge sich die wichtigsten Dinge in den ersten fünf Lebensjahren ereignen und alles, was danach passiert, reine Wiederholung des Früheren ist. Eine solche Vorstellung ist mir zu mechanistisch. Meiner Ansicht nach wiederholt sich im Leben gar nichts; nur mechanische Dinge können sich wiederholen. Alles, was sich ereignet, führt dazu, dass sich etwas ändert, wenngleich ich einschränkend den konstitutionellen Faktor unterstreichen möchte. Freud trug den konstitutionellen Faktoren theoretisch Rechnung, doch die meisten Psychoanalytiker und vor allem die Öffentlichkeit glauben, dass das, wozu ein Mensch wird, nur das Ergebnis dessen sei, was seine Eltern ihm antaten. Auf diese Weise kommt es dann zu so rührseligen Geschichten, wie man sie oft in Psychoanalysen finden kann: „Mein Vater liebte mich nicht, meine Mutter liebte mich nicht, meine Großmutter liebte mich nicht, und deshalb bin ich ein so schwieriger Mensch geworden.“ Die Schuld den Bezugspersonen zuzuschieben, ist natürlich die allereinfachste Lösung.
Es lässt sich immer zeigen, dass es für die Entwicklung eines Menschen bereits bestimmte Elemente in seiner Kindheit gibt, die den Grund für später legen; andererseits aber verstärken oder schwächen spätere Ereignisse diese Elemente. Man kann nicht sagen, dass spätere Ereignisse nicht ihren Beitrag leisten. Ich vertrete prinzipiell die Auffassung, dass frühere Ereignisse einen Menschen zwar nicht determinieren, aber ihn geneigt sein lassen: Nichts von dem, was früher passierte, hat meiner Meinung nach eine notwendig determinierende Kraft, aber es richtet ihn in eine bestimmte Richtung aus, und je länger jemand in diese Richtung geht, desto mehr ist er geneigt, eben dieser Richtung zu folgen, so dass es schließlich nur noch durch ein Wunder zu einer Änderung seiner Richtung kommen könnte.
Die Psychoanalyse zielt darauf ab, zu Einsichten in jene unbewussten Prozesse zu gelangen, die den Patienten aktuell zum Zeitpunkt der Psychoanalyse bestimmen. Als solche ist die Psychoanalyse keine historische Forschung. Es geht ihr vielmehr darum, wie bei einer Röntgenaufnahme zu erkennen, was jetzt im Patienten unbewusst, sozusagen hinter seinem Rücken, vor sich geht. Freilich kann der Patient selbst dies oft nur verstehen, wenn er einige Kindheitserlebnisse wieder-erfahren kann, denn sie sind es, die ihn im Moment beeinflussen oder sich in besonderer Weise auswirken, ohne dass er sich dessen bewusst ist. Manchmal geschieht dies mit Hilfe der Übertragung, [XII-270] manchmal dadurch, dass sich jemand an etwas anderes aus der Kindheit erinnert, manchmal erinnert sich jemand der Kindheitserlebnisse auch direkt in der Analysestunde (wir haben viele solche Erinnerungen in uns), manchmal taucht ein Kindheitserlebnis im Traum auf.
Es kommt vor, dass in einem Traum etwas auftaucht, das sich schon 30 Jahre zuvor, als der Patient vielleicht 17 Jahre alt war, ereignete. Es geht nun aber in der Analyse nicht um eine historische Erforschung dessen, was damals war; vielmehr ist es das psychoanalytische Ziel, so deutlich wie nur möglich bewusst zu machen, was das Unbewusste jetzt ist. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man jedoch oft, vielleicht sogar in den meisten Fällen, Einblick gewinnen in das, was der Patient erlebte, als er noch ein Kind oder ein Jugendlicher war. Wenn ich mich selbst analysiere, und ich tue dies jeden Tag, versuche ich absichtlich dem nachzuspüren, wie ich mich in einer bestimmten Frage oder Situation wohl als Fünfjähriger oder Fünfzehnjähriger gefühlt habe. Auf diese Weise versuche ich herauszufinden, welche dieser Gefühle in mir sind. Ich versuche, meine eigene Verbindung zu meiner Kindheit dauerhaft offen und lebendig zu halten, weil ich auf diese Weise das besser erkennen und bewusst machen kann, was jetzt in mir vor sich geht und dessen ich mir nicht bewusst bin. Mir geht es nicht um eine historische Erforschung, sondern um das Jetzt.
Es war Freuds Idee, die wichtigsten pathogenen Erfahrungen aus der Kindheit zu Bewusstsein zu bringen, und zwar nicht nur verstandes- und wissensmäßig, sondern, wenn möglich, affektiv, um auf diese Weise die Symptome zum Verschwinden zu bringen. Was ist daraus geworden? In der Öffentlichkeit und in weiten Kreisen der Psychoanalyse [...] ist daraus das geworden, was man eine „genetische“ Erklärung nennt. Wenn man Analysierte fragt, was denn die Psychoanalyse gezeigt habe, kann man oft die Formel und Logik hören: „Ich bin dies und jenes“ oder „Ich habe dies und jenes, weil...“ – und dann folgt eine kausale Erklärung historisch-genetischer Natur. Diese aber hat als solche keinerlei heilenden Wert. Wenn man weiß, warum etwas geschah, dann ändert sich durch dieses Wissen allein noch gar nichts.
Auch wenn dies nicht ohne weiteres zu verstehen ist, so möchte ich doch die Aufmerksamkeit auf folgenden Unterschied lenken: Wenn ich in mir etwas erfahre, das verdrängt war und plötzlich auftaucht, so dass ich seiner gewahr werde, dann ist dies etwas völlig anderes, als historische Rekonstruktionen darüber anzustellen, wie dieses oder jenes sich ereignete. Weil aber diese ursprünglichen Erfahrungen so selten wiedergefunden werden, so dass sie im wahren Sinne des Wortes wieder in Erinnerung „gerufen“ sind, gibt man sich mit einer Konstruktion zufrieden: Es muss so etwas stattgefunden haben, es hat vermutlich stattgefunden – und weil es stattgefunden hat, bin ich so oder so geworden. In Wirklichkeit ist ein solcher Rekonstruktionsversuch völlig nutzlos. Wenn jemand am Ertrinken ist und die Gesetze der Schwerkraft kennt, dann ertrinkt er dennoch [...].
Die Kindheitserfahrung hat nur in dem Maße Bedeutung, als sie wieder-erfahren und zurückgerufen wird. Darüber hinaus verhilft die Kenntnis der Kindheit zu einem leichteren Verstehen dessen, was jetzt vor sich geht, weil man von der Theorie her zu einigen Annahmen über die Bedingungen in der Kindheit und zu dem kommen kann, was man auf Grund dieser Kindheit erwarten kann. [XII-271]
Entscheidend ist nicht der historisch-genetische Zugang, sondern das, was ich den Zugang über eine „Röntgenaufnahme“ nenne. Es geht um die Erkenntnis der Kräfte, die mich jetzt in diesem Augenblick antreiben oder mich bzw. jemand anderen motivieren. Ich benütze den Vergleich mit der Röntgenaufnahme, weil es darum geht, etwas zu sehen, was sich bei normaler Betrachtungsweise nicht sehen lässt. Bei einer Röntgenaufnahme der Brust zum Beispiel, kann man auch die Tuberkulose sehen, die jemand vor 20 Jahren gehabt haben kann. Dies lässt sich an den Narben im Gewebe erkennen. Es ist aber uninteressant, was in den Lungen des Menschen vor 20 Jahren vor sich ging; es interessiert vielmehr, was jetzt mit der Lunge dieses Menschen ist und ob sich aktuell eine Änderung beobachten lässt, die man über das Röntgenbild feststellen kann. Wer deshalb mit Hilfe der Psychoanalyse oder auch für sich allein und ohne die Hilfestellung durch eine Psychoanalyse etwas verstehen will, für den gilt immer, sich an erster Stelle zu fragen, was jetzt unbewusst vor sich geht, was sich vermuten lässt, was sich an unbewussten Motivationen, die ihn jetzt bestimmen, erspüren lässt. Es geht nicht um das, was einmal in mir vor sich ging, um damit erklären zu können, was jetzt in mir vor sich geht.
e) Die Rezeption der Psychoanalyse in der therapeutischen Praxis
Die Freudsche Theorie ist bekannterweise wesentlich eine Triebtheorie, das heißt, dass sich alles letztlich von instinkthaften Trieben her bestimmt, auf die dann natürlich die Umwelt ihren Einfluss nimmt. So sehr nun die Psychoanalytiker hinsichtlich ihrer Theorie beinahe auf Seiten des Instinktivismus stehen, so sehr ist die Praxis der Psychoanalytiker, und zwar auch der Freudianer, eigentlich eine umweltorientierte. Grob gesprochen folgen sie immer dem gleichen Schema: Jedes Kind ist das, was die Eltern aus ihm gemacht haben. Es ist ganz und gar der Einfluss der Umwelt, der das Schicksal eines Menschen bestimmt, und nicht das, was Freud die konstitutionellen Faktoren nennt. Freud selbst war hier sehr viel vorsichtiger als die Freudianer. Freud sieht ein Kontinuum zwischen den konstitutionellen Faktoren, also zwischen dem, womit wir auf die Welt kommen, den Erbfaktoren, und den Umweltfaktoren, wobei das Gewicht des einen oder anderen von Fall zu Fall verschieden ist. Es gibt Menschen, bei denen die konstitutionellen Faktoren ein sehr viel größeres Gewicht haben; bei anderen sind die Umweltfaktoren stärker. Immer aber bilden beide eine kontinuierliche Reihe, bei der auf der einen Seite die Konstitution steht und auf der anderen die Umwelt.
In der psychoanalytischen Praxis und in der Öffentlichkeit gibt es eine schlichte Gleichung, bei der die konstitutionellen Faktoren auf der Strecke bleiben, so dass alles nur das Ergebnis der Umweltbeeinflussung ist. Dies führt dann auf der einen Seite dazu, dass den Eltern für jedes und alles, was geschieht, die Verantwortung zugeschrieben wird. Es stimmt schon, dass sie für vieles verantwortlich sind, aber nicht für alles. Wenn die Eltern dann noch Kurse in Psychoanalyse besucht haben, fürchten sie sich gar, ihre Kinder oder ihre Söhne zu küssen, denn dadurch käme es zu einem Ödipuskomplex, ebenso wie sie Angst haben, noch eine feste Meinung zu vertreten, weil sie dann ja autoritär seien und dies eine Neurose verursachen würde. [XII-272]
Auf der anderen Seite führt die einseitige Betonung der Umweltfaktoren bei den Analysanden zu dem entlastenden Gefühl, dass sie für gar nichts verantwortlich sind, denn sie sind ja nur, was die Eltern unglückseligerweise aus ihnen gemacht haben, und daran können sie nichts ändern, außer dass sie zur Psychoanalyse gehen, wo sie dann endlos darüber reden können, was die Eltern ihnen antaten, was aber auch nicht notwendigerweise zu einer Änderung führt.
In Wirklichkeit gibt es eine permanente Wechselwirkung zwischen den Eltern, der Konstitution eines Menschen und den Reaktionen dieses Menschen auf das, was die Eltern tun. Ein Kind mit vier oder fünf Jahren hat bereits seine eigenen Reaktionsweisen, so dass man nicht mehr einfach sagen kann: „Ich bin so geworden, weil meine Mutter so zu mir war.“ Sicherlich waren die Mutter oder der Vater oder die Umwelt die wesentlichen determinierenden Einflüsse, aber gleichzeitig – und dies ist sehr wichtig – muss man sich fragen, was dieser Mensch getan hat, diesen Einflüssen nicht einfach zu erliegen. War er sozusagen nur ein Stück Wachs? War er ein völlig leeres Blatt Papier, auf das seine Eltern ihren Text schrieben? Hatte er als Kind nicht auch Möglichkeiten, sich anders zu entscheiden? War er ohne jeden eigenen Willen? Ist er ganz und gar durch die Umstände bestimmt?
Die populäre Vorstellung von Psychoanalyse, bei der der Mensch nur das Ergebnis seiner Eltern und Umwelteinflüsse ist, unterscheidet sich nicht sehr von der Skinnerschen Theorie, denn sie läuft in Wirklichkeit auf die Behauptung hinaus, ein Mensch sei in dieser oder jener Weise konditioniert, und dies sei dann der Grund, warum er so geworden ist. Allerdings macht sich Skinner erst gar nicht die Mühe, herauszufinden, was in der black box drin ist, was also im Innern dieses Menschen vor sich geht und zwischen dem konditionierenden Faktor und dem Ergebnis, also dem Verhalten des Menschen, vermittelt. Skinner hat dafür kein Interesse, wie er auch sonst für alles, was nicht zur Manipulation des Menschen dienstbar gemacht werden kann, kein Interesse zeigt. Fügt man diese „Spitzfindigkeit“, diesen theoretischen Gesichtspunkt der Freudschen Schule noch hinzu, dann läuft dies auf die Feststellung hinaus, dass wir auf eine bestimmte Weise konditioniert wurden, so dass der analytische Prozess von einem Skinnerschen Standpunkt aus als ein großer Versuch der „Dekonditionierung“ betrachtet werden kann: Die Mutter sagte: „Ich liebe dich, wenn du mich nicht verlässt.“ Entsprechend sagt dann der Analytiker: „Sie sind ein guter Patient, wenn Sie die Mutter verlassen.“ Dauert diese Art Dekonditionierung einige Jahre lang an, dann kann der Patient schließlich ein anderes Konditionierungsset akzeptieren; der Patient wird dann dazu gebracht, seine Mutter zu verlassen, doch hängt er sich an den Analytiker an, so dass es zu einer verlängerten sogenannten Übertragung kommt. Und wenn es schließlich keinen Vorwand mehr gibt, unter dem die Analyse fortgesetzt werden kann, bindet er sich an jemand anderen.
Viele Menschen wechseln, wenn sie heiraten, nur von ihrer Mutter zu ihrer Frau; der Ehepartner oder eine andere Mutterfigur oder Autoritätsperson wird nur als Ersatz gewählt. In der Politik geht es nicht anders: Man schafft Abhängigkeitsstrukturen, so dass die Menschen ein Bedürfnis nach Größen entwickeln, von denen sie sich abhängig machen können. Sie wechseln höchstens die Abhängigkeiten. Doch was nötig wäre, nämlich sich unabhängig zu machen, das tun sie nicht. Das Problem der Abhängigkeit [XII-273] ist ein großes Problem, und zwar nicht nur bei der Freudschen Therapie; es taucht in allen analytischen Therapien auf.
Die besondere Betonung der konditionierenden Faktoren, also von dem, was die Menschen zu dem gemacht hat, was sie jetzt sind, hat dazu geführt, dass die wichtigen Fragen vernachlässigt wurden. Und diese lauten: Was kann jemand machen, um sich aus seiner verfahrenen Situation wieder zu befreien? Wie könnte er anders handeln? Wie kann jemand von jenem Rest an Freiheit Gebrauch machen, den jeder noch hat? Die entscheidende Frage freilich lautet: Was kann jemand jetzt tun? Und diese Frage ist nicht vom Alter abhängig, ob jemand 50 oder 70 Jahre alt ist. Ich habe eine Patientin gehabt, die durch die Psychoanalyse mit 70 Jahren ihr gesamtes Leben verändert hat. Allerdings war sie eine sehr lebendige Frau, lebendiger, als die meisten Menschen mit 20 Jahren sind.
Für Freud spielten die konstitutionellen Faktoren, also das, was ein Mensch als Anlage mitbringt, eine Rolle. Ein Großteil der Psychoanalyse hat sich – nicht in der Theorie, sondern in der Praxis – zu einer konditionierenden Therapie entwickelt, bei der die Verantwortung des Betroffenen nicht betont wird. Mir geht es nicht um die Frage, um die es in den meisten Psychotherapien hauptsächlich geht: „Warum bin ich so geworden, wie ich bin?“ Mir geht es darum, dass sich der Patient nach Art einer psychologischen Röntgenaufnahme fragt: „Wer bin ich?“ Solange jemand nur fragt, warum er so geworden ist, wie er ist, weiß er noch nicht, wer er ist.
f) Der Beitrag Harry Stack Sullivans zum Menschenbild der Psychoanalyse
Sullivan begann seine Arbeit mit Psychotikern auf eine sehr interessante und überzeugende Art und Weise. Als er am St. Elizabeth Krankenhaus in Washington arbeitete, bat er um Erlaubnis für ein Experiment. Er wollte eine eigene Station für seine Patienten sowie – dies war die Bedingung – Krankenpfleger, die er selbst auswählte und anleitete, um einen humanen Umgang mit den Patienten zu gewährleisten. Damals gab es noch keine Psychotherapie und auch keine Pharmakotherapie. Sullivan setzte nur seine eigene Persönlichkeit im Umgang mit den Patienten, das heißt, seine enorme Achtung vor psychotischen Patienten, und ein anderes Verhalten ihnen gegenüber ein. Das Ergebnis war eine bemerkenswerte Erhöhung der Rate an Spontanheilungen. Allein die Tatsache, dass diese Patienten nicht falsch behandelt und nicht gedemütigt wurden, sondern als menschliche Wesen angesehen wurden, führte dazu, dass es sehr viel mehr Patienten wieder gut ging. Allein dies war schon ein schlagender Beweis dafür, dass eine Psychose nicht nur etwas Physisches und Organisches ist, sondern ein psychologischer Prozess, bei dem eine psychologische Veränderung bereits eine Heilung bewirken kann bei einem Patienten, dessen Zustand sich in einem psychiatrischen Krankenhaus des Staates zur damaligen Zeit nur verschlechtert hätte und der zu einem chronischen Psychotiker geworden wäre.
Die Bedeutung Sullivans liegt theoretisch darin begründet, dass er nicht die Libido und den Sexualtrieb, sondern die tatsächlichen persönlichen Beziehungen eines Menschen zu einem anderen, also die „zwischenmenschlichen Beziehungen“ für [XII-274] entscheidend hielt. Während Freud glaubte, dass das sexuelle Angezogensein des Kindes, also der sogenannte Ödipuskomplex, das Kernproblem sei, war dies für Sullivan und den Kreis um ihn gar nicht das Hauptproblem, ja sie sahen darin nicht einmal ein Problem. Sullivan fragte, was an den persönlichen Beziehungen innerhalb einer Familie so besonders und pathologisch war, dass sie schizophrenogen wirkten, also eine Schizophrenie hervorbrachten. Zu dieser Frage gibt es – auch unabhängig von Sullivan – ausgezeichnete Untersuchungen. Bei diesen Untersuchungen haben Ronald Laing, aber auch andere, herausgefunden, dass die schizophrenogene Familie gerade keine besonders bösartige Familie ist, in der das Kind in besonderer Weise misshandelt wird, sondern eine Familie, in der absolute Langeweile herrscht, in der es nur Leere und Leblosigkeit gibt und in der man keine echten Beziehungen zueinander findet, so dass das Kind in seinem Bedürfnis nach persönlichem Kontakt verhungert.
Sogar Tierexperimente können bestätigen, dass ein Kind für die weitere Entwicklung großen Schaden nimmt, wenn es nicht von Anfang an einen physischen Kontakt zu seiner Mutter oder zu einer mütterlichen Ersatzfigur hat. Dieser Kontakt ist ein vitales Bedürfnis des Kindes. Jeder weiß dies und hat es akzeptiert, doch viele Menschen vergessen, dass das Bedürfnis nach dieser Art von zwischenmenschlicher Stimulation, auf die das Kind reagieren kann, genauso groß ist und noch viel länger andauert als das ursprüngliche Bedürfnis nach physischem Kontakt mit der Mutter. Fällt diese zwischenmenschliche Stimulation aus, dann führt dies zwar nicht zu derart tief reichenden physiologischen Folgen, dass das Kind stirbt, wie dies René Spitz von Kindern beschrieben hat, denen es an tiefem physischem Kontakt fehlte. Dennoch hat das weitgehende Fehlen der zwischenmenschlichen Stimulation zur Folge, dass das Kind so zerbrechlich, so schizoid, so unbezogen wird, dass es beim Überschreiten eines bestimmten Spannungszustandes zusammenbricht und manifest schizophren wird.
Harry Stack Sullivan entwickelte erstmals eine Therapie, die nicht auf einem Verständnis von Schizophrenie als einer im wesentlichen organischen Krankheit aufbaute; vielmehr verstand er sie als das Ergebnis eines psychologischen Prozesses.
Dies war nicht nur in der Psychiatrie Neuland, sondern natürlich auch eine der größten Änderungen der Freudschen Theorie, denn Freud erklärte, dass dem psychotischen Patienten nicht geholfen werden könne. Der Psychotiker lasse sich nicht analysieren, weil er nach Freud so narzisstisch sei, dass er keine Übertragung herstellen und deshalb mit dem Therapeuten in keine Übertragungsbeziehung eintreten könne. Sicherlich lässt sich auch meiner Meinung nach der Psychotiker als ein Mensch mit einem extrem großen Narzissmus definieren, so dass für ihn nur das real ist, was in ihm ist, was seine eigenen Vorstellungen betrifft, was mit seiner eigenen Person zu tun hat, und den scheinbar nichts trifft, was mit der Außenwelt zu tun hat. Ein schizophrener Patient ist aber zur gleichen Zeit oft ein äußerst sensibler Mensch und oft sehr wohl imstande, auf Menschen zu reagieren. Allerdings müssen die, die mit ihm zu tun haben, empfindsamer sein können als der Durchschnitt. Dann wird der Schizophrene reagieren und in den meisten Fällen antworten. Selbst Patienten mit schweren Katatonien wissen, was um sie herum vor sich geht, und antworten auf die ihnen eigentümliche Weise. Sie können einem später, wenn sie aus der Katatonie heraus sind, berichten, was sie erlebt haben und wie sie das, was vor sich ging, verstanden hatten. [XII-275]
Sullivan und seine Richtung der Psychoanalyse gaben erstmals dem Psychotiker seine Würde als ein ebenbürtiges menschliches Wesen wieder. Nur während der Französischen Revolution waren bis dahin psychotische Patienten aus ihren Ketten befreit worden. Es stimmt zwar, dass die Geisteskranken in den heutigen psychiatrischen Einrichtungen nicht mehr angekettet sind, doch in der Einschätzung der Psychotiker hat sich nicht viel geändert. Noch immer werden die Psychotiker von den meisten der herkömmlichen Psychiater wie etwas Abgekapseltes, wie ein völlig anderer Mensch, wie jemand dort drüben angesehen. Nur wenige Psychiater sind fähig zu spüren, dass in jedem von uns etwas Schizophrenes ist, genauso wie in jedem von uns etwas von einem manisch-depressiven Menschen steckt und wie jeder von uns ganz sicher etwas Paranoides in sich hat, denn gerade bei der Paranoia ist es nur eine Frage der Stärke. Bis zu einem bestimmten Punkt nennen wir jemanden noch normal; halten wir ihn nicht mehr aus, dann nennen wir ihn krank. Keiner dieser psychotischen Zustände ist wirklich so verschieden und schafft tatsächlich tiefe Gräben zwischen den Menschen. Deshalb hat ein psychotischer Patient nichts Unmenschliches oder Entmenschlichtes an sich, das ihn vom sogenannten normalen Patienten unterschiede.
g) Die Krankheit unserer Zeit als Herausforderung für die Psychoanalyse
Traditionell versteht sich die Psychoanalyse vor allem als ein therapeutischer Prozess für Menschen, die krank sind. Wenn jemand zwanghaft an allem zweifeln muss oder wenn jemand an einer psychogenetischen Lähmung seines Armes leidet, dann sind dies gewichtige Symptome. Die Psychoanalyse ist aber nicht die einzige Methode, mit der man von Symptomen befreien kann. Ich war in Lourdes und habe viele Menschen gesehen, die von Lähmungen und anderen schweren Symptomen auf Grund ihres Glaubens geheilt wurden. Zweifellos werden diese Menschen wirklich geheilt. Heute werden viele Methoden angepriesen, mit denen Menschen von ihren Symptomen befreit werden. Sie haben alle möglichen Namen, und soweit es darum geht, dass Menschen von ihren Symptomen befreit werden, sind viele dieser Methoden auch gut.
Man kann Menschen auch mit Hilfe von Terror heilen. Im Ersten Weltkrieg machte der deutsche Arzt Kaufmann die Entdeckung, dass Soldaten mit einer Kriegsneurose mit Schrecken und Panik durch einen Elektroschock, bei dem ihr Körper tief getroffen wurde, von ihrem Symptom befreit werden konnten. Die „Kaufmann-Behandlung“ wurde als medizinische Behandlung ausgegeben, in Wirklichkeit war sie die reine Folter, bei der Kaufmann sich den Umstand zunutze machte, dass die Angst vor der Folter größer war als die Angst und Panik, wieder in den Schützengraben zu müssen. Hier wurden die Symptome mit Hilfe einer Terrormethode beseitigt. Was er freilich bei den Soldaten anrichtete, wenn er den einen Schrecken durch einen noch größeren Schrecken austrieb, das interessierte weder den Dr. Kaufmann und noch weniger die Armee.
Viele Symptome können auch oder ausschließlich mit Hilfe der Psychoanalyse geheilt werden. Hierzu gehören alle Arten von Zwangssymptomen und bestimmte [XII-276] hysterische Symptome. Manchmal geht die Auflösung des Symptoms sogar sehr leicht. Für das folgende einfache Beispiel benötigte ich nur einige Stunden psychoanalytischer Behandlung, um das Symptom aufzulösen. Eine Frau klagte über ihr Symptom, nach dem Verlassen ihres Hauses immer von der Zwangsidee verfolgt zu werden, dass sie das Gas angelassen habe oder etwas anderes, so dass es zu einem Brand gekommen sei. Wo immer sie auch war, sie spürte den Zwang, nach Hause zurückzukehren, um zu prüfen, dass kein Brand entstanden war. Wenn man so darüber spricht, klingt dies gar nicht so schlimm, aber in der Realität wirkte es sich völlig destruktiv auf ihr ganzes Leben aus, weil sie praktisch das Haus nicht mehr verlassen konnte. Sie musste zurück, das Symptom war unüberwindbar. Dann sprach sie über ihre Vergangenheit und erwähnte dabei, dass sie vor vier oder fünf Jahren eine Krebsoperation hatte. Der nicht gerade sehr einfühlsame Chirurg hatte ihr damals nach der Operation gesagt, dass die Gefahr für den Augenblick beseitigt sei, doch es könnte zu einer Metastasenbildung kommen und der Krebs könnte sich wie ein Feuer ausbreiten. Dies war freilich eine äußerst beängstigende Aussicht. Für jeden in ihrer Situation wäre es dies gewesen. Sie hatte deshalb furchtbar Angst. Es gelang ihr, die Angst, der Krebs könnte sich ausbreiten, in die Angst zu übersetzen, Feuer könnte sich ausbreiten. Auf diese Weise hatte sie keine Angst mehr vor dem Krebs, dafür aber vor dem Feuer. Und während sie von dieser Angst kaputt gemacht wurde, war das Symptom ein Heilungsversuch von einer noch schlimmeren Angst.
Da die Chancen für eine Wiederkehr des Krebses mit Metastasenbildung fünf Jahre nach der Operation relativ gering waren und die Frau mich am Ende dieses Zeitraums aufgesucht hatte, ergab es sich, dass sie ihre Angst vor dem Feuer verlieren konnte, ohne dass sie sich vor dem Krebs fürchten musste. Allerdings ist es zweifelhaft, ob man ihr drei Jahre früher etwas Gutes getan hätte, die Angst vor dem Feuer zu durchschauen, denn wenn sie sich dessen bewusst geworden wäre, wäre ihre Angst vor dem Krebs wieder zurückgekehrt, und die wäre bei weitem schmerzlicher und störender geworden als ihre Angst vor dem Feuer. – Das Beispiel zeigt, wie ein einfaches Symptom sofort verschwinden kann, sobald es übersetzt und mit dem in Verbindung gebracht wird, was diese Frau wirklich ängstigt. Die meisten Symptome sind weitaus komplizierter, doch ich würde insgesamt sagen, dass dort, wo die Psychoanalyse zur Therapie von Symptomen benützt wird, sie völlig ausreicht.
Zur Zeit Freuds suchten die meisten Menschen den Psychiater auf, weil sie an Symptomen litten, vor allem an hysterischen Symptomen. Heute hat sich die Situation grundlegend geändert. Hysterische Symptome sind sehr selten geworden. Der hier beobachtbare Wandel hinsichtlich der Erscheinungsweisen von Neurosen geht Hand in Hand mit dem Wandel der kulturellen Muster. Die Hysterie ist ein großer Gefühlsausbruch. Wer eine hysterische Person beobachtet mit dem ganzen Hervorbrechen der Gefühle, dem Schreien und Weinen, wird unwillkürlich an die großen Redner im letzten Jahrhundert erinnert, an die Ergüsse in Liebesbriefen und an anderes, das uns heute, wenn wir es im Kino sehen, ganz komisch vorkommt, weil wir einen anderen Lebensstil haben. Wir orientieren uns an Tatsachen und zeigen nicht viele Gefühle. Entsprechend sind die Symptome heute anders: Es gibt schizoide Symptome, Symptome des Fehlens von Verbundenheit mit anderen Menschen und deren Folgen. [XII-277]
Zur Zeit Freuds hatten die Menschen noch Symptome, nicht nur hysterische, sondern auch Zwangssymptome und andere, kennzeichnend aber war, dass sie mit massiven Symptomerkrankungen zum Psychiater kamen und ihr Kranksein mit den Symptomen beweisen konnten. Heute leiden die meisten Menschen, die zu einem Psychoanalytiker gehen, an dem, was man die malaise du siècle nannte, an einem Unbehagen, das für unser Jahrhundert charakteristisch ist. Dabei liegen keinerlei Symptome vor, nicht einmal Schlaflosigkeit, dafür aber ein Gefühl, unglücklich zu sein, ein Gefühl von Fremdheit; das Leben hat keinen Sinn, keinen Geschmack, es treibt so dahin; es existiert ein Gefühl unbestimmten Unbehagens. Viele Menschen kommen mit der Erwartung, dass die Psychoanalyse dies ändern kann. Man nennt dies im Unterschied zur Symptomanalyse Charakteranalyse, also die Psychoanalyse des gesamten Charakters. Die Krankheit lässt sich nicht genau definieren, aber ihr Leiden an der Malaise lässt sich sehr genau erfühlen, wenn man in sich und in andere Menschen hineinschaut.
Man hat diese Art von Psychoanalyse Charakteranalyse genannt, um einen etwas wissenschaftlicheren Namen oder Begriff für jene zu haben, die an dieser Krankheit leiden. Es sind Menschen, die an sich selbst leiden. Es ist alles in Ordnung; sie haben alles, aber sie leiden an sich selbst. Sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen, sie leiden daran, es ist ihnen eine Last und eine Aufgabe, die sie nicht lösen können. Sie können Kreuzworträtsel lösen, aber sie können nicht das Rätsel lösen, das das Leben jedem vorlegt.
Für diese Art von Malaise reicht die Psychoanalyse im klassischen Sinn meiner Meinung nach nicht aus. Sie macht eine ganz andere Art von Psychoanalyse notwendig, weil eine solche Malaise auf die Frage einer radikalen Änderung der gesamten Persönlichkeit hinausläuft. Niemand, der an der Malaise leidet, kann erfolgreich analysiert werden ohne eine radikale Änderung seines Charakters und ohne dessen Umbildung. Kleine Änderungen bewirken überhaupt nichts. Kleine Verbesserungen verbessern auch nichts. Dies lässt sich mit Hilfe der Einsichten der Systemtheorie erklären. Die Persönlichkeit – wie auch eine Organisation – ist ein System, das heißt, sie ist nicht nur die Gesamtsumme der vielen Teile, sondern hat eine Struktur; sobald ein Teil der Struktur geändert wird, berührt dies auch alle anderen Teile, doch die Struktur hat in sich eine Bindekraft, ihre Struktur zu erhalten. Weil die Struktur in sich diese Tendenz trägt, tendiert sie auch dazu, alle Änderungen zurückzuweisen.
Kommt es innerhalb einer Struktur zu kleinen Veränderungen, dann ändert dies nicht viel. Um hierfür ein einfaches Beispiel zu geben: Um die Slums zu verändern, wird immer wieder die Idee verfolgt, in den Slums bessere Häuser zu bauen. Doch was passiert? Nach drei oder fünf Jahren sind diese schönen neuen Häuser genauso heruntergekommen wie die Slum-Häuser, weil die Erziehung die gleiche geblieben ist, weil das Einkommen das gleiche geblieben ist, weil das Gesundheitswesen das gleiche geblieben ist, weil die kulturellen Muster die gleichen geblieben sind. Das ganze System stülpt sich sozusagen über diese kleine Änderung, so dass diese Oase nach einer Weile wieder vom gesamten System inkorporiert ist. Die Slums lassen sich nur ändern, wenn man gleichzeitig das gesamte System völlig ändert: das Einkommen, das Erziehungswesen, das Gesundheitswesen, das Leben der Menschen. Wenn man nur einen Teil [XII-278] ändert, etwa nur die Häuser, dann kann dieser Teil dem Einfluss des gesamten Systems, das nur an seinem eigenen Überleben interessiert ist, nicht widerstehen. Was für das System gilt, gilt auch für die Struktur. Eine Struktur ist als solche an überhaupt nichts interessiert, aber sie hat die Tendenz, sich zu erhalten.
Auch im einzelnen Menschen gibt es eine solche Struktur. Wer versucht, kleine Änderungen vorzunehmen, wird bald merken, dass nach einer Weile die neuen Veränderungen wieder verschwunden sind, so dass sich in Wirklichkeit gar nichts verändert hat. Nur eine grundlegende Umgestaltung des Persönlichkeitssystems wird deshalb auf Dauer eine Veränderung hervorbringen und dann das Denken, das Handeln, das Fühlen, das Sich-Bewegen, ja alles einschließen. Es reicht hierzu bereits ein Schritt, der integriert ist und der das Ganze betrifft; er ist wirksamer als zehn Schritte, die nur in eine Richtung zielen. Übrigens gilt die gleiche Logik auch bei gesellschaftlichen Veränderungen. Auch hier hat eine einzelne Änderung allein keinen andauernden Effekt.
2. Voraussetzungen der psychoanalytischen Therapie
a) Die Fähigkeit zu psychischem Wachstum
Angesichts der heute so weit verbreiteten Charakterneurosen erhebt sich umso dringlicher die Frage: Warum entwickelt sich ein Mensch in eine Richtung, dass er neurotisch und unglücklich wird? Warum kann er nicht das sein, was er zu sein sich wünscht? Warum ist er so wenig glücklich mit seinem Leben?
Meine Überlegungen zu diesen Fragen sind das Ergebnis meiner Beobachtungen des Lebens: Ich gehe von einem allen Menschen, allen Tieren, jedem Saatkorn innewohnenden allgemeinen Gesetz aus, leben zu wollen und ein Optimum an Lust und Befriedigung im Leben zu erhalten. Niemand wünscht sich, unglücklich zu sein, nicht einmal der Masochist, denn für ihn ist der Masochismus jener besondere Weg, auf dem er zu einem Optimum an Lust kommt. Der Grund, warum Menschen gesünder oder weniger gesund sind, warum sie mehr oder weniger leiden, ist in der Tatsache zu sehen, dass die Bedingungen für ihr Wachstum, richtiger gesagt: für ein dem Menschen mögliches Maximum an Wachstum, nicht günstig sind. Zu den Bedingungen für ihr Wachstum gehören die konkreten Lebensumstände, die Fehler, die sie machen, die Irreführungen in ihrem Leben, die vom dritten Lebensjahr systematisch vorhanden sind; manchmal gehören auch konstitutionelle Faktoren dazu und eine besondere Kombination von Umständen. Dieses alles führt dazu, dass sie ihr eigenes Heil auf eine verkrüppelnde Art suchen.
Ich vergleiche die behinderten psychischen Wachstumsmöglichkeiten mit einem Baum in einem Garten. Er wächst zwischen zwei Mauern in einer Ecke und bekommt nur wenig Sonne. Er ist völlig krumm gewachsen, aber er wuchs so unansehnlich, weil es für ihn die einzige Möglichkeit war, Sonnenlicht zu erreichen. Beim Menschen würde man sagen, dies ist ein fürchterlich verwachsener Mensch, weil er durch und durch krumm ist. Gemessen an seinen Möglichkeiten ist er nicht das, was er eigentlich sein sollte. Aber warum ist er so geworden? Nun, er ist so geworden, weil dies die einzige Möglichkeit war, Licht zu bekommen. Eben dies möchte ich damit sagen: Jeder Mensch versucht, Sonne zu bekommen, um im Leben wachsen zu können. Sind aber die Lebensumstände so, dass er dies nicht auf eine eher positive Weise tun kann, dann [XII-280] wird er es auf eine verbogene Weise tun, wobei „verbogen“ hier den kranken Weg symbolisiert. Er ist entstellt, und doch ist er immer ein menschliches Wesen, das alles tut, um eine Lösung für sein Leben zu finden. Dies sollte man nie vergessen.
Trifft man auf einen Menschen, der an dieser Malaise leidet, sollte man auch nie vergessen, dass sich dieser Mensch auf diese Weise entwickelt hat und dass er noch immer nach einer Lösung für sein Leben Ausschau hält. Er ist bemüht, sie zu finden. Man sollte nicht vergessen, dass es viele Umstände gibt, die es ihm extrem schwer machen, die ihn vielleicht sogar dazu bringen, Widerstand zu leisten, weil er sich derart vor jedem Versuch, ihm bei der Änderung seines Kurses zu helfen, fürchtet.
Es ist eine schwierige, ja außerordentlich schwierige Aufgabe, sich selbst zu ändern und eine wirkliche Veränderung des Charakters zu erreichen. Darum bemühten sich alle Religionen, es war und ist das Ziel von Philosophien, schon in der griechischen Philosophie, aber auch in einigen modernen Philosophien. Diesbezüglich macht es keinen Unterschied, ob man vom Buddhismus, vom Christentum, von Judentum, von Spinoza oder von Aristoteles spricht. Sie alle haben Anweisungen herauszufinden versucht, wie der Mensch sich zum Besseren verändern kann und zu einer besseren, höheren, gesünderen, freudvolleren, stärkeren Art zu leben kommen kann.
Die meisten Menschen handeln aus einem Pflichtgefühl heraus, weil sie jemandem etwas schulden. Dies zeigt, dass sie abhängig sind. Sie haben jenen Punkt des Selbstbewusstseins noch nicht erreicht, an dem sie von sich sagen können: „Dies bin ich, dies ist mein Leben, davon bin ich überzeugt, dies fühle ich, ich handle nicht gemäß meiner Laune, denn dies wäre irrational, sondern gemäß dem, was man den rationalen Ausdruck meiner selbst nennen könnte.“ Man könnte auch sagen, ich handle gemäß den wesentlichen Erfordernissen oder den wesentlichen Kräften meiner Persönlichkeit, wobei hier mit „wesentlich“ das gemeint ist, was zum Wesen von mir als Mensch gehört. Und diese Kräfte sind genau das Gegenteil von jenen Trieben, die irrational sind.
Was heißt eigentlich „rational“? Whitehead sagt, dass es „die Funktion der Vernunft ist, der Lebenskunst zu dienen“ (A. N. Whitehead, 1967, S. 4). In meinen eigenen Worten bedeutet dies: Rational sind alle Handlungen und ist jedes Verhalten, womit das Wachstum und die Entwicklung einer Struktur gefördert werden. Irrational sind all jene Handlungen und Verhaltensweisen, die das Wachstum und die Struktur eines Wesens, sei es einer Pflanze oder des Menschen, verlangsamen oder zerstören. Die rationalen Handlungen und Verhaltensweisen sind nach der Darwinschen Theorie ein fester Bestandteil des Überlebenswunsches des Einzelwesens wie der Spezies. Da sie grundsätzlich die Interessen des Einzelnen und der Spezies fördern, sind sie rational. Die Sexualität ist etwas völlig Rationales. Hunger und Durst sind ganz und gar rational.
Das Problem des Menschen besteht darin, dass er nur ganz wenig durch Instinkte bestimmt ist. Wäre der Mensch ein Tier, dann wäre er völlig rational – wie eben jedes Tier ganz rational ist. Wir müssen hier allerdings unsere Denkgewohnheit aufgeben und das Rationale nicht mit dem Intellektuellen verwechseln. Das Rationale hat nicht notwendig nur mit dem Denken zu tun, es bezieht sich in Wirklichkeit genauso auf [XII-281] ein Tun. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Wenn jemand eine Fabrik in eine Gegend baut, wo es kaum und nur teure Arbeitskräfte gibt, und wenn er mehr Arbeitskräfte als Maschinen benötigt, dann handelt er vom Ökonomischen her irrational. Sein Handeln muss ja sein ökonomisches System schwächen und schließlich zerstören, und er wird dies daran merken, dass er nach einem oder zwei Jahren bankrott sein wird. Seit Frederick Winslow Taylor sprechen die Ökonomen von „Rationalisierung“, worunter sie etwas völlig anderes verstehen, als die Psychoanalyse meint. Bei der Rationalisierung im ökonomischen Sinne werden die Arbeitsmethoden so geändert, dass sie vom Standpunkt des optimalen Funktionierens dieser ökonomischen Einheit, nicht vom menschlichen Standpunkt aus, angemessener sind. Hier spricht man also von „rational“.
Was den Menschen betrifft, so sind nicht seine instinktiven Triebe irrational, sondern seine Leidenschaften. Beim Tier gibt es weder Neid, noch hat seine Destruktivität Selbstzweck, noch zeigt es Züge von Sadismus; es will weder ausbeuten, noch hat es den Wunsch, Kontrolle auszuüben. All dies sind Leidenschaften, die es zumindest bei den Säugetieren so gut wie nicht gibt. Beim Menschen entwickeln sie sich, nicht weil sie in seinen instinktiven Trieben wurzeln; vielmehr haben sie ihren Ursprung in bestimmten pathologischen Umweltbedingungen, die diese pathologischen Züge des Menschen hervorbringen. Auch dies soll ein einfaches Beispiel verdeutlichen: Wer aus einem Setzling einer Rose einen voll in Blüte stehenden Rosenstock wachsen lassen will, der muss genau wissen, wie viel Feuchtigkeit, welche Temperatur, welche besondere Art von Erde er braucht und zu welcher Jahreszeit er gesetzt werden muss. Sofern diese Voraussetzungen gegeben sind und es zu keinem Insektenbefall kommt oder andere außerordentliche Umstände eintreten, wird sich dieser Setzling zu einem schönen Rosenstock entwickeln. Wird der Setzling jedoch in eine zu feuchte Erde gesetzt, wird er eingehen; wird er unter nicht optimalen Bedingungen wachsen, dann wird er sich zwar zu einem Rosenstock auswachsen, doch dieser wird beim Wachsen, an den Blüten, an den Blättern, ja überall Mängel zeigen. Der Setzling hat nämlich nur die Möglichkeit, sich voll zu entwickeln, wenn die genannten Voraussetzungen gewährleistet sind, wobei die für diesen Setzling optimalen Wachstumsbedingungen nur durch Erfahrung gefunden werden können.
Was für den Rosenstock gilt, gilt für alle Tiere, wie jeder Züchter weiß, und es gilt auch für den Menschen. Wir wissen, dass auch für das volle Wachstum des Menschen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein müssen. Wenn bei der Entwicklung des Menschen statt Wärme nur Kälte vorherrscht, wenn statt Freiheit nur Zwang herrscht, wenn statt Achtung vor dem Kind nur Sadismus da ist, dann sind die Voraussetzungen für ein volles menschliches Wachstum nicht erfüllt; das Kind wird zwar nicht sterben, aber es wird sozusagen krumm wachsen wie ein Baum, der nicht genügend Sonne bekommt. Jene Leidenschaften, die verbogen und verfälscht sind und die die Folge inadäquater Wachstumsbedingungen sind, sind die irrationalen Leidenschaften des Menschen. Von ihnen gilt, dass sie das innere System des Menschen nicht fördern, sondern die Neigung haben, es zu schwächen, ja schließlich zu zerstören, manchmal sogar durch Krankheit.
b) Die Verantwortung jedes Einzelnen für sein psychisches Wachstumspotenzial
Freud demaskierte das Denken und schuf die Erkenntnis, dass sich Ehrlichkeit nicht dadurch überprüfen lässt, dass man bewusst gute Absichten hat; vielmehr zeigte Freud, dass jemand lügen kann, obwohl er die besten Absichten hat und obwohl er das Gefühl hat, dass er ganz aufrichtig ist. Die Lüge ist ihm nämlich nicht bewusst. Damit gab Freud der Frage der Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und der menschlichen Beziehungen eine völlig neue Dimension. Die herkömmliche Entschuldigung: „Das habe ich nicht so gemeint!“ bedeutet, dass die Wirkung einer Handlung so nicht beabsichtigt war. Seit Freud und seiner Theorie der Fehlleistungen gilt diese Entschuldigung nicht mehr.
Seit Freud stellt sich deshalb auch das moralische Problem neu: Der Mensch ist nicht nur für das, was er denkt, verantwortlich, sondern auch für sein eigenes Unbewusstes. Die Verantwortung des Menschen beginnt bei seinem Unbewussten, alles andere ist Maskerade und ohne Bedeutung. Was ein Mensch glaubt, ist kaum wert, dass man hinhört. Dies klingt reichlich übertrieben, doch manchmal ist es gar nicht übertrieben. Es gibt viele Reden, Versicherungen und Äußerungen, denen man kaum zuhören braucht, weil man spürt, dass sie nur Teil einer Vorgabe und eines Bildes sind, mit dem jemand sich darstellen möchte.
Im Hinblick auf die Therapie, wie ich sie verstehe, ist es wichtig zu sehen, dass der Patient sein eigenes Verantwortungsgefühl und sein eigenes Tätigsein mobilisieren kann. Was heute oft unter Psychoanalyse verstanden wird, geht von folgender Annahme aus, die sich bei vielen Patienten finden lässt: dass die Psychoanalyse eine Methode ist, bei der man durch Sprechen glücklich wird, nicht aber, dass man ein Risiko auf sich nimmt, leidet, aktiv wird und Entscheidungen trifft. So wie aber niemand im alltäglichen Leben durch Reden glücklich wird, so auch nicht in der Psychoanalyse. Niemand wird auf Grund seines Sprechens glücklich, nicht einmal dann, wenn er redet, um Deutungen zu bekommen. Um wirklich eine Veränderung zu erreichen, muss ein Patient einen starken Willen und den Impuls haben, sich zu ändern.
Jeder versucht, einem anderen die Verantwortung zuzuschieben, um sich auf diese Weise der Verantwortung zu entziehen. Wenn ich hier von „Verantwortung“ spreche, dann sage ich dies nicht vom Standpunkt eines Richters aus. Ich klage auch niemanden an. Für mich hat niemand das Recht, anzuklagen oder wie ein Richter zu urteilen. Und doch gilt: Niemand wird gesund, wenn nicht sein Verantwortungsgefühl, sein Mitwirken und auch sein Stolz darauf, dass es ihm bessergeht, wachsen.
Es gibt bestimmte Bedingungen, die einer gesunden Entwicklung des Menschen zuträglich sind, und bestimmte andere Bedingungen, die zu pathologischen Phänomenen führen. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, diese Bedingungen jeweils ausfindig zu machen. Die Bedingungen für eine gesunde Entwicklung des Menschen namhaft zu machen, war ein Anliegen, dessen sich in der Geschichte des Denkens gewöhnlich die Ethik annahm. Die Ethik versucht von ihrem Wesen her jene Normen aufzuzeigen, die zu einer gesunden Entwicklung des Menschen verhelfen.
Sobald man normative Aussagen über den Menschen macht, wenden viele ein, dies [XII-283] seien Werturteile, denn man möchte nicht über notwendige Normen nachdenken. Der Mensch von heute möchte glücklich leben, ohne wissen zu wollen, wie man glücklich lebt. Doch schon Meister Eckhart fragte, wie man die Kunst des Lebens und Sterbens erlernen wolle, ohne jede Art von Anleitung zu bekommen. Dies ist tatsächlich die alles entscheidende Frage. Heute träumen die Menschen vom großen Glück, doch haben sie nicht die leiseste Ahnung, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit sie glücklich werden können oder irgendeine Art von befriedigendem Leben führen können.
Ich habe eine klare ethische Überzeugung und eine klare Vorstellung von dem, wie eine Kultur geschaffen sein muss, dass sie zum Wohl-Sein des Menschen führt. Damit meine ich nicht, dass ich einen detaillierten Plan hätte, wie die Gesellschaft im einzelnen aussehen müsste. So etwas ist praktisch unmöglich, weil je neue Umstände und mit ihnen neue Fakten auftauchen, die dann im einzelnen auch unser Wissen verändern und mit jedem Tag vergrößern. Ich habe bezüglich der Leitwerte dieser Kultur eine ganz klare Vorstellung: In ihr ist der wichtigste Zweck des Lebens die volle Entfaltung des Menschen; es sind nicht die Dinge, die Produktion, der Reichtum, die Reichen; in dieser Kultur wird der Prozess des Lebens selbst tatsächlich als ein Kunstwerk angesehen. Das Leben ist das Meisterstück eines jeden Menschen, bei dem es um ein Optimum an Stärke und Wachstum geht. Das eigene Leben wird als das Wichtigste angesehen.
Die entscheidende Frage ist: Was ist wichtig? Diese Frage wurde im Mittelalter und auch noch im Achtzehnten Jahrhundert anders beantwortet als heute. Damals war man noch davon überzeugt, dass der Mensch und sein Leben der ganze Zweck des Lebens und des Geborenseins sind. Heute ist es nicht mehr wichtig, was ein Mensch aus seinem Leben macht. Heute ist das Wichtigste, erfolgreich zu sein, zu Macht und zu Prestige zu kommen, auf der sozialen Leiter aufzusteigen, Maschinen bedienen zu können. Hinsichtlich seines Menschseins aber stagniert der Mensch, ja die meisten Menschen verschlechtern sich etwas. Auch wenn ihre Fähigkeit, Geld zu verdienen und Menschen zu manipulieren, wächst, so geht es ihnen menschlich nicht besser.
Man lernt nichts und man hat auch keinerlei Erfolg, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass das, was man angeht, ganz wichtig ist. Wer etwas lernen möchte, „weil es ja ganz schön wäre“, wird nie etwas Schwieriges erlernen. Nur wer jeden Tag einige Stunden lang auf dem Klavier übt, kann ein guter Klavierspieler werden. Das Gleiche gilt für eine Tänzerin oder für einen Zimmermann. Sie alle üben stundenlang jeden Tag, weil ihnen das, was sie gewählt haben, das Wichtigste geworden ist. Der Talmud bringt dies auf eindrückliche Weise nahe: Als die Hebräer das Rote Meer durchquerten, sagte Gott zu Moses, er solle seinen Stab heben, und das Wasser werde sich öffnen. So erzählt es die Bibel. Der Talmud jedoch sagt: Als Moses seinen Stab erhoben habe, habe sich das Wasser nicht gespalten. Erst nachdem der erste Hebräer sich in die Fluten gestürzt hatte, noch bevor sich das Wasser geteilt hatte, genau da habe sich das Wasser geteilt. Der entscheidende Punkt ist, dass sich nichts tut, wenn jemand nicht gleichzeitig den Sprung wagt. Solange man sich das, was man erreichen will, nur aus der Ferne anschaut, versteht man gar nichts, und zwar auf keinem Gebiet. Alles ist [XII-284] dann nur aufgesetzt, bekommt keine Struktur, ist ohne Sinn, hat kein wirkliches Gewicht für einen. Später erinnert man sich nur noch, dass es ja ganz schön war, was man gelernt hat, ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem. Was jedoch keine unmittelbare Bedeutung für das Leben hat, ist nicht wert, gelernt zu werden. Da sollte man lieber Fischen, Segeln oder Tanzen gehen, als dass man Dinge lernt, die keinerlei direkte oder indirekte Auswirkung auf das eigene Leben haben.
Mir geht es, bildlich gesprochen, darum zu sagen, dass wer ein Apfelbaum ist, ein guter Apfelbaum werden soll, und wer eine Erdbeere ist, eine gute Erdbeere werden soll. Ich sage nicht, dass jemand ein Apfelbaum oder eine Erdbeere werden soll, denn die Verschiedenheit der Menschen ist außerordentlich groß. Jeder Mensch unterscheidet sich in seinem Dasein in vielerlei Hinsichten vom anderen. Kein Mensch ist nur eine Wiederholung; jeder Mensch ist einzigartig in dem Sinne, dass es niemanden gibt, der ihm exakt gleicht. Es geht nicht darum, Normen zu erschaffen, damit die Menschen sich gleichen, sondern die Norm zu vertreten, dass jeder Mensch ganz aufblüht, zur vollen Geburt kommt, ganz lebendig wird, und zwar unabhängig davon, welche Blume er ist.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959120944
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Oktober)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie therapeutische Technik Zuhören Charakterneurosen Wirkfaktoren therapeutische Beziehung