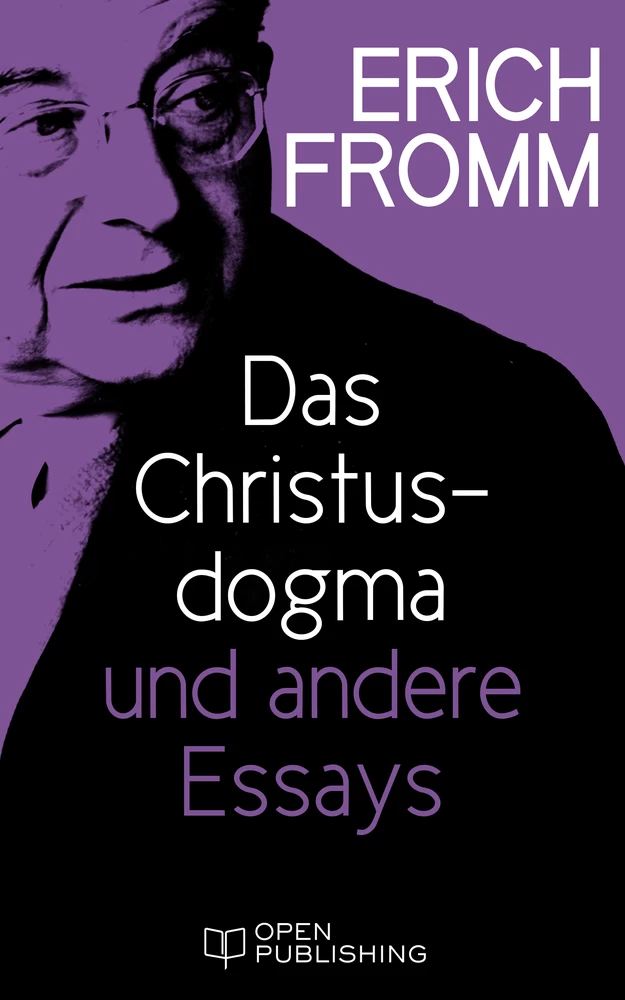Zusammenfassung
Der hier vorliegende erste Sammelband beginnt mit der 1930 entstandenen sozialpsychologischen Studie „Die Entwicklung des Christusdogmas“. In ihr geht es vor allem um die Frage, wie die konkrete Lebenspraxis und die sozio-ökonomischen Bedingungen sich im psychischen Antriebsleben gesellschaftlicher Gruppierungen niederschlagen. Nur so lassen sich Religionsphänomene, gesellschaftliche Wertvorstellungen und Ideale, Genderfragen oder poli-tische Entwicklungen sozialpsychologisch adäquat verstehen. Der Sammelband spiegelt die Anwendungsmöglichkeiten der Frommschen Sozialpsychologie hervorragend wider.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Die Entwicklung des Christusdogmas und andere Essays
- Inhalt
- Die Entwicklung des Christusdogmas. Eine psychoanalytische Studie zur sozialpsychologischen Funktion der Religion
- 1. Methodik und Problemstellung
- 2. Die sozialpsychologische Funktion der Religion
- 3. Das Urchristentum und seine Vorstellung von Jesus
- 4. Die Wandlung des Christentums und das homo-ousianische Dogma
- 5. Die Wandlungen des Dogmas bis zum Nizänischen Konzil
- 6. Ein anderer Deutungsversuch
- 7. Zusammenfassung
- Der gegenwärtige Zustand des Menschen
- Geschlecht und Charakter
- Psychoanalyse – Wissenschaft oder Linientreue
- Der revolutionäre Charakter
- Die Medizin und die ethische Frage des modernen Menschen
- Der Mensch ist kein Ding
- Die prophetische Auffassung vom Frieden
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Der gegenwärtige Zustand des Menschen
(The Present Human Condition)
(1955c)[25]
Als die mittelalterliche Welt zerstört war, schien der westliche Mensch der endgültigen Erfüllung seiner kühnsten Träume und Visionen entgegenzugehen. Er befreite sich von der Autorität einer totalitären Kirche, von der Last des traditionellen Denkens, von den geographischen Begrenzungen unseres erst zur Hälfte entdeckten Erdballs. Er schuf eine neue Wissenschaft, die schließlich bisher ungeahnte Produktivkräfte entfaltete und die materielle Welt völlig verwandelte. Er schuf politische Systeme, die Gewähr für eine freie und schöpferische Entwicklung des Individuums zu bieten schienen; er verkürzte die Arbeitszeit in solchem Ausmaß, dass der westliche Mensch so viele Mußestunden genießen kann, wie es seine Vorfahren sich kaum erträumt hatten.
Wo aber stehen wir heute?[26] Die Gefahr eines alles zerstörenden Krieges lastet auf der Menschheit, eine Bedrohung, der die Regierungen mit ihren zögernden Versuchen, ihr zu entgehen, keineswegs entgegenwirken. Aber selbst wenn die Politiker nüchtern genug sein sollten, einen Krieg zu verhindern, so sind wir doch weit entfernt davon, die Hoffnungen des sechzehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts erfüllt zu sehen.
Der Charakter des Menschen ist von den Erfordernissen der Welt geformt worden, die er mit seinen eigenen Händen schuf. Im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert hatte der Gesellschafts-Charakter der Mittelklasse stark ausbeuterische und hortende Züge. Dieser Charakter war bestimmt durch das Bestreben, andere auszubeuten und die Gewinne zu sparen, um weiteren Profit daraus zu ziehen. Im zwanzigsten Jahrhundert zeigen die Charakterzüge des Menschen eine beträchtliche Passivität und eine Identifikation mit Werten, die sich am Markt orientieren. Der Mensch unserer Tage verhält sich den größten Teil seiner Freizeit hindurch passiv. Er ist ein ewiger Konsument; er „nimmt“ alkoholische Getränke, Speisen, Zigaretten, Vorträge, Ansichten, Bücher, Filme „zu sich“; alles wird konsumiert, alles geschluckt. Die Welt ist ein großes Objekt für seinen Appetit: eine große Flasche, ein großer Apfel, eine große Brust. Der Mensch ist zum Säugling geworden, ewig voller Erwartung – und ewig enttäuscht.
Soweit der moderne Mensch nicht Konsument ist, ist er Käufer und Verkäufer. Den [V-268] Mittelpunkt unseres Wirtschaftssystems bildet der Markt, der den Wert aller Waren bestimmt und den Anteil jedes Einzelnen am Sozialprodukt reguliert. Weder Gewalt noch Tradition, wie in früheren Geschichtsperioden, noch Betrug oder Täuschung beherrschen die wirtschaftlichen Prozesse. Der Mensch ist frei zu produzieren und zu verkaufen; der Markttag ist der Gerichtstag über den Erfolg seiner Bemühungen. Nicht nur Waren werden auf dem Markt angeboten und verkauft; die Arbeit ist zur Ware geworden, die auf dem Arbeitsmarkt unter den gleichen Bedingungen des Wettbewerbs verkauft wird. Aber das Marktsystem reicht über den wirtschaftlichen Bereich von Waren und Arbeit hinaus. Der Mensch hat sich selbst in eine Ware verwandelt und fasst sein Leben als Kapital auf, das gewinnbringend investiert werden muss; wenn ihm das gelingt, ist er „erfolgreich“, und sein Leben hat Sinn; wenn nicht, ist er ein „Versager“. Sein „Wert“ liegt in seiner Verkäuflichkeit, nicht in den menschlichen Fähigkeiten der Liebe, der Vernunft oder der künstlerischen Kreativität. So hängt sein Selbstwertgefühl von äußeren Faktoren ab – von seinem Erfolg, von dem Urteil der anderen. Daher ist er von diesen abhängig und sucht Sicherheit in der Konformität – niemals mehr als zwei Schritt von der Herde entfernt.
Doch der Charakter des modernen Menschen wird nicht allein vom Markt bestimmt. Ein anderer Faktor, der eng mit dem Markt zusammenhängt, ist die Art und Weise der industriellen Produktion. Die Unternehmen werden immer größer; die Zahl der in ihnen beschäftigten Arbeiter und Angestellten wächst beständig; Eigentum und Management sind getrennt. Die Industrieriesen werden von einer Berufsbürokratie gelenkt, der es hauptsächlich um das reibungslose Funktionieren und die Ausdehnung ihres Unternehmens geht, weniger um persönliche Profitgier an sich.
Welchen Menschen braucht unsere Gesellschaft zum reibungslosen Funktionieren? Sie braucht Menschen, die in großen Gruppen zusammenarbeiten, die mehr und mehr konsumieren wollen, deren Geschmack genormt, leicht zu beeinflussen und vorherzusagen ist. Sie braucht Menschen, die sich frei und unabhängig fühlen und glauben, keiner Autorität, keinem Prinzip und keinem Gewissen unterworfen zu sein – die aber dennoch bereit sind, Befehle auszuführen, zu tun, was man von ihnen erwartet, und sich reibungslos in die gesellschaftliche Maschinerie einfügen. Sie braucht Menschen, die ohne Gewalt gelenkt, ohne Führer geführt, ohne Ziele angetrieben werden können, mit der einen Ausnahme: nie untätig zu sein, immer zu funktionieren und weiterzustreben. Die moderne Industrialisierung hat diesen Menschen geschaffen – den Automaten, den entfremdeten Menschen. Er ist entfremdet in dem Sinn, dass ihm sein Handeln und seine eigenen Kräfte fremd geworden sind; sie stehen über ihm und gegen ihn und beherrschen ihn, statt dass er sie beherrscht. Seine Lebenskräfte haben sich in Dinge und Institutionen verwandelt und sind zu Götzen geworden. Er erlebt sie nicht mehr als Ergebnis seiner eigenen Anstrengungen, sondern als etwas von ihm Getrenntes, das er anbetet und dem er sich unterwirft. Der entfremdete Mensch kniet nieder vor dem Werk seiner eigenen Hände. Seine Götzen verkörpern seine eigenen Lebenskräfte in einer entfremdeten Form. Der Mensch erfährt sich nicht mehr als den tätigen Schöpfer seiner eigenen Kräfte und Reichtümer, sondern als ein verarmtes „Ding“, abhängig von anderen Dingen außerhalb seiner, auf die er seine Lebenssubstanz projiziert hat. [V-269]
Seine sozialen Strebungen hat er auf den Staat übertragen. Als Staatsbürger ist er sogar bereit, sein Leben für den Mitmenschen zu opfern; als privates Individuum ist er beherrscht von selbstsüchtiger Sorge um sich selbst. Weil er den Staat zur Verkörperung seiner sozialen Strebungen gemacht hat, betet er ihn und seine Symbole an. Er überträgt sein Machtgefühl, seine Klugheit und seinen Mut auf Führer und betet diese Führer als Idole an. Als Arbeiter, Angestellter oder Manager ist der moderne Mensch seiner Arbeit entfremdet. Der Arbeiter ist zum Rad im Wirtschaftsgetriebe geworden, das sich nach den Anweisungen von Automaten und Managern dreht. Er hat keinen Anteil an der Planung des Arbeitsvorganges, keinen Anteil an seinem Ergebnis, selten sieht er das fertige Produkt. Der Manager hingegen beschäftigt sich mit dem fertigen Produkt, doch ist er ihm als etwas Konkretem, Nützlichem, entfremdet. Sein Ziel ist, das Kapital, das andere investiert haben, gewinnbringend anzuwenden; die Ware verkörpert lediglich das Kapital, als konkreter Gebrauchswert bedeutet sie ihm nichts. Der Manager ist zum Bürokraten geworden, der Dinge, Zahlen und menschliche Wesen nur als Objekte seiner Tätigkeit handhabt. Die Manipulation von Menschen wird als human relations bezeichnet, während der Manager es doch mit allerunmenschlichsten Beziehungen zu tun hat, nämlich solchen zwischen Automaten, die zu Abstraktionen geworden sind.
Unser Konsum ist ebenfalls entfremdet. Er wird weit mehr durch Werbeslogans als durch unsere wirklichen Bedürfnisse, unseren Gaumen, unsere Augen oder Ohren bestimmt.
Die Sinnlosigkeit und Entfremdung der Arbeit führen zur Sehnsucht nach vollkommener Untätigkeit. Der Mensch hasst sein Arbeitsleben, weil er sich in ihm gefangen und betrogen fühlt. Sein Ideal wird die absolute Untätigkeit, in der er keine Bewegung machen muss und alles nach dem Kodak-Slogan abläuft: „Sie drücken auf den Knopf, wir besorgen den Rest.“ Diese Tendenz wird durch den Konsum verstärkt, der zur Ausweitung des Marktes nötig ist, und das führt zu einem Prinzip, das Huxley sehr eindrucksvoll in seiner Brave New World (1946) geschildert hat. Einer der Slogans, von dem jeder von Kindheit an beeinflusst worden ist, lautet: „Verschiebe ein Vergnügen nie auf morgen, wenn du es heute haben kannst.“ Wenn ich die Befriedigung meines Wunsches nicht aufschiebe (und man hat mir beigebracht, nur zu wünschen, was ich bekommen kann), habe ich keine Konflikte, keine Zweifel; keine Entscheidung muss getroffen werden, nie bin ich mit mir allein, weil ich immer beschäftigt bin – entweder mit Arbeit oder mit dem Vergnügen. Ich habe kein Bedürfnis, mir meiner selbst bewusst zu werden, denn ich bin ständig mit Konsumieren beschäftigt. Ich bin ein System von Begierden und Befriedigungen; ich muss arbeiten, um meine Wünsche erfüllen zu können – und diese Wünsche werden von der Wirtschaftsmaschinerie immerzu wach gehalten und gelenkt.
Wir nehmen für uns in Anspruch, die Ziele der jüdisch-christlichen Tradition ernst zu nehmen: die Liebe zu Gott und unserem Nächsten. Man sagt uns sogar, dass wir in einer verheißungsvollen Zeit religiöser Renaissance leben. Nichts liegt der Wahrheit ferner. Wir bedienen uns der Symbole, die einer echten religiösen Tradition angehören, und verwandeln sie in Formeln, die den Zwecken des entfremdeten Menschen dienen. Die Religion ist zur leeren Hülle geworden; sie hat sich in eine [V-270] Selbsthilfevorrichtung zur Steigerung des Erfolgs verwandelt. Gott wird zum Geschäftspartner. Pfarrer Peales The Power of Positive Thinking (1952) löst Dale Carnegies Bestseller How to Make Friends and Influence People (1936) ab.
Liebe zum Menschen ist ebenfalls ein seltenes Phänomen. Automaten lieben nun einmal nicht. Entfremdete Menschen sind sich gleichgültig. Was die Liebesexperten und die Eheberater anpreisen, ist eine Team-Beziehung zwischen zwei Personen, die einander mit der richtigen Technik manipulieren und deren Liebe im wesentlichen ein Egoismus zu zweit ist – ein Schutz vor dem sonst unerträglichen Alleinsein.
Was können wir von der Zukunft erwarten? Wenn wir solche Überlegungen ignorieren, die nur Ergebnis unserer Wünsche sind, so werden wir, fürchte ich, zulassen müssen, dass die Diskrepanz zwischen technischer Intelligenz und Vernunft die Welt in einen Atomkrieg stürzt. Ein solcher Krieg wird höchstwahrscheinlich mit der Zerstörung der industriellen Zivilisation enden und die Welt auf einen primitiven agrarischen Stand zurückfallen lassen. Sollte die Zerstörung nicht so vollständig sein, wie viele Fachleute glauben, so wird der Sieger vor der Notwendigkeit stehen, die ganze Welt zu ordnen und zu beherrschen. Dies könnte nur ein zentralistischer Staat leisten, der sich auf Gewalt stützt, und es wäre ziemlich gleichgültig, ob der Regierungssitz Moskau oder Washington hieße.
Leider verheißt auch die Verhinderung eines Krieges keine erfreuliche Zukunft. In der Entwicklung des Kapitalismus wie des Kommunismus, wie wir sie für die nächsten fünfzig oder hundert Jahre vermuten, wird der Prozess menschlicher Entfremdung weitergehen. Beide Systeme entwickeln sich zu Managergesellschaften, deren Mitglieder gut genährt und gut gekleidet sind, deren Wünsche erfüllt werden und die keine unerfüllbaren Wünsche haben. Die Menschen werden immer mehr zu Automaten; sie erzeugen Maschinen, die wie Menschen, und Menschen, die wie Maschinen handeln; ihre Vernunft nimmt ab, während ihre Intelligenz zunimmt, und so kommt es zu der gefährlichen Situation, in der der Mensch mit der größten materiellen Macht ausgestattet ist, ohne die Weisheit, den richtigen Gebrauch davon zu machen.
Trotz wachsender Produktion und Bequemlichkeit verliert der Mensch immer mehr sein Selbstgefühl; er hält sein Leben für sinnlos, wenn dieses Gefühl auch weitgehend unbewusst ist. Das Problem des neunzehnten Jahrhunderts hieß: Gott ist tot, das Problem des zwanzigsten Jahrhunderts: Der Mensch ist tot. Im neunzehnten Jahrhundert bedeutete Unmenschlichkeit Grausamkeit; im zwanzigsten Jahrhundert bedeutet sie schizoide Selbstentfremdung. Die Gefahr der Vergangenheit war, dass Menschen zu Sklaven wurden. Die Gefahr der Zukunft ist, dass sie Roboter werden. Bezeichnenderweise rebellieren Roboter nicht. Menschen, die zu Robotern geworden sind, können nicht leben und vernünftig bleiben; sie werden zu „Golems“ und werden ihre Welt und sich selbst zerstören, weil sie die Öde eines sinnlosen Lebens nicht ertragen können.
Was ist die Alternative zu Krieg und automatisiertem Leben? Die beste Antwort läge in der Umkehrung von Emersons Satz „Die Dinge sitzen im Sattel und reiten die Menschheit“ – „Setzt die Menschheit in den Sattel, damit sie die Dinge reiten kann!“ Das heißt, der Mensch muss die Entfremdung überwinden, die ihn zum impotenten [V-271] und irrationalen Götzenanbeter macht. Im psychologischen Bereich bedeutet das, dass er sein marktorientiertes und passives Verhalten überwinden und einen reifen und produktiven Weg einschlagen muss. Er muss sein Selbstgefühl zurückgewinnen, er muss zur Liebe fähig werden und seine Arbeit zu einer sinnvollen, konkreten Tätigkeit machen. Er muss sich von der materialistischen Orientierung freimachen und sich auf eine Stufe erheben, auf der nur geistige Werte – Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit – wirklich zählen. Aber jeder Versuch, nur einen Lebensbereich, den menschlichen oder den geistigen zu ändern, ist zum Scheitern verurteilt. Fortschritt in nur einem Bereich verhindert umfassenden Fortschritt in allen Bereichen. Das Evangelium, das sich nur mit der Erlösung der Seele befasste, führte zur Entstehung der römisch-katholischen Kirche; die Französische Revolution, in der es ausschließlich um politische Verbesserung ging, führte zu Robespierre und Napoleon; der Sozialismus, soweit er lediglich die wirtschaftliche Umwälzung zum Ziel hatte, führte zum Stalinismus.
Bei der Anwendung des Prinzips der gleichzeitigen Veränderung aller Lebensbereiche müssen wir die wirtschaftlichen und politischen Wandlungen bedenken, die zur Überwindung der psychischen Entfremdung nötig sind. Wir dürfen die technischen Errungenschaften der maschinellen Produktion und der Automation nicht aufgeben. Wir müssen aber Arbeit und Staat so dezentralisieren, dass sie menschliche Proportionen annehmen, und dürfen Zentralisierung nur so weit zulassen, wie sie für die Erfordernisse der Industrie nötig ist. Auf wirtschaftlichem Gebiet brauchen wir eine industrielle Demokratie, einen demokratischen Sozialismus, der gekennzeichnet ist durch die Mitbestimmung aller, die in einem Unternehmen arbeiten, mit dem Ziel ihrer aktiven und verantwortlichen Beteiligung. Neue Formen solcher Beteiligung könnten gefunden werden. Auf politischem Gebiet kann eine wirkliche Demokratie durch Bildung unzähliger kleiner Gruppen errichtet werden, die gut unterrichtet sind und ernsthaft diskutieren; ihre Entscheidungen müssten in einem neuen „Unterhaus“ zusammengefasst werden. Die kulturelle Renaissance muss Arbeitserziehung für die jungen Menschen, Erwachsenenbildung und ein neues System der Volkskunst und des weltlichen Brauchtums verbinden.
Wie der primitive Mensch den Naturgewalten hilflos ausgeliefert war, so ist der moderne Mensch den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gewalten ausgeliefert, die er selbst geschaffen hat. Er betet das Werk seiner eigenen Hände an, er verbeugt sich vor den neuen Idolen, und doch schwört er im Namen Gottes, der ihm befahl, alle Götzen zu vernichten. Der Mensch kann sich vor den Folgen seines Wahnsinns nur schützen, indem er eine gesunde und vernünftige (sane) Gesellschaft bildet, die den Bedürfnissen des Menschen entspricht – Bedürfnissen, die in den wesentlichen Bedingungen seiner Existenz ihren Ursprung haben. Er muss eine Gesellschaft bilden, in der der Mensch dem Menschen mit Liebe begegnet und mehr in Brüderlichkeit und Solidarität verwurzelt ist als in Blut und Boden, eine Gesellschaft, die ihm die Möglichkeit gibt, kreativ die Natur zu transzendieren, und nicht durch Zerstören, eine Gesellschaft, in der jeder sein Selbstgefühl findet als Subjekt seiner Kräfte und nicht als Konformist, in der ein System der Orientierung und der Hingabe besteht, das von ihm nicht verlangt, die Wirklichkeit zu entstellen und Idole anzubeten. [V-272]
Der Aufbau einer solchen Gesellschaft stellt den nächsten Schritt dar; er bedeutet das Ende der „menschenähnlichen“ Geschichte, in der der Mensch noch nicht völlig menschlich geworden ist. Er bedeutet nicht das „Ende der Tage“, die „Vollendung“, den Zustand vollkommener Harmonie, in der es keine Konflikte und Probleme mehr gibt. Es ist im Gegenteil gerade das Schicksal des Menschen, dass sein Dasein erfüllt ist von Widersprüchen und dass er sich mit ihnen auseinandersetzen muss, ohne sie jemals lösen zu können. Wenn er das primitive Stadium des Menschenopfers überwunden hat – sei es nun in der rituellen Form der Azteken oder in der säkularen Form des Krieges –, wenn er sein Verhältnis zur Natur vernünftig statt blindlings zu gestalten vermag, wenn die Dinge wirklich seine Diener statt seine Götzen geworden sind, dann wird er vor den wahrhaft menschlichen Konflikten und Problemen stehen; er wird wagemutig, kühn, erfinderisch, fähig zu leiden und sich zu freuen sein müssen, aber seine Kräfte werden im Dienst des Lebens stehen, nicht im Dienst des Todes. Die neue Phase der menschlichen Geschichte wird, wenn sie eintreten sollte, ein Neubeginn sein, kein Ende.
Geschlecht und Charakter
(Sex and Character)
(1943b)[27]
Die These von den angeborenen Unterschieden zwischen den beiden Geschlechtern, die zwangsläufig zu grundsätzlichen Unterschieden in Charakter und Schicksal führen müssen, ist sehr alt.[28] Das Alte Testament macht zur Eigenart und zum Fluch der Frau, dass es sie nach dem Mann verlangt und er über sie herrschen wird, während vom Mann gesagt wird, dass er unter Mühsal vom Ackerboden essen wird (Gen 3,16°f.). Aber der biblische Bericht enthält auch die umgekehrte These: Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes geschaffen, und nur zur Strafe für den Sündenfall von Mann und Frau – hinsichtlich ihrer moralischen Verantwortung waren sie gleichgestellt! – wurden sie mit dem Fluch des Konflikts und ewiger Verschiedenheit belegt. Beide Ansichten, die der grundlegenden Verschiedenheit und die ihrer grundlegenden Gleichartigkeit wurden durch die Jahrhunderte hindurch wiederholt – ein Zeitalter oder eine philosophische Schule betonte die eine, ein anderes die entgegengesetzte These. Das Problem gewann zunehmende Bedeutung in den philosophischen und politischen Diskussionen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Vertreter der Aufklärungsphilosophie vertraten den Standpunkt, dass es keine angeborenen Unterschiede zwischen den Geschlechtern gebe („I’âme n’a pas de sexe“); alle zu beobachtenden Unterschiede seien durch Unterschiede in der Erziehung bedingt und seien – wie man heute sagen würde – kulturelle Unterschiede. Romantische Philosophen des frühen neunzehnten Jahrhunderts betonten hingegen das genaue Gegenteil. Sie analysierten die Charakterunterschiede zwischen Mann und Frau und erklärten, die fundamentalen Unterschiede seien das Ergebnis angeborener biologischer und physiologischer Unterschiede. Sie behaupteten, diese Charakterunterschiede gebe es in jeder vorstellbaren Kultur.
Ohne Rücksicht auf den Wert ihrer Argumente – jene der Romantiker waren oft sehr tiefgreifend – hatten beide einen politischen Inhalt. Die Philosophen der Aufklärung, vor allem die Franzosen, wollten eine Lanze brechen für die soziale und in gewissem Maß auch für die politische Gleichheit von Mann und Frau. Sie führten das Fehlen angeborener Unterschiede als Argument für ihre Sache an. Die Romantiker, die politisch reaktionär waren, benutzten ihre Analyse des „Wesens“ der menschlichen Natur als Beweis für die Notwendigkeit der politischen und sozialen Ungleichheit. Zwar [VIII-366] schrieben sie „der Frau“ sehr bewundernswerte Eigenschaften zu, bestanden aber darauf, dass ihre Charaktermerkmale sie ungeeignet zur Teilnahme am sozialen und politischen Leben auf gleicher Stufe mit dem Mann machten.
Der politische Kampf um die Gleichberechtigung der Frau endete nicht im neunzehnten Jahrhundert und ebenso wenig die theoretische Diskussion über den angeborenen oder kulturellen Charakter ihrer Verschiedenheit. In der modernen Psychologie wurde Freud der freimütigste Vertreter der Sache der Romantiker. Während bei diesen die Beweisführung in eine philosophische Sprache gekleidet war, stützte sich Freud auf die wissenschaftliche Beobachtung der Patienten während der psychoanalytischen Behandlung. Er nahm an, dass der anatomische Unterschied der Geschlechter die Ursache unveränderlicher Charakterunterschiede sei. „Die Anatomie ist das Schicksal“, sagt Freud (1924d, S. 400), einen Ausspruch Napoleons abwandelnd, von der Frau. Er ging davon aus, dass das kleine Mädchen bei der Entdeckung, dass ihm das männliche Geschlechtsorgan fehlt, zutiefst bestürzt und beeindruckt sei, dass es fühle, es fehle ihm etwas Wesentliches, dass es die Männer um das beneide, was das Schicksal ihm versagte, dass es im normalen Verlauf der Entwicklung versuche, sein Minderwertigkeits- und Neidgefühl zu überwinden, indem es das männliche Glied durch andere Dinge ersetze: durch Mann, Kinder oder Besitztümer. Bei neurotischer Entwicklung gelinge es ihr nicht, solche Ersatzbefriedigungen zu finden. Sie bleibe neidisch auf alle Männer, gebe ihren Wunsch, ein Mann zu sein, nicht auf, werde homosexuell, hasse die Männer oder suche gewisse kulturell erlaubte Kompensationen. Aber auch bei normaler Entwicklung verschwinde das Tragische am Schicksal der Frau niemals völlig; sie sei verdammt durch den Wunsch nach etwas, das ihr das ganze Leben unerreichbar bleibe.
Obwohl orthodoxe Psychoanalytiker diese Theorie Freuds als einen Eckpfeiler ihres psychologischen Systems beibehielten, bestritt eine Gruppe von Psychoanalytikern, die sich an der Kulturwissenschaft orientierten, Freuds Erkenntnis. Sie deckten die klinischen und theoretischen Irrtümer in Freuds Gedankengängen auf, indem sie erklärten, dass zu den charakterologischen Folgen, die er biologisch erklärt hatte, kulturelle und persönliche Erfahrungen geführt hätten. Die Ansichten dieser Gruppe von Psychoanalytikern sind von den Forschungsergebnissen der Anthropologen bestätigt worden.
Trotzdem besteht eine gewisse Gefahr, dass einige Anhänger jener fortschrittlichen anthropologischen und psychoanalytischen Theorien ins Gegenteil verfallen und die Bedeutung biologischer Unterschiede für die Bildung der Charakterstruktur völlig leugnen. Sie mögen darin von denselben Motiven geleitet sein wie die Vertreter der französischen Aufklärung. Da die Gegner der Gleichheit der Frau das Argument der angeborenen Unterschiede vertreten, mag ein Beweis notwendig erscheinen, dass alle Unterschiede, die empirisch beobachtet werden können, auf kulturelle Ursachen zurückgehen.
Es sollte nicht übersehen werden, dass in dieser ganzen Kontroverse eine wichtige philosophische Frage enthalten ist. Die Tendenz, alle charakterologischen Unterschiede der Geschlechter zu leugnen, kann durch die stillschweigende Annahme einer Prämisse der anti-egalitären Philosophie verursacht sein: Um Gleichheit zu fordern, [VIII-367] muss man beweisen, dass es keine anderen charakterologischen Unterschiede der Geschlechter gibt als jene, die unmittelbar durch bestehende gesellschaftliche Bedingungen verursacht werden. Die ganze Diskussion ist verworren, weil die einen von Unterschieden sprechen, während die Reaktionären in Wirklichkeit Unzulänglichkeiten meinen – genauer gesagt, jene Unzulänglichkeiten, die es unmöglich machen, volle Gleichheit mit der herrschenden Gruppe zu erreichen. So wurde die angeblich beschränkte Intelligenz der Frau, ihre mangelnde Fähigkeit zur Organisation und Abstraktion oder zu einem kritischen Urteil vorgebracht, um die volle Gleichstellung mit dem Mann auszuschließen. Eine Richtung behauptete, die Frau besitze Intuition, Liebe usw., doch mache diese Fähigkeit sie für ihre Aufgabe in der modernen Gesellschaft nicht geeigneter. Dasselbe wird oft von Minoritäten wie den Schwarzen und den Juden behauptet. So wurde der Psychologe oder Anthropologe dazu gedrängt, den Beweis zu erbringen, dass zwischen Geschlechts- oder Rassengruppen keine grundlegenden Unterschiede bestehen, die irgendetwas mit der Ermöglichung voller Gleichheit zu tun haben. In dieser Lage neigt der liberale Denker dazu, das Vorhandensein irgendwelcher Unterschiede zu verkleinern.
Obgleich die Liberalen bewiesen, dass es keine Unterschiede gibt, die eine politische, wirtschaftliche und soziale Ungleichheit rechtfertigen, ließen sie sich doch in eine strategisch ungünstige Defensive drängen. Wenn man es als erwiesen ansieht, dass es keine sozial nachteiligen Unterschiede gibt, so muss man deshalb noch nicht annehmen, es gebe überhaupt keine Unterschiede. Die Frage muss dann vielmehr lauten: Welcher Gebrauch wird von bestehenden oder mutmaßlichen Unterschieden gemacht und welchen Zwecken dienen sie? Selbst wenn man zugibt, dass Frauen im Vergleich zu Männern gewisse charakterologische Unterschiede aufweisen – was bedeutet dies?
Es ist die These dieses Essays, dass gewisse biologische Unterschiede charakterologische Unterschiede zur Folge haben; diese Unterschiede sind vermischt mit solchen, die unmittelbar durch soziale Faktoren entstehen: Letztere sind sehr viel stärker in ihrer Wirkung und können biologisch verwurzelte Unterschiede entweder verstärken, auslöschen oder umkehren; und schließlich stellen charakterologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern, soweit sie nicht unmittelbar von der Kultur bestimmt sind, niemals Wertunterschiede dar.[29] Mit anderen Worten: Die Charaktertypen des Mannes und der Frau in der westlichen Kultur werden bestimmt durch ihre jeweiligen sozialen Rollen; es bestehen jedoch Charakternuancen, die aus Geschlechtsunterschieden herrühren. Diese Nuancen sind unbedeutend im Vergleich mit den gesellschaftlich bedingten Unterschieden, dürfen aber nicht außer Acht gelassen werden.
Dem reaktionären Denken liegt meist stillschweigend die Annahme zugrunde, Gleichheit setze das Fehlen von Unterschieden zwischen Personen oder gesellschaftlichen Gruppen voraus. Da aber solche Unterschiede offensichtlich bei allen Dingen bestehen, die eine Rolle im Leben spielen, so lautet ihre Folgerung, dass es keine Gleichheit geben könne. Wenn umgekehrt die Liberalen dazu neigen, große Unterschiede in den geistigen und physischen Fähigkeiten sowie bei den zufällig vorteilhaften oder hinderlichen Persönlichkeitsmerkmalen zu leugnen, so geben sie damit in den [VIII-368] Augen des Durchschnittsmenschen ihren Gegnern nur recht. Der Begriff der Gleichheit, wie er sich in der jüdisch-christlichen und in der modernen fortschrittlichen Tradition herausbildete, bedeutet, dass alle Menschen gleich sind in jenen grundlegenden menschlichen Fähigkeiten, die die Voraussetzung für den Genuss der Freiheit und des Glücks sind. Er besagt weiterhin, dass infolge dieser grundlegenden Gleichheit kein Mensch zum Mittel für die Zwecke anderer Menschen, keine Gruppe zum Mittel für die Zwecke einer anderen Gruppe gemacht werden darf. Jeder Mensch ist ein Universum für sich und nur sein eigener Zweck. Sein Ziel ist die Verwirklichung seines Seins, einschließlich jener Eigenarten, die für ihn charakteristisch sind und ihn von den anderen unterscheiden. Daher ist Gleichheit die Grundlage für die volle Entfaltung der Unterschiede; aus ihr folgt die Entfaltung der Individualität.
Obgleich es eine Reihe von biologischen Unterschieden gibt, die man im Hinblick auf ihre Bedeutung für Charakterunterschiede bei Mann und Frau untersuchen könnte, soll es hier hauptsächlich um einen Unterschied gehen. Es ist also nicht die Absicht, das gesamte Problem der Charakterunterschiede der Geschlechter zu untersuchen, sondern nur die allgemeine These zu illustrieren. Wir werden uns hauptsächlich mit der unterschiedlichen Rolle von Mann und Frau im Geschlechtsverkehr befassen und zeigen, dass dieser Unterschied gewisse charakterologische Konsequenzen hat, die den aus dem Unterschied der sozialen Rollen erwachsenden Hauptunterschieden lediglich die Färbung geben.
Um sich sexuell betätigen zu können, muss der Mann eine Erektion haben und imstande sein, sie während des Geschlechtsverkehrs bis zum Orgasmus beizubehalten. Zur Befriedigung der Frau muss er imstande sein, die Erektion ausreichend lange auszudehnen, damit bei ihr ein Orgasmus stattfindet. Der Mann muss also, um die Frau sexuell zu befriedigen, beweisen, dass er eine Erektion haben und sie beibehalten kann. Die Frau muss ihrerseits nichts beweisen, um den Mann sexuell zu befriedigen. Sicherlich kann ihre Erregung die Lust des Mannes steigern. Begleitende physische Veränderungen in ihren Sexualorganen können ihm den Geschlechtsverkehr erleichtern. Da aber rein sexuelle Reaktionen in Betracht gezogen werden sollen – nicht subtile psychische Reaktionen differenzierter Persönlichkeiten – bleibt die Tatsache bestehen, dass der Mann eine Erektion haben muss, um die Frau zu befriedigen; die Frau muss nichts haben als eine gewisse Bereitschaft, um den Mann zu befriedigen. Wenn man von Bereitschaft spricht, so ist es wichtig zu bemerken, dass die Fähigkeit der Frau zur sexuellen Befriedigung des Mannes von ihrem Willen abhängt; es handelt sich um eine bewusste Entscheidung, die sie treffen kann, wann immer sie will. Die Fähigkeit des Mannes hingegen ist keinesfalls eine bloße Funktion seines Willens. Sexuelles Begehren und Erektion können gegen seinen Willen eintreten; er kann impotent sein, obwohl er leidenschaftlich das Gegenteil wünscht. Darüber hinaus ist eine Unfähigkeit des Mannes zum Geschlechtsverkehr eine Tatsache, die sich nicht verbergen lässt. Das Fehlen einer völligen oder teilweisen Reaktion auf Seiten der Frau, ihr „Versagen“, ist, obwohl für den Mann häufig erkennbar, keinesfalls in einem vergleichbaren Maß offensichtlich; es lässt einen beträchtlichen Grad an Täuschung zu. Wenn eine Frau einwilligt, kann der Mann sicher sein, Befriedigung zu finden, wann immer er sie begehrt. Die Situation der Frau ist dagegen völlig anders; [VIII-369] ihr leidenschaftliches Begehren führt nicht zur Befriedigung, wenn sie der Mann nicht so stark begehrt, dass sich bei ihm eine Erektion einstellt. Und sogar während des Geschlechtsaktes ist die volle Befriedigung der Frau von der Fähigkeit des Mannes, den Orgasmus bei ihr auszulösen, abhängig. Der Mann muss also etwas beweisen, um den Partner zu befriedigen, die Frau nicht.
Aus diesem Unterschied ihrer jeweiligen sexuellen Rolle ergibt sich ein Unterschied in den spezifischen Ängsten, die mit der Sexualfunktion verbunden sind. Die Ängste treten jeweils an dem Punkt auf, an dem der Mann und die Frau verwundbar sind. Die Position des Mannes ist verwundbar, weil er etwas beweisen muss, d.h. weil er möglicherweise auch versagen kann. Für ihn hat der Liebesakt stets den Beigeschmack eines Tests, einer Prüfung. Seine spezifische Angst ist die vor dem „Versagen“. Der extremste Fall ist die Kastrationsangst – die Angst davor, organisch und damit für immer unfähig zur Ausübung des Geschlechtsverkehrs zu werden. Die Verwundbarkeit der Frau liegt dagegen in ihrer Abhängigkeit vom Mann; das mit ihrer Sexualfunktion verbundene Unsicherheitselement liegt nicht im Versagen, sondern darin, „alleingelassen“, frustriert zu werden, keine ausreichende Kontrolle über den Vorgang zu haben, der zur sexuellen Befriedigung führt. Es überrascht daher nicht, dass die Ängste des Mannes und die der Frau sich auf verschiedene Bereiche beziehen – die des Mannes betreffen sein Ich, seine Geltung, seinen Wert in den Augen der Frau; die der Frau betreffen ihre sexuelle Lust und Befriedigung. (Eine ähnliche Unterscheidung, die sich ausschließlich auf die Unterschiede in den sexuellen Ängsten von Kindern bezieht, wurde von Karen Horney (1932) getroffen.)
Die Frage mag kommen: Sind diese Ängste nicht nur für neurotische Persönlichkeiten charakteristisch? Ist sich der normale Mann nicht seiner Potenz sicher? Ist sich die normale Frau nicht ihres Partners sicher? Haben wir hier nicht den äußerst nervösen und sexuell unsicheren modernen Menschen vor uns? Sind nicht der „Höhlenmann“ und die „Höhlenfrau“ in ihrer „primitiven“ und unverdorbenen Sexualität frei von solchen Zweifeln und Ängsten?
Auf den ersten Blick mag es so scheinen. Der Mann, der ständig um seine Potenz besorgt ist, stellt einen bestimmten Typ der neurotischen Persönlichkeit dar, ebenso die Frau, die ständig fürchtet, unbefriedigt zu bleiben oder unter ihrer Abhängigkeit leidet. Aber wie so häufig ist der Unterschied zwischen „neurotisch“ und „normal“ auch hier eher graduell und eine Frage des Bewusstwerdens als eine wesentliche Qualität. Was beim Neurotiker als bewusste und ständige Angst zutage tritt, ist beim sogenannten normalen Menschen eine relativ unbemerkte und quantitativ leichte Angst. Darüber hinaus rufen gewisse Zwischenfälle, die beim Neurotiker mit Sicherheit zu Ängsten führen, bei normalen Individuen keine Angst hervor. Der normale Mann stellt seine Potenz nicht in Zweifel. Die normale Frau befürchtet nicht, von dem Mann, den sie zum sexuellen Partner gewählt hat, frustriert zu werden. Die Wahl des Mannes, zu dem sie sexuelles „Vertrauen“ haben kann, ist ein wesentlicher Teil ihres gesunden Sexualtriebs. Aber dies ändert nichts daran, dass der Mann möglicherweise versagt, niemals aber die Frau. Die Frau ist abhängig vom Begehren des Mannes, der Mann ist nicht abhängig vom Begehren der Frau.[30]
Es gibt aber noch ein anderes Element, das bei der Feststellung von Ängsten und von [VIII-370] verschiedenen Ängsten beim normalen Mann und bei der normalen Frau von Bedeutung ist.
Der Unterschied der Geschlechter ist die Grundlage gewesen für die früheste und elementarste Teilung der Menschheit in getrennte Gruppen. Mann und Frau brauchen einander zur Erhaltung der Art und der Familie ebenso wie zur Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse. Aber in jeder Situation, in der zwei verschiedene Gruppen einander brauchen, treten nicht nur Elemente der Harmonie, der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Befriedigung auf, sondern auch solche des Kampfes und der Disharmonie.[31]
Die sexuelle Beziehung zwischen den Geschlechtern könnte kaum frei von der Möglichkeit von Antagonismus und Feindseligkeit sein. Mann und Frau haben neben der Fähigkeit, einander zu lieben, eine ähnliche Fähigkeit zu hassen. In jeder Beziehung zwischen Mann und Frau ist das Element des Antagonismus latent gegenwärtig, und aus dieser Möglichkeit muss von Zeit zu Zeit Angst erwachsen. Der geliebte Mensch kann zum Feind werden, und dann sind die verwundbaren Stellen des Mannes und der Frau bedroht.[32]
Die Form der Bedrohung und der Angst ist jedoch bei Mann und Frau verschieden. Wenn die Hauptangst des Mannes darin liegt, dass er versagen und seine Aufgabe nicht erfüllen könnte, so ist der Wunsch nach Ansehen der Antrieb, der ihn vor dieser Angst bewahren soll. Der Mann ist tief von dem Verlangen durchdrungen, ständig sich selbst, der geliebten Frau und allen anderen Frauen und Männern zu beweisen, dass er jede Erwartung erfüllen kann. Durch Konkurrenz auf allen anderen Lebensgebieten, auf denen Willenskraft, physische Stärke und Intelligenz zum Erfolg gefordert sind, sucht er immer wieder Schutz gegen die Angst vor sexuellem Versagen. In engem Zusammenhang mit diesem Verlangen nach Geltung steht seine Rivalität zu anderen Männern. Da er Angst vor einem möglichen Versagen hat, möchte er gern unter Beweis stellen, dass er besser ist als jeder andere Mann. Der Don Juan tut dies unmittelbar im sexuellen Bereich, der Durchschnittsmensch mittelbar, indem er mehr Feinde tötet, mehr Wild jagt, mehr Geld verdient oder auf andere Weise erfolgreicher ist als seine männlichen Konkurrenten.[33]
Das gegenwärtige Gesellschafts- und Wirtschaftssystem beruht auf den Prinzipien der Konkurrenz und des Erfolges – Ideologien preisen seinen Wert. Durch diese und durch andere Umstände ist die Gier nach Prestige und Konkurrenz tief im Durchschnittsmenschen der westlichen Kultur verwurzelt. Selbst wenn es keine Unterschiede in den sexuellen Rollen gäbe, so würde dieses Verlangen bei Mann und Frau auf Grund gesellschaftlicher Faktoren bestehen. Die Gewalt dieser gesellschaftlichen Gegebenheiten ist so stark, dass es zweifelhaft erscheinen mag, ob auf Grund der hier genannten sexuellen Faktoren beim Mann, quantitativ gesehen, mehr Verlangen nach Geltung besteht als bei der Frau. Am wichtigsten ist jedoch nicht der Grad, in dem die Rivalität durch sexuelle Ursachen gesteigert wird, sondern vielmehr die Notwendigkeit, das Vorhandensein von anderen als gesellschaftlichen Faktoren bei der Entwicklung der Rivalität anzuerkennen.[34]
Das männliche Geltungsstreben wirft einiges Licht auf die spezifische Art der männlichen Eitelkeit. Allgemein wird behauptet, Frauen seien eitler als Männer. Obgleich [VIII-371] das Gegenteil der Fall sein könnte, kommt es nicht auf den Unterschied in der Quantität, sondern in der Qualität der Eitelkeit an. Das wesentliche Merkmal der Eitelkeit des Mannes ist die Prahlerei, was für ein „Kerl“ er sei. Er handelt, als ob er in einer ständigen Prüfungssituation leben würde. Der Mann möchte zum Ausdruck bringen, dass er keine Angst vor dem Versagen hat. Diese Eitelkeit scheint seine ganze Aktivität zu färben. Es gibt wahrscheinlich keine männliche Leistung – vom Liebesakt bis zu den kühnsten Leistungen im Kampf und im Denken, die nicht ein wenig von dieser typisch männlichen Eitelkeit geprägt wäre.
Ein weiterer Aspekt des männlichen Geltungsstrebens ist seine Angst, lächerlich gemacht zu werden, besonders von einer Frau. Selbst ein Feigling kann zum Helden werden, wenn er befürchtet, von einer Frau lächerlich gemacht zu werden, und die Angst des Mannes, sein Leben zu verlieren, ist weniger groß als seine Angst vor Lächerlichkeit. Das ist typisch für die Vorstellung vom männlichen Heldenmut, der keineswegs größer ist als der Heldenmut, zu dem eine Frau fähig ist, der sich aber in seiner Färbung durch die männliche Art von Eitelkeit unterscheidet.
Eine weitere Folge der unsicheren Lage des Mannes gegenüber der Frau und seiner Angst vor Lächerlichkeit ist sein potenzieller Hass gegen sie. Dieser Hass trägt zu einem Streben bei, das auch eine Verteidigungsfunktion erfüllt: die Frau zu beherrschen, Gewalt über sie zu haben, damit sie sich schwach und minderwertig fühlt. Wenn ihm das gelingt, braucht er sie nicht zu fürchten. Wenn sie Angst vor ihm hat – Angst, getötet, geschlagen oder ausgehungert zu werden –, dann kann sie ihn nicht lächerlich machen. Macht über eine Person hängt weder von der Intensität der eigenen Leidenschaft noch davon ab, dass die eigene sexuelle und emotionale Leistungsfähigkeit funktioniert. Macht beruht auf Faktoren, die so sicher aufrechterhalten werden können, dass niemals ein Zweifel an den einzelnen Fähigkeiten auftritt. Übrigens ist die Zusicherung der Macht über die Frau der Trost, den der patriarchalisch voreingenommene biblische Mythos dem Mann spendet, selbst während Gott ihn verflucht.[35]
Kehren wir zurück zum Problem der Eitelkeit. Wir haben festgestellt, dass die Eitelkeit der Frau ihrer Art nach von der des Mannes verschieden ist. Männliche Eitelkeit will zeigen, was man kann und dass man niemals versagt; weibliche Eitelkeit zeigt sich hauptsächlich im Bedürfnis, anziehend zu wirken und sich selbst zu beweisen, dass man anziehend wirkt. Gewiss muss auch der Mann für die Frau sexuell attraktiv sein, wenn er sie gewinnen will – in einer Kultur, in der Geschmack und Gefühle, die bei der sexuellen Anziehung eine Rolle spielen, differenziert sind. Es gibt aber andere Wege für den Mann, eine Frau zu gewinnen und sie dahin zu bringen, seine Sexualpartnerin zu sein: nackte physische Gewalt oder, wirksamer noch, soziale Macht und Reichtum. Die Möglichkeit seiner sexuellen Befriedigung hängt also nicht allein von seiner sexuellen Anziehungskraft ab. Die sexuelle Befriedigung der Frau dagegen ist vollkommen abhängig von ihrer Anziehungskraft. Weder Gewalt noch Versprechungen können einen Mann sexuell potent machen. Der Versuch der Frau, anziehend zu wirken, wird durch ihre sexuelle Rolle erzwungen, und ihre Eitelkeit oder Sorge um ihre Anziehungskraft ergeben sich daraus.[36]
Die Angst der Frau vor Abhängigkeit, vor Versagen, vor einer Rolle, die sie zum [VIII-372] Warten zwingt, führt sie häufig zu einem Wunsch, den Freud stark betont hat: zu dem Wunsch, den männlichen Penis zu besitzen. (Vgl. C. Thompson, 1942.) Dieser Wunsch der Frau hat seine Wurzel jedoch nicht primär in dem Gefühl, es fehle ihr etwas und sie sei dem Mann wegen dieses Mangels unterlegen. Obwohl es in vielen Fällen andere Gründe zum Penisneid gibt, entspringt er oft dem Bedürfnis, nicht abhängig, nicht in der Aktivität beschränkt, nicht der Gefahr der Frustration ausgeliefert zu sein. Wie einem Wunsch des Mannes, eine Frau zu sein, ein Verlangen zugrunde liegen kann, von der Bürde des Tests befreit zu sein, so kann das Verlangen der Frau nach dem Penis dem Wunsch entspringen, ihre Abhängigkeit zu überwinden. Außer als Symbol der Unabhängigkeit dient der Penis in gewissen Fällen nicht selten auch sadistisch-aggressiven Tendenzen, als eine Waffe, um andere Männer und Frauen verletzen zu können. (Für die weibliche Homosexualität scheint eine Kombination von Aktivsein-Wollen – im Gegensatz zur sonst „abwartenden“, abhängigen Rolle – mit einer eindeutig destruktiven Tendenz besonders typisch zu sein.)
Wenn der Mann als Hauptwaffe gegen die Frau seine physische und gesellschaftliche Macht hat, dann ist die Hauptwaffe der Frau ihre Fähigkeit, den Mann lächerlich zu machen. Am radikalsten kann sie das, indem sie ihn impotent macht. Es gibt dazu viele Methoden, grobe und feine. Sie reichen von der ausgesprochenen oder unausgesprochenen Erwartung seines Versagens bis zur Frigidität und jener Art von Scheidenkrämpfen, die den Verkehr physisch unmöglich machen. Der Wunsch, den Mann zu kastrieren, scheint nicht die alles bedeutende Rolle zu spielen, die Freud ihr zuschrieb. Sicher ist Kastration eine Möglichkeit, den Mann impotent zu machen, und sie tritt häufig dort auf, wo sich destruktive und sadistische Tendenzen abzeichnen. Aber das Hauptziel der Feindseligkeit der Frau scheint nicht physische, sondern die funktionelle Schädigung zu sein, die Beeinträchtigung der Fähigkeit, die Vereinigung zu vollziehen. Die spezifische Feindseligkeit des Mannes ist es, durch physische Gewalt, durch politische oder wirtschaftliche Macht zu überwältigen; die der Frau, durch Lächerlich- und Verächtlichmachen seine Fähigkeiten zu untergraben.[37
Frauen können Kinder gebären, Männer nicht. Es ist für Freuds patriarchalische Einstellung bezeichnend, dass er annahm, die Frau beneide den Mann um sein Geschlechtsorgan, aber kaum daran dachte, dass der Mann die Frau um die Fähigkeit, Kinder zu gebären, beneiden könnte. Dieser einseitigen Sicht liegt nicht nur die männliche Prämisse zugrunde, dass der Mann der Frau überlegen sei, sondern auch die Einstellung einer hochindustrialisierten Zivilisation, in der natürliche Produktivität nicht sehr hoch bewertet wird. In früheren Perioden der Geschichte, in denen das Leben wesentlich von der Produktivität der Natur und nicht der Technik abhing, muss der Umstand, dass die Frau diese Gabe mit dem Boden und mit weiblichen Tieren teilt, überaus beeindruckend gewesen sein. Solange man ausschließlich Natur in Betracht zieht, ist der Mann nicht produktiv. In einer Kultur, in der der Hauptakzent auf der natürlichen Produktivität lag, könnte sich der Mann der Frau unterlegen fühlen, vor allem, weil seine Rolle bei der Zeugung des Kindes nicht klar verstanden wurde. Mit Sicherheit kann angenommen werden, dass der Mann die Frau wegen dieser Fähigkeit, die ihm fehlte, bewunderte, dass sie ihm Scheu einflößte und er sie beneidete. Er konnte nichts hervorbringen; er konnte nur Tiere töten, um sie zu essen, [VIII-373] oder Feinde töten, um sicher zu leben oder ihre Kraft auf magische Weise in sich aufzunehmen.
Ohne die Stellung dieser Faktoren in reinen Agrargesellschaften zu erörtern, wollen wir die Auswirkungen einiger wichtiger geschichtlicher Veränderungen kurz streifen. Eine der bedeutendsten Auswirkungen war die zunehmende Verwendung technischer Produktionsformen. Mehr und mehr setzte man den Verstand ein, um die verschiedenen Mittel zum Leben zu verbessern und zu vermehren, die ursprünglich allein von den Gaben der Natur abhängig gewesen waren. Obwohl die Frau ursprünglich eine Fähigkeit besaß, die sie dem Manne überlegen machte, und dieser den Mangel ursprünglich durch den Gebrauch seines Talents zur Zerstörung ausglich, benutzte der Mann später seine Intelligenz als Basis der technischen Produktivität. Dies war in den früheren Stadien eng mit Magie verbunden; später produzierte der Mann dank der Macht seines Denkens materielle Dinge, und diese Fähigkeit zu technischer Produktion hat nunmehr den Verlass auf natürliche Produktion überflügelt.
Wir werden dieses Thema nicht weiterentwickeln und verweisen nur auf die Schriften von Bachofen, Morgan und Briffault, deren anthropologisches Material, das sie hervorragend analysiert haben, vielleicht nicht ihre Thesen beweist, aber, stark für die Existenz gewisser Kulturen in verschiedenen Phasen der Frühzeit spricht, in denen die Mutter im Mittelpunkt der sozialen Organisation stand und sich die religiösen Vorstellungen um Muttergottheiten drehten, die die Zeugungskraft der Natur symbolisierten. (Vgl. F. Fromm-Reichmann, 1940.)
Ein Beispiel mag genügen.[38] Der babylonische Schöpfungsmythos beginnt mit der Existenz einer Muttergottheit, Tiamat, die über das Universum herrscht. Ihre Herrschaft wird aber durch ihre männlichen Söhne bedroht, die ihren Sturz planen. Als Führer in diesem Kampf suchen sie einen, der ihr an Stärke gleichkommt. Sie einigen sich schließlich auf Marduk; doch ehe sie ihn endgültig wählen, verlangen sie von ihm eine Prüfung. Worin besteht diese Prüfung? Er muss „mit der Gewalt seines Mundes“ ein Kleid verschwinden und mit einem Wort wiedererscheinen lassen. Der erwählte Führer zerstört das Kleid mit einem Wort, und mit einem Wort erschafft er es wieder. Seine Führerschaft ist bestätigt. Er besiegt die Muttergottheit und erschafft aus ihrem Leib Himmel und Erde.
Was ist der Sinn der Prüfung? Wenn der männliche Gott der Göttin an Stärke gleichkommen will, muss er die Eigenschaft besitzen, die sie überlegen macht – die Macht, etwas zu erschaffen. Die Prüfung soll beweisen, dass er diese Macht ebenso besitzt wie die charakteristische männliche Macht zu zerstören, mit der der Mann ursprünglich die Natur veränderte. Zuerst zerstört er einen Gegenstand, um ihn dann wiederzuerschaffen; aber er tut es mit seinem Wort, nicht wie die Frau mit dem Leib. An die Stelle der natürlichen Produktivität tritt die Magie von Gedanken- und Wortvorgängen.
Der biblische Schöpfungsmythos beginnt dort, wo der babylonische Mythos endet. Nahezu alle Spuren der Oberherrschaft einer weiblichen Gottheit sind nunmehr ausgeschieden. Die Schöpfung beginnt mit Gottes geheimnisvoller Kraft, der geheimnisvollen Kraft der Schöpfung durch das Wort. Das Thema der Schöpfung durch den Mann wird wiederholt; im Gegensatz zu den Tatsachen wird der Mann nicht durch [VIII-374] die Frau geboren, sondern die Frau wird aus dem Manne geschaffen. (Vgl. den griechischen Mythos, dass Athene aus dem Haupt des Zeus entsprang, und die Deutung dieses Mythos sowie die Überreste der matriarchalischen Religion in der griechischen Mythologie bei Johann Jakob Bachofen und Rudolf Otto.) Der biblische Mythos ist ein Triumphgesang über die besiegte Frau; er leugnet, dass die Frau den Mann gebiert und verkehrt die natürlichen Beziehungen ins Gegenteil. Im Fluch Gottes wird die Oberherrschaft des Mannes bekräftigt. Die Gebärfunktion der Frau wird anerkannt, soll aber Schmerzen bringen. Der Mann soll arbeiten, d.h. produzieren; so tritt er an die Stelle der ursprünglichen Produktivität der Frau, auch wenn diese sich noch so sehr unter Schweiß und Schmerzen vollzieht.
Wir haben uns ausführlicher mit dem Phänomen matriarchalischer Überreste in der Religionsgeschichte befasst, um einen Punkt, der in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, zu veranschaulichen: die Befähigung der Frau zur natürlichen Produktivität, die dem Manne fehlt, und die Unfruchtbarkeit des Mannes in dieser Hinsicht. In gewissen Perioden der Geschichte war diese Überlegenheit der Frau deutlich fühlbar; später lag alle Betonung auf der magischen und technischen Produktivität des Mannes. Trotzdem scheint dieser Unterschied unbewusst auch heute noch seinen Sinn nicht ganz verloren zu haben; irgendwo verspürt der Mann eine Scheu vor der Frau wegen dieser Fähigkeit, die er nicht besitzt. Er beneidet und fürchtet sie darum. Irgendwo in seinem Charakter ist das Bedürfnis nach einem beständigen Ausgleich dieses Mangels, irgendwo in der Frau das Gefühl der Überlegenheit wegen seiner Unfruchtbarkeit.
Bisher haben wir von gewissen charakterologischen Unterschieden zwischen Mann und Frau gesprochen, die sich aus Geschlechtsunterschieden ergeben. Soll das bedeuten, dass Züge wie übersteigerte Abhängigkeit auf der einen, Rivalität und Geltungsstreben auf der anderen Seite, hauptsächlich durch Geschlechtsunterschiede verursacht werden? Weisen „die“ Frau und „der“ Mann solche Züge auf, dass wir es mit einer homosexuellen Komponente erklären müssen, wenn wir bei einem Menschen Züge finden, die für das andere Geschlecht charakteristisch sind?
Derartige Schlüsse lassen sich nicht ziehen. Die Geschlechtsunterschiede geben der Persönlichkeit des Mannes und der Frau gewöhnlich nur ihre Färbung. Diese Färbung ist der Tonart vergleichbar, in der eine Melodie geschrieben ist, nicht der Melodie selbst. Darüber hinaus betrifft sie nur den durchschnittlichen Mann und die durchschnittliche Frau und ist bei jedem Menschen anders.
Diese „natürlichen“ Unterschiede mischen sich mit Unterschieden, die sich durch die jeweilige Kultur herausbilden. In unserer heutigen Kultur beispielsweise haben das Geltungsstreben und das Streben nach Konkurrenzerfolg, die wir beim Manne finden, sehr viel weniger mit der sexuellen als mit der sozialen Rolle zu tun. Die Gesellschaft ist so organisiert, dass dieses Streben zwangsläufig erzeugt wird, ohne Rücksicht darauf, ob es spezifisch männlich oder weiblich ist. Das Geltungsstreben, das der Mann seit Ende des Mittelalters zeigt, ist hauptsächlich aus dem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, nicht aus einer sexuellen Rolle zu erklären; das gleiche gilt für die Abhängigkeit der Frau. Es kommt vor, dass kulturelle Muster und Gesellschaftsformen Charaktertendenzen schaffen, parallel mit übereinstimmenden Tendenzen, die [VIII-375] auf ganz anderen Ursachen (z.B. Geschlechtsunterschieden) beruhen. Dann werden die beiden parallelen Tendenzen verschmolzen, und es hat den Anschein, als ob ihre Ursprünge identisch seien.[39]
Geltungsstreben und Abhängigkeit bestimmen, soweit sie Ergebnisse der Kultur sind, die gesamte Persönlichkeit.[40] Die individuelle Persönlichkeit wird so auf einen Teil des gesamten Spektrums an menschlichen Möglichkeiten reduziert. Charakterunterschiede sind jedoch, soweit sie sich aus natürlichen Unterschieden ergeben, nicht von dieser Art. Der Grund mag darin liegen, dass die Gleichheit zwischen den Geschlechtern größer ist als ihre Verschiedenheit und Mann und Frau zuallererst menschliche Wesen sind mit gleichen Möglichkeiten, gleichen Begierden, gleichen Ängsten. Was auf Grund natürlicher Unterschiede an ihnen verschieden ist, macht sie nicht verschieden. Es ruft in ihren grundsätzlich ähnlichen Persönlichkeiten geringfügige Unterschiede in der Betonung der einen oder anderen Tendenz hervor; diese Betonung erscheint empirisch als Nuance. Die Unterschiede, die auf Geschlechtsunterschieden beruhen, bieten offensichtlich keinen Grund dafür, dem Mann und der Frau in irgendeiner Gesellschaft verschiedene Rollen zuzuweisen.
Welche Unterschiede auch zwischen den Geschlechtern bestehen – heute ist klar, dass sie im Vergleich zu den Charakterunterschieden, die zwischen Personen desselben Geschlechts auftreten, nicht ins Gewicht fallen. Die Geschlechtsunterschiede haben keinen Einfluss auf die Fähigkeit, Arbeit irgendwelcher Art zu verrichten. Gewiss mögen höchst differenzierte Leistungen in ihrem Wesen von geschlechtlichen Merkmalen gefärbt sein, das eine Geschlecht mag für eine gewisse Arbeit etwas begabter sein als das andere, aber das ist auch der Fall, wenn Extravertierte mit Introvertierten oder Pykniker mit Asthenikern verglichen werden. Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Differenzierungen nach solchen Merkmalen zu treffen.
Wieder wird klar, dass im Vergleich zu den allgemeinen gesellschaftlichen Einflüssen, von denen die männlichen oder weiblichen Muster geformt werden, die individuellen und – vom gesellschaftlichen Standpunkt aus – zufälligen Erfahrungen jedes Einzelmenschen sehr ins Gewicht fallen. Diese persönlichen Erfahrungen verschmelzen mit den kulturellen Mustern, wobei sie zumeist an Wirkung zunehmen, gelegentlich aber auch einbüßen. Es ist zu vermuten, dass der Einfluss der gesellschaftlichen und persönlichen Faktoren stärker ist als der der „natürlichen“, die hier genannt wurden.
Es ist ein trauriger Kommentar auf die geschichtliche Entwicklung, dass man sich genötigt fühlt zu betonen, die der männlichen oder weiblichen Rolle zugeschriebenen Unterschiede gäben keine Grundlage ab für ein gesellschaftliches oder moralisches Werturteil. Sie sind an sich weder gut noch schlecht, weder wünschenswert noch verhängnisvoll. Derselbe Charakterzug erscheint bei der einen Persönlichkeit als positives Merkmal, wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind, und als ein negatives Merkmal bei einer anderen Persönlichkeit mit anderen Voraussetzungen. So liegen die negativen Formen, in denen Angst des Mannes vor Versagen und ein Geltungsstreben zutage treten, auf der Hand: Eitelkeit, mangelnder Ernst, Unzuverlässigkeit, Angeberei. Es ist aber nicht weniger offensichtlich, dass eben diese Merkmale zu höchst positiven Charakterzügen führen können: zu Initiative, Aktivität und Mut. [VIII-376] Das gilt auch im Hinblick auf die weiblichen Merkmale, wie wir sie beschrieben haben. Die besonderen Wesenszüge der Frau können sie unfähig machen, praktisch, emotional und intellektuell „auf eigenen Beinen zu stehen“, und das ist auch oft der Fall; doch unter anderen Bedingungen werden sie zur Quelle von Geduld, Zuverlässigkeit, Liebesintensität und erotischen Charmes.
Das positive oder negative Ergebnis des einen oder anderen Wesenszuges hängt von der gesamten Charakterstruktur der betreffenden Person ab. Zu den Persönlichkeitsfaktoren, die sich positiv oder negativ auswirken können, gehören beispielsweise Ängstlichkeit oder Selbstvertrauen, Destruktivität oder konstruktives Vermögen. Es genügt aber nicht, ein oder zwei isolierte Merkmale herauszugreifen; erst die Totalität der Charakterstruktur bestimmt, ob sich einer der männlichen oder weiblichen Wesenszüge positiv oder negativ auswirkt. Diesen Grundsatz hat auch Klages in sein graphologisches System eingebaut. Jedes einzelne Merkmal der Handschrift kann, je nach dem „Formniveau“ der Gesamtpersönlichkeit, eine positive oder negative Bedeutung haben. Wenn der Charakter eines Menschen „ordentlich“ genannt wird, so kann das entweder positiv sein: dass er nicht „liederlich“ und imstande ist, sein Leben zu ordnen; oder es kann negativ sein: dass er pedantisch, unfruchtbar und ohne Initiative ist. Ganz offensichtlich liegt das Merkmal Ordentlichkeit sowohl dem negativen wie dem positiven Erscheinungsbild zugrunde, aber dieses wird von einer Reihe anderer Faktoren in der Gesamtpersönlichkeit bestimmt. Diese sind ihrerseits von äußeren Bedingungen abhängig, die dem Leben entweder entgegenarbeiten oder zu einem echten Wachstum beitragen.[41]
Psychoanalyse – Wissenschaft oder Linientreue
(Psychoanalysis – Science or Party Line?)
(1958a)[42]
Bekanntlich ist die Freudsche Psychoanalyse eine Therapie zur Heilung von Neurosen und eine wissenschaftliche Theorie, die sich mit dem Wesen des Menschen befasst.[43] Weniger bekannt ist, dass sie auch eine „Bewegung“, eine internationale Organisation mit streng hierarchischem Aufbau und strengen Zugehörigkeitsregeln ist, die viele Jahre von einem aus Freud und sechs anderen bestehenden Geheimkomitee geleitet wurde. Diese Bewegung hat bei Gelegenheit und durch einige ihrer Mitglieder einen Fanatismus an den Tag gelegt, der gewöhnlich nur in religiösen und politischen Bürokratien zu finden ist.
Als revolutionäre wissenschaftliche Theorie ließe sich die Psychoanalyse am ehesten mit der Theorie Darwins vergleichen, die sich auf das moderne Denken noch gewaltiger ausgewirkt hat als die Psychoanalyse. Gibt es aber eine darwinistische „Bewegung“, die festlegt, wer sich als „Darwinist“ bezeichnen darf, die straff organisiert ist und fanatisch für die Reinheit der Lehre Darwins kämpft?
Ich möchte zuerst einige der drastischeren und unglücklicheren Ausdrucksformen dieses „Parteigeistes“ im Zusammenhang mit der Freud-Biographie von Ernest Jones aufzeigen (E. Jones, 1960-1962). Dies aus zwei Gründen: Erstens führte Jones’ Parteifanatismus ihn zu grotesken posthumen Angriffen auf Männer, die mit Freud nicht übereinstimmten, und zweitens haben viele Rezensenten von Jones’ Buch diese Angaben ohne Kritik oder Zweifel hingenommen.
Die „Neufassung“ der geschichtlichen Ereignisse durch Jones führt in die Wissenschaft eine Methode ein, die wir bislang nur in der stalinistischen „Geschichtsschreibung“ zu finden erwarteten. Die Stalinisten nannten Abtrünnige und Rebellen „Verräter“ und „Spione“ des Kapitalismus. Dr. Jones tut das gleiche in psychiatrischer Redeweise, indem er behauptet, dass Rank und Ferenczi, die beiden Männer, die Freud am engsten verbunden waren, aber später in einigen Punkten von ihm abwichen, seit vielen Jahren psychotisch gewesen seien. Er unterstellt, dass nur ihre Geisteskrankheit das Verbrechen ihres Abfalles von Freud erkläre, und im Falle Ferenczis, dass seine Klagen über die barsche und unduldsame Behandlung, die ihm von Seiten Freuds widerfuhr, ipso facto der Beweis der Psychose seien.
Zuerst ist bemerkenswert, dass viele Jahre, bevor Ranks oder Ferenczis [VIII-028] „Treulosigkeit“ zur Debatte stand, innerhalb des Geheimkomitees heftige Kämpfe und Eifersüchteleien zwischen Abraham, Jones und, in gewissem Maße, Eitingon auf der einen und Rank und Ferenczi auf der anderen Seite entstanden. Bereits 1924, als Rank sein Buch über das Geburtstrauma veröffentlichte, das Freud freundlich aufnahm, verdächtigte Abraham – „da er hörte, dass Freud für Kritik (...) ein offenes Ohr habe“ (E. Jones, 1960-1962, Band III, S. 83) – Rank, er folge Jung auf dem Weg zum „Verrat“.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959120845
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (September)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Christusdogma Sozialpsychologie Religion