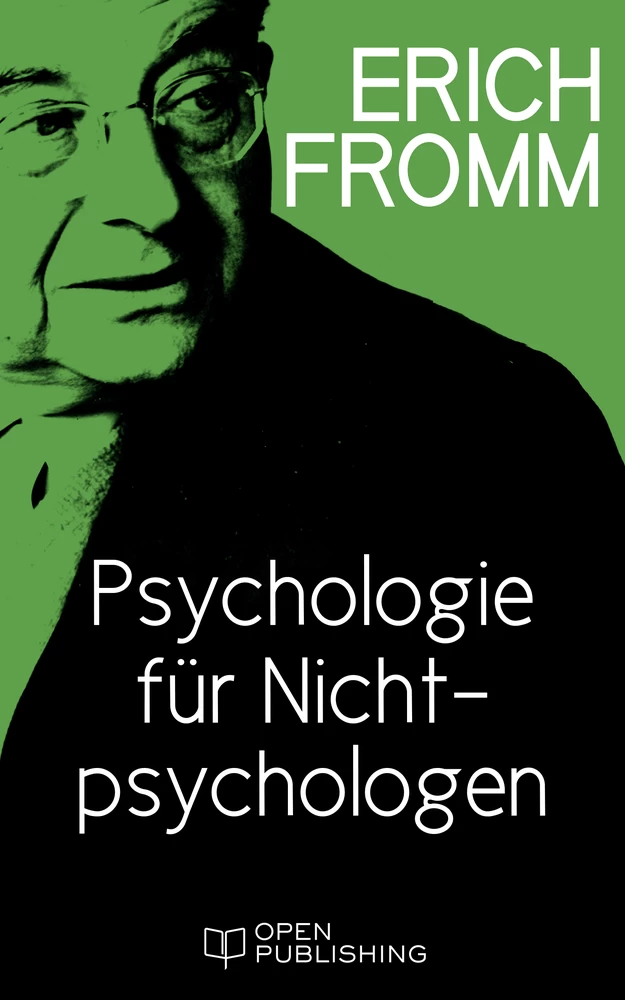Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in H. J. Schultz „Psychologie für Nichtpsychologen“
- Inhalt
- 1. Vormoderne und moderne Psychologie
- 2. Die Psychoanalyse Sigmund Freuds
- a) Verdrängung
- b) Widerstand
- c) Übertragung
- 3. Die Weiterentwicklung der Psychoanalyse
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Einführung in H. J. Schultz „Psychologie für Nichtpsychologen“
Erich Fromm
(1974a)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk
Zuerst am 1. November 1973 als Einführungsvortrag in die Sendereihe „Psychologie für Nichtpsychologen“ im Süddeutschen Rundfunk gehalten. Erstveröffentlichung der Printversion 1974 unter dem Titel Einführung, in: H. J. Schultz (Hg.), Psychologie für Nichtpsychologen, Stuttgart (Kreuz-Verlag), S. 11-33. Mit textlichen Verbesserungen durch Rainer Funk unter dem Titel Einführung in H. J. Schultz „Psychologie für Nichtpsychologen“ Übernahme 1981 in die Erich Fromm Gesamtausgabe in zehn Bänden, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt, Band VIII, S. 71-90, sowie 1983 in E. Fromm, Über die Liebe zum Leben. Rundfunksendungen, hg. von Hans Jürgen Schultz, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt), S. 85-109.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, Band VIII, S. 71-90.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1974 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
Inhalt
1. Vormoderne und moderne Psychologie
Der Titel dieses Buches heißt Psychologie für Nichtpsychologen. Wer sind denn Nichtpsychologen? Und was ist Psychologie?[1]
Wer Nichtpsychologen sind, lässt sich vielleicht beantworten, und zwar scheinbar einfach: nämlich alle Leute, die nicht Psychologie studiert haben, die keinen Doktorhut dieses Fachbereiches besitzen. Dann sind natürlich fast alle Menschen keine Psychologen. Aber das stimmt so nicht. Denn ich möchte behaupten, dass es Nichtpsychologen in Wirklichkeit überhaupt nicht gibt, da jeder Mensch in seinem Leben auf seine Weise Psychologie betreibt und betreiben muss. Er muss wissen, was im anderen vorgeht, er muss versuchen, andere zu verstehen. Er muss sogar versuchen vorauszusehen, wie andere sich verhalten werden. Dazu geht er nicht in das Labor einer Universität, sondern er geht – und eigentlich braucht er gar nicht erst zu gehen – in sein eigenes Labor, in das Labor des täglichen Lebens, in dem alle Experimente und alle Fälle von ihm durchdacht oder überlegt werden können. Die Frage lautet also gar nicht: Ist jemand Psychologe oder ist er Nichtpsychologe, sondern sie heißt nur: Ist jemand ein guter oder ein schlechter Psychologe? Und da, glaube ich, könnte das Studium der Psychologie ihm helfen, ein besserer Psychologe zu werden.
Damit kommen wir zur zweiten Frage: Was ist denn Psychologie? Diese Frage ist viel schwerer zu beantworten als die erste. Wir müssen uns ein bisschen Zeit für sie nehmen. Wörtlich heißt „Psychologie“ Wissenschaft von der Seele. Aber das sagt uns noch sehr wenig darüber, was diese Wissenschaft von der Seele eigentlich ist: was sie zum Gegenstand hat, welche Methoden sie anwendet, was ihr Ziel ist.
Die meisten Menschen denken, dass die Psychologie eine relativ moderne Wissenschaft sei. Sie meinen das deshalb, weil das Wort „Psychologie“ im Großen und Ganzen erst in den letzten 100 oder 150 Jahren bekanntgeworden ist. Sie vergessen jedoch, dass es eine Psychologie gibt, die vormodern ist, die sich – sagen wir mal – vom Jahre 500 vor Christus bis ins Siebzehnte Jahrhundert hineinerstreckt, dass diese Psychologie sich aber nicht „Psychologie“ genannt hat, sondern „Ethik“, oder auch sehr häufig „Philosophie“; sie war aber nichts anderes als Psychologie. Was waren denn das Wesen und die Absicht dieser vormodernen Psychologie? Darauf kann man ziemlich knapp erwidern: Es war die Kenntnis der Seele des Menschen mit dem Ziel, ein besserer [VIII-074] Mensch zu werden. Die Psychologie hatte also ein moralisches, ein – man könnte auch sagen – religiöses, ein spirituelles Motiv.
Ich gebe nur ganz kurz einige Beispiele dieser vormodernen Psychologie: Der Buddhismus hat eine ausgedehnte und höchst komplizierte und differenzierte Psychologie. Aristoteles hat ein Lehrbuch der Psychologie geschrieben, nur hat er es Ethik genannt. Die Stoiker haben eine hochinteressante Psychologie entwickelt; manche von Ihnen werden vielleicht Marc Aurels Meditationen kennen. Sie finden bei Thomas von Aquin ein System der Psychologie, aus dem Sie wahrscheinlich mehr lernen können als aus den meisten Textbüchern der Psychologie von heute. Es gibt dort die interessantesten und tiefsten Diskussionen und Prüfungen von Begriffen wie: Narzissmus, Stolz, Demut, Bescheidenheit, Minderwertigkeitsgefühle und vieles mehr.
Ähnlich ist es bei Spinoza, der eine Psychologie geschrieben und sie – wie Aristoteles – Ethik genannt hat. Spinoza ist wohl der erste große Psychologe, der ganz klar das Unbewusste erkannt hat, indem er sagte: Wir sind uns alle unserer Wünsche bewusst, wir sind uns aber nicht der Motive unserer Wünsche bewusst.[2] Und das ist in der Tat, wie wir nachher noch sehen werden, die Grundlage der viel später kommenden Freudschen Tiefenpsychologie.
In der Moderne kommt dann eine ganz andere Psychologie auf, die im Großen und Ganzen nicht so sehr viel älter als 100 Jahre ist. Deren Ziel ist ein ganz anderes: Man will die Seele kennen, nicht um ein besserer, sondern – sagen wir es einmal ganz roh und grob – um ein erfolgreicherer Mensch zu werden. Man will sich kennen, man will andere kennen, um größere Vorteile im Leben zu haben, um andere zu manipulieren, um sich selbst so zu gestalten, wie es am günstigsten ist, wenn man vorankommen will.
Diesen Unterschied zwischen den Aufgaben der vormodernen und der modernen Psychologie versteht man nur ganz, wenn man sieht, wie sehr sich die Kultur und die Ziele der Gesellschaft geändert haben. Gewiss waren im klassischen Griechenland oder im Mittelalter die Menschen im allgemeinen auch nicht so sehr viel besser, als wir es heute sind, vielleicht waren sie sogar schlechter in ihrem täglichen Verhalten; aber ihr Leben war doch beherrscht von einer Idee. Diese lautete: Das Leben ist nicht lebenswert, nur um sich sein Brot zu verdienen, das Leben muss auch einen Sinn haben, das Leben muss der Entfaltung des Menschen dienen. In diesem Zusammenhang steht die Psychologie.
Der moderne Mensch sieht es anders. Er ist nicht so sehr daran interessiert, mehr zu sein, als daran, mehr zu haben: eine größere Position, mehr Geld, mehr Macht, mehr Ansehen. Und wir wissen heute schon – und das spricht sich immer mehr herum, man sieht es vielleicht am deutlichsten in dem ökonomisch fortgeschrittensten und reichsten Land der Welt, in den Vereinigten Staaten –, dass allmählich immer mehr Menschen anfangen zu zweifeln, ob diese Ziele sie wirklich glücklich machen. Aber das gehört nicht hierher. Die Tatsache bleibt, dass diese zwei Ziele auch der Psychologie zwei verschiedene Richtungen geben. Über diese moderne Psychologie will ich jetzt einiges ausführen, um Ihnen zu zeigen, was man sich darunter vorzustellen hat.
Die moderne Psychologie hat ganz bescheiden angefangen. Sie hat sich dafür interessiert, das Gedächtnis zu studieren, akustische und visuelle Erscheinungen, [VIII-075] Gedankenassoziationen, und sie hat sich für die Psychologie der Tiere interessiert. Der Name von Wundt ist der vielleicht bezeichnendste und wichtigste bei diesem Start der modernen Psychologie. Diese Psychologen schrieben nicht für das breite Publikum, sie waren nicht besonders bekannt, sie schrieben für Fachgenossen, und nur wenige „Laien“ interessierten sich für ihre Arbeiten und Veröffentlichungen.
Das wurde aber völlig anders, als die Psychologie anfing, populär zu werden, indem sie sich einer Grundfrage zuwendete: der Frage nach den Motiven des menschlichen Verhaltens. Das blieb das Thema der Psychologie in den letzten 50 Jahren. Die Frage geht natürlich jeden an; denn jeder möchte ja wissen: Was motiviert mich eigentlich, warum bin ich so und nicht anders motiviert? Und wenn die Psychologie ihm verspricht, darüber etwas auszusagen, dann allerdings ist das für ihn von großem Wert. So wurde diese Motivationspsychologie vielleicht die populärste Wissenschaft unter allen, und besonders in den letzten zwei Jahrzehnten hat sie an Popularität nichts verloren, sondern eher gewonnen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959120685
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (August)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Basiswissen