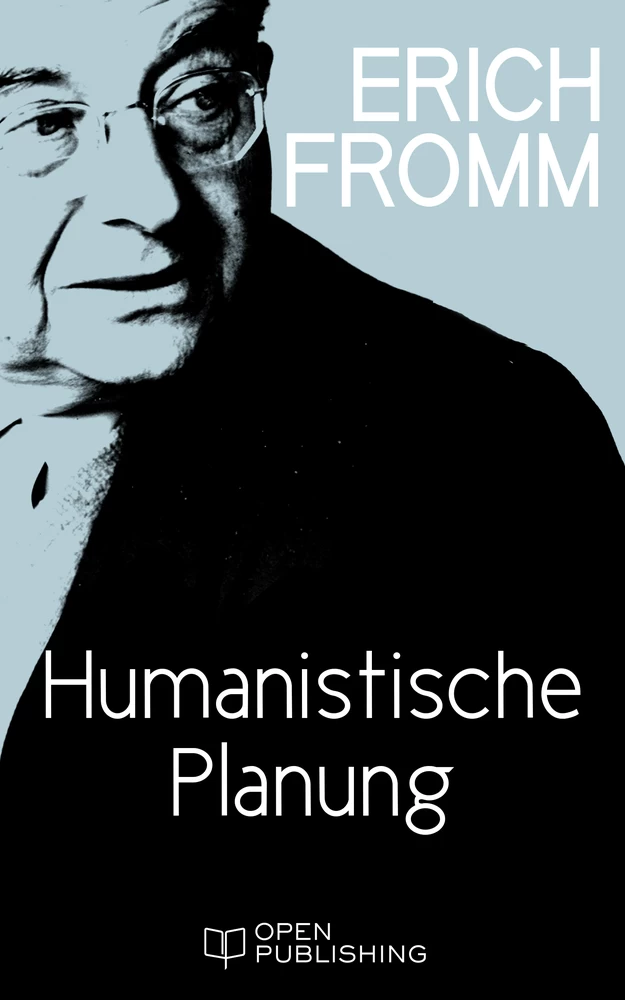Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Humanistische Planung
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Humanistische Planung
(Humanistic Planning)
Erich Fromm
(1970e)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk
Aus dem Amerikanischen von Hilde Weller
Erstveröffentlichung unter dem Titel Humanistic Planning in: E. Fromm, The Crisis of Psychoanalysis. Essays on Freud, Marx and Social Psychology bei Holt, Rinehart and Winston, New York, 1970, S. 59-68. Aus dem Amerikanischen von Hilde Weller übersetzt, erschien der Beitrag 1970 erstmals auf Deutsch unter dem Titel Humanistische Planung in: E. Fromm, Analytische Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie (1970a), S. 162-173, beim Suhrkamp Verlag in Frankfurt am Main. 1981 wiederabgedruckt in Erich Fromm Gesamtausgabe in zehn Bänden, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt), GA IX, S. 29-36.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, GA IX, S. 29-36.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1970 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
Untersucht man die Überschneidungen, die es zwischen betriebswirtschaftlicher Planung und Regierungsplanung gibt, so erkennt man bald, dass der Gegenstand auch die Überschneidungen zwischen Psychologie und Sozialphilosophie einerseits und Management und Planung andererseits in sich schließt.[1] Das letztgenannte Konvergenzfeld umfasst zwei wichtige Bereiche; der eine davon ist offensichtlich die Arbeit der Betriebspsychologen. Vielleicht der wichtigste Schritt, aus dem alle späteren Arbeiten resultierten, wurde von Elton Mayo mit seinem berühmten Experiment an der Hawthorne Plant von General Electric getan, als er die Wirkung verschiedener Maßnahmen zur Lenkung oder Nutzung der an den Arbeitsvorgängen beteiligten Menschen auf die Produktion untersuchte.[2]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959120654
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (August)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Systemgedanke