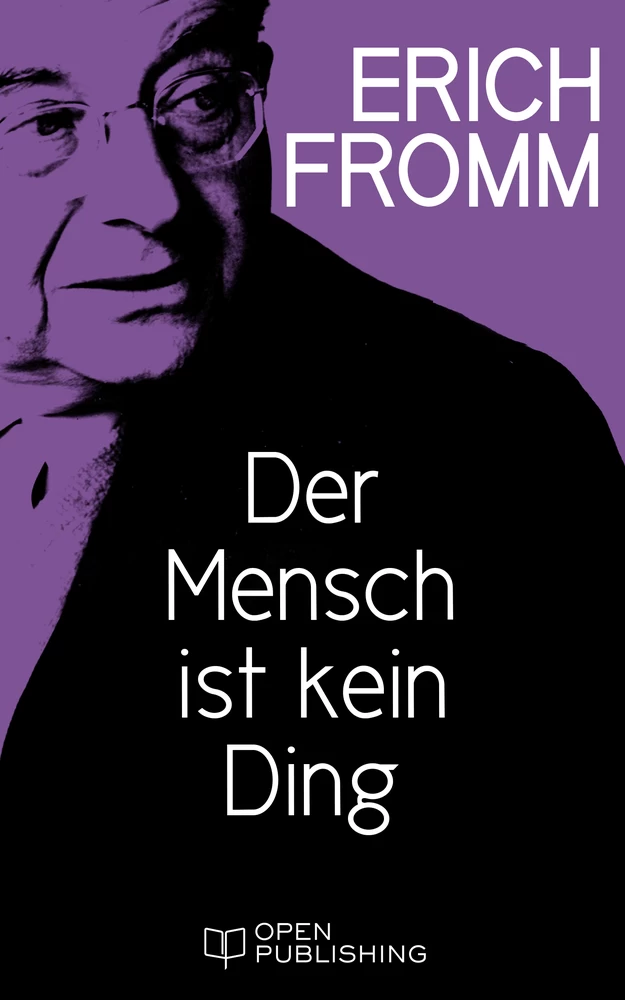Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Der Mensch ist kein Ding
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Der Mensch ist kein Ding
(Man Is Not a Thing)
Erich Fromm
(1957a)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk
aus dem Amerikanischen Carola Dietlmeier, überarbeitet von Rainer Funk
Erstveröffentlichung unter dem Titel Man Is Not a Thing, in: Saturday Review, New York 40 (16. 3. 1957), S. 9-11, dann in leicht veränderter Fassung unter dem Titel On the Limitations and Dangers of Psychology, in: W. Leibrecht (Hg.), Religion and Culture. Essays in Honor of Paul Tillich, New York (Harper and Bros.), 1959, sowie 1963 in E. Fromm: The Dogma of Christ and Other Essays, New York (Holt, Rinehart and Winston). In deutscher Übersetzung erschien der Beitrag erstmal 1965 unter dem Titel Über die Grenzen und Gefahren der Psychologie in: E. Fromm, Das Christusdogma und andere Essays, beim Szczesny Verlag. Die von Carola Dietlmeier besorgte Übersetzung fand in überarbeiteter Form Eingang in die Erich Fromm Gesamtausgabe in zehn Bänden, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1980, Band VIII, S. 21-26.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, Band VIII, S. 21-26.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1957 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
Die wachsende Popularität der Psychologie[1] in unseren Tagen wird von vielen als vielversprechendes Zeichen dafür gewertet, dass wir uns der Verwirklichung der delphischen Forderung „Erkenne dich selbst“ nähern. Ohne Zweifel gibt es Anhaltspunkte für diese Auffassung. Der Gedanke der Selbsterkenntnis wurzelt in der griechischen und jüdisch-christlichen Tradition. Er ist Bestandteil einer aufklärerischen Haltung. James und Freud waren tief in dieser Tradition verwurzelt, und sie haben zweifellos dazu beigetragen, diesen positiven Aspekt der Psychologie in unsere Gegenwart hineinzutragen. Diese Tatsache darf aber nicht dazu führen, gewisse andere Aspekte des gegenwärtigen Interesses an der Psychologie zu ignorieren, die für die geistige Entwicklung des Menschen gefährlich und zerstörerisch sind. Von eben diesen Aspekten handelt der folgende Beitrag.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959120579
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (August)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychologie Psychoanalyse Sozialpsychologie Mensch