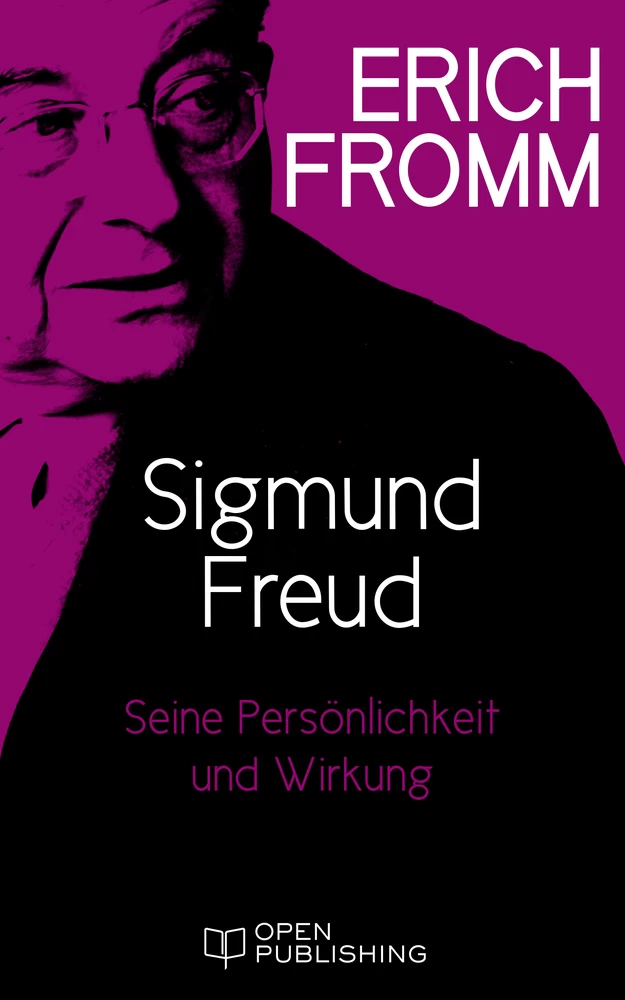Zusammenfassung
Erich Fromm – selbst Psychoanalytiker – wagt sich in diesem Buch an die Analyse des berühmten Wiener Seelenarztes. Er beschäftigt sich mit Freuds Kindheit, seinen Eltern, seinen Beziehungen, seinen religiösen und politischen Überzeugungen und seiner leidenschaftlichen Suche nach der Wahrheit. So sehr Fromm Freuds Leistungen würdigt, so kritisch sieht er manche Aspekte der Theorien und Persönlichkeit von Freud.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Sigmund Freud. Seine Persönlichkeit und seine Wirkung
- Inhalt
- 1. Freuds leidenschaftliche Suche nach Wahrheit und sein Mut
- 2. Freuds Verhältnis zu seiner Mutter – sein Selbstvertrauen und seine Unsicherheit
- 3. Freuds Beziehung zu Frauen: Freud und die Liebe
- 4. Freuds Abhängigkeit von Männern
- 5. Freuds Beziehung zu seinem Vater
- 6. Freuds autoritäre Einstellung
- 7. Freud als Weltverbesserer
- 8. Der quasi-politische Charakter der psychoanalytischen Bewegung
- 9. Freuds religiöse und politische Überzeugungen
- 10. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
- Literatur
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Sigmund Freud.
Seine Persönlichkeit und seine Wirkung
(Sigmund Freud’s Mission
An Analysis of His Personality and Influence)
Erich Fromm
(1959a)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk
Aus dem Amerikanischen von Renate Oetker-Funk und Christiane von Wahlert auf der Basis der Übersetzung von A. R. L. Gurland
Erstveröffentlichung unter dem Titel Sigmund Freud’s Mission. An Analysis of His Personality and Influence als Band 21 der „World Perspectives“, geplant und herausgegeben von Ruth Nanda Anshen, New York 1959 (Harper and Bros.). Eine deutsche Übersetzung von A. R. L. Gurland erschien erstmals 1967 als Band 9 der „Weltperspektiven“ im Verlag Ullstein unter dem Titel Sigmund Freuds Sendung. Persönlichkeit, geschichtlicher Standort und Wirkung. Für die Veröffentlichung in der zehnbändigen Erich Fromm-Gesamtausgabe 1980 wurde die Übersetzung stark überarbeitet und der Titel Sigmund Freud. Seine Persönlichkeit und seine Wirkung gewählt. Ab 1980 fand diese Neufassung auch Eingang in die Einzelpublikationen beim Ullstein Verlag und beim Deutschen Taschenbuch Verlag.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, Band VIII, S. 153-221.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1959 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
Inhalt
-
Sigmund Freud. Seine Persönlichkeit und seine Wirkung
- Inhalt
- 1. Freuds leidenschaftliche Suche nach Wahrheit und sein Mut
- 2. Freuds Verhältnis zu seiner Mutter – sein Selbstvertrauen und seine Unsicherheit
- 3. Freuds Beziehung zu Frauen: Freud und die Liebe
- 4. Freuds Abhängigkeit von Männern
- 5. Freuds Beziehung zu seinem Vater
- 6. Freuds autoritäre Einstellung
- 7. Freud als Weltverbesserer
- 8. Der quasi-politische Charakter der psychoanalytischen Bewegung
- 9. Freuds religiöse und politische Überzeugungen
- 10. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
- Literatur
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
1. Freuds leidenschaftliche Suche nach Wahrheit und sein Mut
Die Psychoanalyse war, wie Freud selbst gern betonte, seine Schöpfung. Ihre großen Errungenschaften, aber auch ihre Mängel tragen den Stempel der Persönlichkeit ihres Begründers. Zweifellos ist daher der Ursprung der Psychoanalyse in Freuds Persönlichkeit zu suchen.[1]
Was für ein Mensch war Sigmund Freud? Was waren die treibenden Kräfte, die ihn in seiner besonderen Art handeln, denken und fühlen ließen? War er, wie ihn seine Gegner sahen, ein dekadenter Wiener, verwurzelt in der sinnlichen und disziplinlosen Atmosphäre, die gemeinhin als typisch wienerisch gilt – oder war er, wie seine getreuesten Anhänger behaupten, der große Meister, ohne persönliche Schwächen, furchtlos und unnachgiebig in seiner Suche nach Wahrheit, liebevoll der Familie zugetan, gütig zu seinen Schülern und gerecht allen Feinden gegenüber, ohne Eitelkeit und Selbstsucht? Will man Freuds komplexe Persönlichkeit und die Wirkung dieser Persönlichkeit auf die Struktur der Psychoanalyse erfassen, so kommt man weder mit Verunglimpfung noch mit Heldenverehrung ans Ziel. Dieselbe Objektivität, die Freud als eine entscheidende Voraussetzung für die Analyse seiner Patienten entdeckte, ist notwendig, wenn wir uns ein Bild zu machen versuchen, wer er war und was ihn motivierte.
Die auffallendste und wahrscheinlich stärkste emotionale Kraft in Freud war seine Leidenschaft für Wahrheit und sein kompromissloser Glaube an die Vernunft. Für ihn war die Vernunft die einzige menschliche Fähigkeit, die dazu beitragen kann, das Problem der Existenz zu lösen oder zumindest das dem menschlichen Leben innewohnende Leid zu lindern.
Freud sah in der Vernunft das alleinige Werkzeug – oder die einzige Waffe –, die wir besitzen, um das Leben sinnvoll zu machen, uns von Illusionen zu befreien (zu ihnen zählen nach Freud auch die religiösen Glaubensvorstellungen), unabhängig von fesselnden Autoritäten zu werden und so unsere eigene Autorität aufzurichten. Immer wenn er in der Komplexität und Vielfalt der wahrnehmbaren Erscheinungen eine theoretische Wahrheit erkannte, dann war dieser Glaube an die Vernunft die Grundlage seiner unermüdlichen Suche nach der Wahrheit. Es störte Freud nicht, wenn seine Ergebnisse vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes aus gesehen [VIII-156] absurd erschienen. Im Gegenteil – das Lachen der Menge, deren Denken vom Wunsch nach Bequemlichkeit und nach ungestörtem Schlaf bestimmt war, umriss für ihn nur noch schärfer den Unterschied zwischen Überzeugung und bloßer Meinung, Vernunft und gesundem Menschenverstand, Wahrheit und Rationalisierung.
Mit seinem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Vernunft war Freud ein Kind des Zeitalters der Aufklärung. Ihre Devise Sapere aude! – „Wage zu wissen!“ – prägte Freuds Persönlichkeit und sein gesamtes Werk. Entstanden war dieser Glaube in der Emanzipation des westlichen Bürgertums von den Fesseln und dem Aberglauben der feudalen Gesellschaft. Spinoza und Kant, Rousseau und Voltaire hatten, so verschieden ihre philosophischen Lehren auch sein mochten, diesen leidenschaftlichen Glauben an die Vernunft geteilt; sie alle waren im Kampf für eine neue, wahrhaft aufgeklärte, freie und humane Welt verbunden. Dieser Geist lebte weiter im west- und mitteleuropäischen Bürgertum des 19. Jahrhunderts, vor allem unter den Studenten, die sich dem Fortschritt der Naturwissenschaften hingaben. Erst recht verstärkte Freuds jüdische Herkunft seine Verbundenheit mit dem Geist der Aufklärung.[2] Die jüdische Tradition selbst war eine Tradition der Vernunft und der intellektuellen Disziplin; überdies hatte eine in gewissem Sinn missachtete Minderheit ein starkes emotionales Interesse daran, die Mächte der Finsternis, der Irrationalität und des Aberglaubens zu bekämpfen, die ihr den Weg zu ihrer Emanzipation und zum Fortschritt versperrten.
Neben diesem allgemeinen Trend in der europäischen Intelligenz des späten 19. Jahrhunderts gab es besondere Umstände in Freuds Leben, die seine Neigung verstärkten, auf die Vernunft und nicht auf die öffentliche Meinung zu bauen.
Ganz im Gegensatz zu allen westlichen Großmächten war die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie zu Freuds Lebzeiten ein zerfallendes Gebilde. Sie hatte keine Zukunft vor sich. Mehr als alles andere hielt die Macht der Trägheit die einzelnen Teile der Monarchie zusammen, trotz der Tatsache, dass ihre nationalen Minderheiten verzweifelt um ihre Unabhängigkeit kämpften. Dieser Zustand eines politischen Verfalls und politischer Auflösungserscheinungen war dazu geeignet, in einem intelligenten Jungen Verdacht zu erwecken und seinen fragenden Verstand zu schärfen. Die Diskrepanz zwischen der offiziellen Ideologie und den Tatsachen der politischen Realität musste das Vertrauen in die Gültigkeit von Worten, Parolen und autoritativen Erklärungen schwächen und kritisches Denkvermögen fördern. In Freuds speziellem Fall muss noch ein weiterer Unsicherheitsfaktor diese Entwicklung gefördert haben: Freuds Vater, ein wohlhabender kleiner Fabrikant in Freiberg (Pribor) im nördlichen Mähren, musste seinen Betrieb wegen der Veränderungen in der ganzen österreichischen Wirtschaft, die auch Freiberg trafen und verarmen ließen, aufgeben. [VIII-157]
Der Knabe Freud lernte in jungen Jahren durch drastische Erfahrungen, dass nicht nur auf die politische, sondern auch auf die soziale Stabilität kein Verlass war, dass weder Tradition noch hergebrachte Ordnung Sicherheit boten und Vertrauen verdienten. Zu welchem anderen Ergebnis konnten solche Erlebnisse einen ungewöhnlich begabten Jungen bringen als dazu, sich nur noch auf sich selbst und auf die Vernunft zu verlassen? Anderen Waffen war nicht zu trauen.
Gewiss gab es viele andere Jungen, die unter denselben Umständen aufwuchsen, und die keine Freuds wurden und keine derartige Leidenschaft für Wahrheit entwickelten. Es muss in Freuds Persönlichkeit besondere, nur ihm eigene Elemente gegeben haben, die für die außerordentliche Intensität dieser Qualität verantwortlich waren. Welches waren diese Elemente?
Zweifellos müssen wir zunächst die überdurchschnittliche intellektuelle Begabung und Vitalität erwähnen, die zu Freuds Konstitution gehörte. Diese außerordentliche intellektuelle Begabung, verbunden mit dem Klima der Aufklärungsphilosophie, die Zerrüttung des herkömmlichen Zutrauens zu Worten und Ideologien: Dies alles mag schon hinreichend erklären, warum sich Freud an die Vernunft hielt. Es mag andere, rein persönliche Faktoren geben; so zum Beispiel Freuds Wunsch nach Prominenz, die zu seinem Vertrauen auf die Vernunft geführt haben können, da ihm keine andere Macht, sei es Geld, soziales Prestige oder physische Kraft zur Verfügung stand. Suchen wir aber nach noch persönlicheren Elementen in Freuds Charakter, die seine leidenschaftliche Suche nach Wahrheit erklären können, so stoßen wir auf ein negatives Element in seinem Charakter: seinen Mangel an emotionaler Wärme und menschlicher Nähe, an Liebe und darüber hinaus an Lebensfreude. Das mag, wenn vom Entdecker des „Lustprinzips“ und vom vermeintlichen Protagonisten sexueller Lust die Rede ist, erstaunlich klingen; indes sprechen die Tatsachen eine zu laute Sprache, als dass sie Zweifel hinterlassen könnten. Später werde ich zur Bekräftigung dieser Aussage Beweise anführen; hier sei vorerst nur festgestellt: Ein Knabe, den es so sehr nach Ruhm und Anerkennung verlangte wie Sigmund Freud und der eine so geringe Lebensfreude besaß, hatte bei seiner Begabung, in seinem kulturellen Klima, und angesichts der besonderen europäischen, österreichischen und jüdischen Faktoren in seiner Umgebung keine andere Möglichkeit, seine Wünsche zu erfüllen, als indem er sich dem Abenteuer des Erkennens verschrieb. Andere Persönlichkeitselemente mögen dazu beigetragen haben: Freud war ein sehr unsicherer Mensch, er fühlte sich leicht bedroht, verfolgt, verraten und hatte daher, wie nicht anders zu erwarten, ein großes Verlangen nach Gewissheit. In Anbetracht seiner ganzen Persönlichkeit konnte es für ihn keine Gewissheit in der Liebe geben – Gewissheit gab es nur in der Erkenntnis, und er musste die Welt intellektuell erobern, um vom Zweifel und vom Gefühl des Versagens loszukommen.
Ernest Jones, der Freuds leidenschaftliches Streben nach Wahrheit als „das tiefste und stärkste Motiv seines Wesens (...) und eben das, welches ihn zu seinen Pionierleistungen vorwärtstrieb“, begreift (E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 506), bemüht sich um eine Erklärung im Rahmen der orthodoxen psychoanalytischen Theorie. Danach hat die Wissensbegierde des Kindes „ihren letzten Beweggrund in der infantilen Neugierde, die sich auf die primären Tatsachen des Lebens richtet: die Bedeutung der [VIII-158] Geburt und dessen, was zu ihr geführt hat“ (E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 506). Mir scheint, dass hier eine bedauerliche Verwechslung vorliegt; Neugierde ist nicht dasselbe wie Glaube an die Vernunft. Bei sehr neugierigen Menschen mag sich eine frühzeitige und besonders intensive Sexualneugier nachweisen lassen, doch lässt sich schwerlich sagen, dass damit leidenschaftlicher Durst nach Wahrheit Hand in Hand gehe. Nicht sehr viel überzeugender ist ein anderes Argument, das Jones geltend macht: Freuds Halbbruder Philipp war ein Mann, der gerne scherzte, und in dem Freud den Ehepartner der Mutter vermutete und „den er weinend gebeten hatte, die Mutter nicht wieder zu schwängern“ (E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 508).
Konnte man sicher sein, dass ein solcher Mensch, der offensichtlich alle Geheimnisse kannte, darüber die Wahrheit sagen würde? Es wäre eine seltsame Laune des Schicksals, wenn sich erwiese, dass dieser unbedeutende kleine Mann – er soll als Hausierer geendet haben – durch seine bloße Existenz das ausgelöst hätte, was den späteren Freud bewog, nur sich selbst zu trauen, jedem Impuls, anderen mehr als sich selbst zu glauben, Widerstand zu leisten, und somit den Namen Freuds unsterblich gemacht hätte. (E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 508.)
Hätte Jones recht, so wäre es in der Tat eine „seltsame Laune des Schicksals“. Ist es aber nicht zu einfach, Freuds Ideen mit der Existenz eines Halbbruders und seiner sexuellen Scherze, denen Freud nicht traute, zu „erklären“?
Wenn wir über Freuds leidenschaftliche Suche nach Wahrheit und Vernunft sprechen, müssen wir schon hier etwas vorwegnehmen, was erst ausgeführt werden kann, wenn wir ein vollständigeres Bild von Freuds Charakter erhalten haben: Für Freud erschöpfte sich Vernunft im Denken; Gefühle und Emotionen galten ihm per se als irrational und deshalb dem Denken gegenüber als minderwertig. Diese Verachtung von Gefühl und Affekt teilte Freud mit den Philosophen der Aufklärung. Ihnen galt das Denken als der einzige Träger des Fortschritts, und nur im Denken gab es für sie Vernunft. Sie sahen nicht, was Spinoza gesehen hatte: Wie das Denken, so können auch Affekte sowohl rational als auch irrational sein, und die volle Entwicklung des Menschen erfordert die rationale Weiterentwicklung beider, des Denkens und der Affekte. Sie sahen nicht, dass die Abspaltung des Denkens vom Fühlen sowohl das Denken als auch das Fühlen entstellt, und dass ein Menschenbild, das auf der Annahme dieser Spaltung [von Denken und Fühlen] basiert, ebenso entstellt ist.
Diese rationalistischen Denker waren überzeugt, dass der Mensch nur die Ursachen seines Elends intellektuell zu verstehen braucht, um aus diesem intellektuellen Wissen auch die Macht zu schöpfen, die Umstände zu verändern, die sein Leiden verursachen. Von dieser Haltung war Freud stark beeinflusst, und er hat Jahre gebraucht, um von der Annahme loszukommen, dass das bloß intellektuelle Wissen der Ursachen neurotischer Symptome auch schon deren Heilung mit sich bringt.
Solange nur von Freuds leidenschaftlicher Suche nach Wahrheit die Rede ist, bleibt das Bild unvollständig. Um es zu vervollständigen, müssen wir gleichzeitig eine seiner hervorragenden Qualitäten erwähnen: seinen Mut. Viele Menschen haben potentiell ein leidenschaftliches Streben nach Vernunft und nach Wahrheit. Dieses Potential in die Wirklichkeit umzusetzen, ist aber deswegen so schwer, weil dazu Mut gehört, und dieser Mut ist selten, weil es ein Mut besonderer Art ist. Es geht hier nicht in erster Linie um den Mut, sein Leben, Freiheit und Besitz aufs Spiel zu setzen, [VIII-159] obwohl auch dieser Mut selten ist. Wer den Mut hat, ganz der Vernunft zu trauen, nimmt die Gefahr der Isolierung und des Alleinseins auf sich, und für viele ist diese Gefahr unerträglicher als eine Bedrohung des Lebens. Gerade die Suche nach Wahrheit setzt den Suchenden notwendig dieser Gefahr der Isolation aus. Wahrheit und Vernunft stehen im Gegensatz zum gesunden Menschenverstand und zur öffentlichen Meinung. Die Mehrheit klammert sich an bequeme Rationalisierungen und an Ansichten, die sich aus der oberflächlichen Betrachtung der Dinge herleiten lassen. Die Vernunft dagegen hat die Aufgabe, die Oberfläche zu durchstoßen und bis zum Wesentlichen vorzudringen, das sich unter ihr verbirgt; sie hat die Aufgabe, objektiv, das heißt ohne von den eigenen Wünschen und Ängsten bestimmt zu werden, zu erkennen, welche Kräfte die Welt und die Menschen bewegen. Dazu braucht der Mensch Mut, die Isolierung auszuhalten und den Spott und Hohn derer, die von der Wahrheit gestört werden und den Störenfried hassen. Freud besaß diese Fähigkeit in einem bemerkenswerten Maß. Er lehnte sich gegen seine Isolierung auf, er litt unter ihr, aber er war nie willens oder auch nur geneigt, sich auf den geringsten Kompromiss einzulassen, der die Isolierung möglicherweise erleichtert hätte. Dieser Mut war auch sein größter Stolz. Er bildete sich nicht ein, ein Genie zu sein, aber er schätzte seinen Mut als die hervorstechendste Qualität in seiner Persönlichkeit. Dieser Stolz mag zuweilen einen negativen Einfluss auf seine theoretischen Aussagen gehabt haben. Freud misstraute jeder theoretischen Formulierung, die als versöhnlich hätte aufgefasst werden können, und es gab ihm – wie Marx – eine gewisse Befriedigung, manche Dinge zu sagen, um den Bürger vor den Kopf zu stoßen – pour épater le bourgeois. Es ist nicht einfach, die Quellen des Mutes auszumachen. War er eine Gabe, mit der Freud zur Welt gekommen war? Inwieweit ist er das Ergebnis seines Gefühls für seine historische Sendung? Inwieweit ist er eine innere Stärke, die mit seiner Position als unanfechtbarer Lieblingssohn seiner Mutter zusammenhängt? Aller Wahrscheinlichkeit nach haben alle drei Quellen zu Freuds ungewöhnlichem Mut beigetragen. Darüber werden wir mehr erfahren, wenn wir in seinen Charakter einen tieferen Einblick gewonnen haben.
2. Freuds Verhältnis zu seiner Mutter – sein Selbstvertrauen und seine Unsicherheit
Will man die nicht-konstitutionellen Faktoren verstehen, die die charakterliche Entwicklung eines Menschen bestimmen, so muss man mit der Beziehung zur Mutter beginnen. Über diese Beziehung wissen wir bei Freud verhältnismäßig wenig. Aber die Tatsache, dass Freuds Mitteilungen über seine Mutter in seinen autobiographischen Versuchen sehr spärlich sind, ist in sich selbst bedeutsam. Nur zwei von über 30 eigenen Träumen, die er in der Traumdeutung wiedergibt, handeln von der Mutter. Da Freud viel und ausgiebig träumte, darf man annehmen, dass er nicht wenige Träume über seine Mutter für sich behalten hat. Die beiden veröffentlichten Träume drücken eine intensive Bindung an sie aus. Einen davon, den Traum „von den drei Parzen“, schildert Freud folgendermaßen:
Ich gehe in eine Küche, um mir Mehlspeise geben zu lassen. Dort stehen drei Frauen, von denen eine die Wirtin ist und etwas in der Hand dreht, als ob sie Knödel machen würde. Sie antwortet, dass ich warten soll, bis sie fertig ist (nicht deutlich als Rede). Ich werde ungeduldig und gehe beleidigt weg. Ich ziehe einen Überrock an; der erste, den ich versuche, ist mir aber zu lang. Ich ziehe ihn wieder aus, etwas überrascht, dass er Pelzbesatz hat. Ein zweiter, den ich anziehe, hat einen langen Streifen mit türkischer Zeichnung eingesetzt. Ein Fremder mit langem Gesicht und kurzem Spitzbart kommt hinzu und hindert mich am Anziehen, indem er ihn für den seinen erklärt. Ich zeige ihm nun, dass er über und über türkisch gestickt ist. Er fragt: Was gehen Sie die türkischen (Zeichnungen, Streifen...) an? Wir sind aber dann ganz freundlich miteinander. (S. Freud, 1900a, S. 210.)
Deutlich ist in diesem Traum der Wunsch, von der Mutter gefüttert zu werden. (Dass die „Wirtin“ – wie wahrscheinlich alle drei Frauen des Traums – die Mutter darstellt, ergibt sich eindeutig aus Freuds eigenen Assoziationen zu diesem Traum.) Was besonders auffällt, ist die Ungeduld des Träumenden. Da ihm bedeutet wird, er müsse warten, geht er „beleidigt“ von dannen. Der Traum jedoch bricht nicht ab: Er zieht einen Mantel mit Pelzbesatz an, der ihm zu lang ist, dann einen, der jemand anderem gehört. Wir sehen in diesem Traum die typische Reaktion eines Jungen, der von seiner Mutter vorgezogen wird: Er besteht darauf, von der Mutter gefüttert zu werden (was symbolisch ausdrückt, dass er versorgt, geliebt, geschützt, bewundert werden [VIII-161] will); er ist ungeduldig und wütend darüber, dass er nicht sofort „gefüttert“ wird, denn er fühlt sich berechtigt, sofortige Beachtung und ungeteilte Aufmerksamkeit zu verlangen. Seine Wut lässt ihn weggehen, aber dabei maßt er sich sogleich die Rolle des großen Mannes, des Vaters, an: Der Mantel ist zu lang und gehört einem Fremden.
Der zweite Traum, der mit der Mutter zu tun hat, stammt aus Freuds siebentem oder achtem Lebensjahr. Noch 30 Jahre später erinnert er sich daran: Der Traum „war sehr lebhaft und zeigte mir die geliebte Mutter mit eigentümlich ruhigem, schlafendem Gesichtsausdruck, die von zwei (oder drei) Personen mit Vogelschnäbeln ins Zimmer getragen und aufs Bett gelegt wird“ (S. Freud, 1900a, S. 589). Freuds Erinnerung sagt, er sei „weinend und schreiend“ aufgewacht – ein verständlicher Angstausbruch, da er ja vom Tode der Mutter geträumt hatte. Dass der Traum nach drei Jahrzehnten nicht verblasst war, unterstreicht seine Bedeutung.
Nimmt man beide Träume zusammen, so sieht man ein Kind, das von der Mutter mit Bestimmtheit die Erfüllung all seiner Wünsche erwartet und bei dem Gedanken, dass sie sterben könnte, zutiefst erschrocken ist. Dass Freud nur diese zwei Träume von der Mutter mitgeteilt hat, ist psychoanalytisch aufschlussreich und bestätigt Jones’ Annahme, „dass es in Freuds frühester Kindheit außerordentlich starke Beweggründe gegeben hat, eine wichtige Phase seiner Entwicklung zu verbergen – vielleicht vor ihm selbst. Ich möchte die Hypothese wagen, es handle sich um die tiefe Liebe zu seiner Mutter“ (E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 479). In dieselbe Richtung weisen andere Tatsachen, die wir aus Freuds Leben kennen. Dass er auf den elf Monate jüngeren Bruder Julius maßlos eifersüchtig war und die zweieinhalb Jahre jüngere Schwester Anna nie gemocht hat, braucht allein noch nicht viel zu besagen. Es gibt aber genauere und stichhaltigere Fakten. Am deutlichsten zeigt sich seine Stellung als Lieblingssohn an einem Vorfall, der sich ereignete, als seine Schwester etwa acht Jahre alt war.
Ihre sehr musikalische Mutter begann, ihr Klavierunterricht zu erteilen; aber das Klavierspiel störte den jungen Schüler, obgleich sein „Kabinett“ etwas abseits lag, so sehr, dass er verlangte, das Instrument müsse fort; es wurde tatsächlich weggeschafft. So kam es, dass sowohl Freuds Geschwister wie später seine Kinder ohne jede musikalische Ausbildung aufwuchsen. (E. Jones, 1960-1962, Bd. 1, S. 37).
Es ist nicht schwierig, sich die Position vorzustellen, die der zehn Jahre alte Junge bei seiner Mutter erreicht hatte, wenn er die musikalische Erziehung seiner Familie verhindern konnte, nur weil er das „Geräusch“ der Musik nicht leiden konnte.[3]
Die tiefe Zuneigung zur Mutter hat ihre Spuren auch in Freuds späterem Leben hinterlassen. Der vielbeschäftigte Arzt, der sich außer für seine Tarockrunde und seine Kollegen kaum für jemanden – auch nicht für seine Frau – Zeit nahm, besuchte die Mutter sein Leben lang, auch noch als alter Mann, jeden Sonntagmorgen, und jeden Sonntagabend war die Mutter bei Freuds zu Tisch.
Diese Bindung an die Mutter und die Rolle des bewunderten Lieblingssohnes hat eine [VIII-162] wichtige Bedeutung für die Entwicklung seines Charakters, die Freud selbst sah und in einem wahrscheinlich autobiographischen Sinne formulierte: „Wenn man der unbestrittene Liebling der Mutter gewesen ist, so behält man fürs Leben jenes Eroberergefühl, jene Zuversicht des Erfolges, welche nicht selten wirklich den Erfolg nach sich zieht.“ (S. Freud, 1917b, S. 26.)
Mutterliebe ist ihrem Wesen nach bedingungslos. Anders als der Vater liebt die Mutter das Kind, nicht weil es das verdient oder weil es etwas Liebenswertes tut, sondern weil es ihr Kind ist. Ebenso bedingungslos ist die Bewunderung der Mutter für ihren Sohn. Sie betet den Sohn an, nicht weil er dieses oder jenes tut, sondern weil er da ist und weil er ihr gehört. Noch intensiver tritt das zutage, wenn es sich um das Lieblingskind der Mutter handelt und wenn sie selbst an Vitalität und Vorstellungsvermögen dem Vater überlegen ist und in der Familie den Ton angibt: So war es offenbar in Freuds Elternhaus. (Vgl. E. Simon, 1957, S. 272.) Wer als Kind von der Mutter bewundert wird, bekommt leicht die Erfolgs- und Siegeszuversicht, von der Freud spricht, und braucht sie nicht erst zu erwerben; sie ist von vornherein da und über jeden Zweifel erhaben. Ein solches Selbstvertrauen versteht sich gleichsam von selbst; es fordert Achtung und Bewunderung von anderen und vermittelt den Eindruck, überlegen zu sein und nicht zum Durchschnitt zu gehören. Natürlich kommt dies von der Mutter geprägte souveräne Selbstvertrauen ebenso bei überdurchschnittlich begabten wie bei weniger begabten Menschen vor. Bei wenig Begabten folgt aus ihm häufig ein tragikomisches Missverhältnis zwischen Ansprüchen und Gaben; bei überdurchschnittlich Begabten ist es ein Ansporn, die natürlichen Talente und Begabungen zu entwickeln. Dass Freud mit diesem besonderen Selbstvertrauen gesegnet war, und dass es aus seiner Bindung an die Mutter herrührte, ist auch Jones’ Meinung:
Dieses Selbstvertrauen, das eines seiner Hauptmerkmale war, wurde nur selten erschüttert; er führt es zweifellos mit Recht auf das Gefühl der Sicherheit zurück, das die Liebe seiner Mutter ihm schenkte. (E. Jones, 1960-1962, Bd. 1, S. 22).
Die außergewöhnliche Intensität seiner Mutterbindung hat Freud nicht nur vor anderen verborgen, sondern allem Anschein nach auch vor sich selbst. Sie ist aber der Schlüssel nicht nur zu seinem Charakter, sondern auch zur Beurteilung einer seiner grundlegenden Entdeckungen: dessen, was er den Ödipuskomplex genannt hat. Die Wurzel der Bindung des Sohnes an die Mutter sah Freud – durchaus rationalistisch – in der sexuellen Anziehung der Frau, mit der der kleine Junge den meisten und intimsten Umgang hat. Denkt man daran, wie stark Freud selbst an seine Mutter gebunden war und wie sehr er dazu neigte, diese Bindung zu verdrängen, so kann man verstehen, warum er eine der mächtigsten menschlichen Strebungen, die Sehnsucht nach der Fürsorge, dem Schutz, der allumfassenden Liebe der Mutter und nach Bestätigung durch sie, in einem äußerst eingeengten Sinn deutete: als das eher begrenzte Verlangen des kleinen Jungen danach, dass die Mutter seine triebhaften Bedürfnisse befriedige. Freud hat eine der entscheidenden menschlichen Strebungen entdeckt: den Wunsch, an die Mutter – also an den Mutterschoß, die Natur, das vorindividuelle, vorbewusste Sein – gebunden zu bleiben; aber indem er den Geltungsbereich dieser Entdeckung auf den kleinen Sektor der triebhaften Wünsche reduzierte, hat er sie selbst negiert. Die Basis der Entdeckung war seine eigene intensive Mutterbindung, [VIII-163] und sein Widerstand, diese Bindung zu sehen, war der Grund für die Einschränkung und Entstellung dieser Entdeckung.[4]
Gewiss gehen von jeder Mutterbindung, auch von der glücklichsten, die unerschütterliches Vertrauen zur mütterlichen Liebe mit sich bringt, nicht nur positive Wirkungen aus: Das große Selbstvertrauen des bevorzugten Kindes ist nicht ihr einziges Werk; ihre negativen Wirkungen zeigen sich in einem Gefühl von Abhängigkeit und in Depressionen, wenn die beflügelnde Erfahrung bedingungsloser Liebe nicht fortdauert. In Freuds Charakterstruktur – und in der Struktur seiner Neurose – scheinen diese Abhängigkeit und Unsicherheit eine zentrale Stellung einzunehmen.
Einen sichtbaren Ausdruck fand Freuds Unsicherheit in der für den oral-rezeptiven Menschen charakteristischen Angst vor Hunger und Armut.[5] Da die Sicherheit des rezeptiven Menschen auf der Überzeugung beruht, dass er von der Mutter ernährt, gehegt, geliebt und bewundert wird, kreisen seine Ängste um die Gefahr des Ausbleibens dieser Liebe.
In einem Brief an Wilhelm Fließ vom 21. Dezember 1899 schreibt Freud: „Meine Phobie (...) war eine Verarmungsphantasie oder besser eine Hungerphobie, von meiner infantilen Gefräßigkeit abhängig und durch die Mitgiftlosigkeit meiner Frau (auf die ich stolz bin) hervorgerufen“ (S. Freud, 1950, S. 327). Von neuem klingt das Thema in einem Brief an Fließ vom 7. Mai 1900 an: „Ich bin (...) im allgemeinen – bis auf einen schwachen Punkt: der Angst vor der Not – zu verständig zu klagen und befinde mich auch sonst zu wohl dafür (...).“ (A.a.O., S. 340.)
Explosiv kam die Verarmungsangst in einem der dramatischsten Augenblicke in Freuds Leben zum Durchbruch. Als Freud 1910 seine Wiener Kollegen – hauptsächlich Juden – davon zu überzeugen versuchte, die Führung durch die Züricher – meist nicht-jüdische – Analytiker zu akzeptieren, und die Wiener seinem Vorschlag nicht zustimmen wollten, erklärte er: „Meine Feinde wären froh, mich verhungern zu sehen; sie würden mir am liebsten den Rock vom Leibe reißen“ (E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 91). Natürlich war dies eine rhetorische Floskel, dazu bestimmt, die zögernden Wiener mitzureißen; aber die Wahl dieser Floskel, die mit den Tatsachen wenig zu tun hatte, lässt sich nur als Symptom der Hunger- und Verarmungsangst verstehen, von der in den Briefen an Fließ die Rede ist.
Freuds Unsicherheit äußerte sich auch noch anders. Am auffälligsten waren die Ängste, die sich auf Eisenbahnreisen bezogen. Freud wollte unbedingt immer, um sicherzugehen, eine Stunde vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof sein. Was solche Symptome besagen, kann man nur erkennen, wenn man ihren symbolischen Sinn versteht. Oft ist Reisen ein Symbol dafür, die Sicherheit der Mutter und des elterlichen Heims zu verlassen, selbständig zu sein und sich von seinen Wurzeln loszureißen. Menschen, die stark an die Mutter gebunden sind, geht es häufig so, dass sie Reisen oft als gefährlich erleben, als ein Unternehmen, das besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordert. [VIII-164] Aus demselben Grund vermied es Freud, allein zu reisen. Auf seinen großen Reisen in den Sommerferien hatte er immer eine Begleitung bei sich, auf die er sich verlassen konnte: meistens einen seiner vertrautesten Schüler, manchmal die Schwester seiner Frau. Zum gleichen Muster der Angst vor Entwurzelung passt es ebenfalls, dass Freud seit den Anfängen seiner Ehe bis zum Tag seiner erzwungenen Emigration aus Osterreich in derselben Wohnung in der Wiener Berggasse wohnte. Wir werden später noch sehen, wie sich diese Abhängigkeit von seiner Mutter in der Beziehung zu seiner Frau, zu älteren und gleichaltrigen Männern und zu Schülern manifestierte; auf sie übertrug er das gleiche Bedürfnis nach bedingungsloser Liebe, Bestätigung, Bewunderung und Schutz.
3. Freuds Beziehung zu Frauen: Freud und die Liebe
Dass Freuds Abhängigkeit von einer Mutterfigur auch seine Beziehungen zu seiner Frau beherrschte, ist nicht verwunderlich. Sehr bezeichnend für diese Beziehung ist der auffallende Unterschied in Freuds Verhalten vor der Heirat und danach. Während der Jahre der Verlobungszeit war Freud ein glühender, leidenschaftlicher und überaus eifersüchtiger Liebhaber. Ein Zitat aus einem Brief an Martha vom 2. Juni 1884 ist ein charakteristischer Ausdruck für die Glut seiner Liebe:
Wehe, Prinzesschen, wenn ich komme. Ich küsse Dich ganz rot und füttere Dich ganz dick, und wenn Du unartig bist, wirst Du sehen, wer stärker ist, ein kleines sanftes Mädchen, das nicht isst, oder ein großer wilder Mann, der Kokain im Leibe hat. (E. Jones, 1960-1962, Bd. 1, S. 109.)
Die scherzhafte Kraftprobe – „wer stärker ist“ – hatte eine sehr ernste Bedeutung. In den Jahren der Verlobungszeit war Freud von dem leidenschaftlichen Wunsch besessen, Martha völlig zu beherrschen, und selbstverständlich verband sich dieser Wunsch mit einer maßlosen Eifersucht auf alle, denen sie außer ihm Interesse oder Zuneigung entgegenbringen mochte. Ein Cousin, Max Mayer, war ihr erster Schwarm gewesen, aber nun „kam eine Zeit, da Martha von ihm nur noch als Herr Mayer und nicht mehr als Max sprechen durfte“ (E. Jones, 1960-1962, Bd. 1, S.138). In Bezug auf einen anderen jungen Mann, der in Martha verliebt gewesen war, schrieb Freud 1882:
(...) wenn mir diese Erinnerungen kommen, in denen Du doch eigentlich so wenig belastet erscheinst, verliere ich die Herrschaft über mich, und wenn ich die Macht besäße, die ganze Welt, uns einbegriffen, zu zertrümmern, um sie von neuem spielen zu lassen, auf die Gefahr hin, dass sie nicht wieder mich und Martha hervorbringt, ich täte es unbedenklich. (E. Jones, 1960-1962, Bd. 1, S. 143.)
Freuds Eifersucht galt nicht nur jungen Männern, sie bezog sich auf Marthas zärtliche Gefühle für ihre Familie, wobei er auch keine Rücksicht darauf zu nehmen schien, dass seine Gebote und Verbote Martha verletzten.
Am meisten kränkte sie seine Zumutung, dass sie nicht nur ihre Mutter und ihren Bruder objektiv kritisieren und alle lächerlichen Rücksichten und jedes solche Vorurteil aufgeben solle, was sie alles tat, sondern dass sie nicht mehr liebhaben dürfe – mit der Begründung, sie seien seine Feinde und sie müsse seinen Hass gegen sie teilen. (E. Jones, 1960-1962, Bd. 1, S. 152.) [VIII-166]
Die gleiche Einstellung findet man in Freuds Verhalten gegen Marthas älteren Bruder Eli. Martha hatte Eli die Verwaltung eines Geldbetrages überlassen, der zu gegebener Zeit die Ausstattung der ersten Wohnung des Ehepaares Freud finanzieren sollte. Eli hatte dieses Geld anscheinend investiert und zögerte, den ganzen Betrag sofort zurückzugeben. Er schlug vor, dass die Möbel auf Abzahlung gekauft werden sollten. Als Reaktion darauf stellte Freud Martha ein Ultimatum: Seine erste Forderung besagte, Martha habe dem Bruder einen wütenden Brief zu schreiben und ihn einen „Schurken“ zu nennen. Auch nachdem Eli das Geld beschafft hatte, war Freud nicht zufriedengestellt. Er forderte, „sie dürfe ihm erst wieder schreiben, wenn sie verspreche, alle Beziehungen zu Eli abzubrechen“ (E. Jones, 1960-1962, Bd. 1, S. 169).
Die Vorstellung, dass es das natürliche Recht des Mannes sei, das Leben seiner Frau zu beherrschen, gehörte zu den Ansichten Freuds von der Überlegenheit des Mannes. Ein typisches Beispiel für diese Haltung ist seine Kritik an John Stuart Mill. Freud lobte Mill: „Er war vielleicht der Mann des Jahrhunderts, der es am besten zustande gebracht hat, sich von der Herrschaft der gewöhnlichen Vorurteile frei zu machen. Dafür – das geht ja immer zusammen – fehlte ihm der Sinn für das Absurde in manchen Punkten (...).“ (S. Freud, 1960, S. 73). Was Freud so besonders „absurd“ anmutete, war Mills Standpunkt „in der Frage der Frauenemanzipation und in der Frauenfrage überhaupt“ (S. Freud, 1960, S. 73). Mill war der Überzeugung, „dass die Frau in der Ehe so viel erwerben könne wie der Mann“ (S. Freud, 1960, S. 73). Freud sagte daraufhin:
Das ist im ganzen ein Punkt bei Mill, in dem man ihn einfach nicht menschlich finden kann. (...) Es ist auch ein gar zu lebensunfähiger Gedanke, die Frauen genauso in den Kampf ums Dasein zu schicken wie die Männer. Soll ich mir mein zartes liebes Mädchen z.B. als Konkurrenten denken? Das Zusammentreffen würde doch nur damit enden, dass ich ihr, wie vor siebzehn Monaten, sage, dass ich sie liebhabe und dass ich alles aufbiete, sie aus der Konkurrenz in die unbeeinträchtigte stille Tätigkeit meines Hauses zu ziehen (...); ich glaube, alle reformatorische Tätigkeit der Gesetzgebung und Erziehung wird an der Tatsache scheitern, dass die Natur lange vor dem Alter, in dem man in unserer Gesellschaft Stellung erworben haben kann, [die Frau] durch Schönheit, Liebreiz und Güte zu etwas [anderem] bestimmt. (...) Gesetzgebung und Brauch haben den Frauen viel vorenthaltene Rechte zu geben, aber die Stellung der Frau wird keine andere sein können, als sie ist: in jungen Jahren ein angebetetes Liebchen und in reiferen ein geliebtes Weib. (S. Freud, 1960, S. 73-75.)
Freuds Ansichten über die Frauenemanzipation unterschieden sich gewiss in keiner Weise von denen, die unter europäischen Männern in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts verbreitet waren. Nur war Freud eben kein Durchschnittsmann des 19. Jahrhunderts: Er rebellierte unnachsichtig gegen einige der tief verwurzelten Vorurteile seiner Zeit. Was jedoch die Frauenfrage anging, fielen ihm nur die abgedroschensten Redensarten ein, ein Mill war ihm „absurd“ und „unmenschlich“, weil er eine Auffassung vertrat, die 50 Jahre später fast selbstverständlich werden sollte. Etwas sehr Zwingendes muss Freud dazu gedrängt haben, der Frau eine Position minderen Ranges zuzuweisen. Auch in seinen späteren theoretischen Ansichten spiegelt sich diese Haltung wider. In Frauen nur kastrierte Männer zu sehen, ohne echte [VIII-167] eigene Sexualität, stets voller Neid auf den Mann, mit einem schwach entwickelten Über-Ich, eitel und wenig verlässlich: Was ist das anderes als eine leicht rationalisierte Variante der patriarchalischen Vorurteile seiner Zeit? Ein Mann wie Freud, der eine große Fähigkeit besaß, konventionelle Vorurteile zu durchschauen und zu kritisieren, muss von starken Kräften bestimmt gewesen sein, um nicht den rationalisierenden Charakter solcher vorgeblich wissenschaftlicher Aussagen zu sehen. (Vgl. hierzu E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 491°f.)
Auch noch ein halbes Jahrhundert später hielt Freud an solchen Ansichten fest. So berichtet einer seiner amerikanischen Schüler, Dr. J. Worthis, über ein Gespräch aus den dreißiger Jahren, in dem Freud den, wie er meinte, „matriarchalischen“ Charakter der amerikanischen Kultur kritisierte. Worthis wandte ein: „Aber meinen Sie nicht, dass es am besten wäre, wenn beide Partner gleichberechtigt wären?“ Worauf Freud erwiderte: „Das ist praktisch eine Unmöglichkeit. Ungleichheit muss es geben, und die Überlegenheit des Mannes ist das kleinere Übel.“ (J. Worthis, 1954, S. 98; Hervorhebung E.°f.)
Während die Jahre der Verlobung, wie schon gesagt, im Zeichen feuriger Umwerbung und eifersüchtiger Umschmeichelung der Braut gestanden hatten, scheint es in Freuds Eheleben an aktiver Liebe und Leidenschaft erheblich gemangelt zu haben. Die Eroberung war – wie in so vielen konventionellen Ehen – das eigentlich Erregende gewesen; war sie geglückt, so blieb für ein leidenschaftliches Gefühl von Liebe keine starke Quelle übrig. Im Liebeswerben steht der männliche Stolz auf dem Spiel; worin soll er nach der Heirat neue Befriedigung finden? In dieser Art Ehe verbleibt der Frau nur noch eine Funktion: Mutter zu sein. Sie muss dem Mann vorbehaltlos ergeben sein, für sein materielles Wohlergehen sorgen, sich stets seinen Bedürfnissen und Wünschen unterordnen, immer die Frau sein, die nichts für sich beansprucht, die Frau, die wartet, kurzum: die Mutter. So hatte sich Freud vor der Heirat als feuriger Liebhaber gezeigt: Mit der Eroberung des Mädchens, das er erwählt hatte, musste er seine Männlichkeit beweisen; dann hatte die Ehe die Eroberung besiegelt, und damit war das „angebetete Liebchen“ zur liebenden Mutter geworden, auf deren Fürsorge und Liebe man sich verlassen konnte, auch ohne seinerseits aktive, leidenschaftliche Liebe aufzubringen.
Wie rezeptiv und arm an erotischer Leidenschaft Freuds Liebe zu seiner Frau war, zeigt sich an vielen bemerkenswerten Einzelheiten. Besonders lehrreich sind in dieser Hinsicht seine Briefe an Fließ. In ihnen erwähnt er so gut wie nie seine Frau – außer in rein konventionellen Zusammenhängen. Das ist an sich schon bedeutsam genug, denn in diesen sehr intimen Briefen hat sich Freud sehr ausführlich über seine Gedanken, seine Patienten, seine beruflichen Erfolge und Enttäuschungen verbreitet; noch bedeutsamer ist, dass sich Freud in diesen Briefen häufig in deprimierter Stimmung über die Leere seines Lebens beklagt, das sich ihm nur dann als erfüllt und befriedigend darstellt, wenn seine Arbeit mit Erfolg vonstattengeht. Nicht ein einziges Mal erwähnt er die Beziehung zu seiner Frau als wichtige Quelle von Glück. Das gleiche Bild zeigt sich, wenn man sich vor Augen hält, wie Freud seine Zeit zu Hause und in den Ferien verbrachte: Der Werktag war genau eingeteilt: Sprechstunde von acht Uhr früh bis ein Uhr nachmittags, Mittagessen, Spaziergang allein, erneut Arbeit im [VIII-168] Konsultationszimmer von drei bis neun oder zehn Uhr abends, Spaziergang mit Frau, Schwägerin oder einer der Töchter, dann, wenn es keine abendliche Sitzung gab, Briefeschreiben und Arbeit an Manuskripten bis ein Uhr nachts. Besonders gesellig scheinen auch die Mahlzeiten nicht gewesen zu sein: Einiges lässt sich daraus schließen, dass Freud die Gepflogenheit hatte, „jede antike Neuanschaffung, gewöhnlich eine kleine Statuette, an den Mittagstisch zu bringen, wo sie während des Essens vor seinem Teller aufgestellt blieb. Nachher kam sie wieder auf seinen Schreibtisch und wurde noch ein- oder zweimal zurückgebracht.“ (E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 461.) Mit einer gewissen Regelmäßigkeit lief auch das Sonntagsprogramm ab: Am Vormittag besuchte Freud seine Mutter, den Nachmittag verbrachte er mit Freunden oder Kollegen aus dem psychoanalytischen Bereich, abends waren Mutter und Schwestern zu Tisch, danach arbeitete er wieder an seinen Manuskripten (E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 451). Am Sonntagnachmittag hatte Frau Freud Freunde zu Gast, und Freuds aktive Anteilnahme am Leben seiner Frau äußerte sich darin, dass er, wie Jones berichtet, „für einige Minuten ins Wohnzimmer hineinzuschauen“ pflegte, sofern sich unter den Gästen jemand befand, „der Freud interessierte“ (E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 451).
Viel Zeit nahm sich Freud für sommerliche Ferienreisen. Die Ferienzeit war die sehnlichst erwartete Erholungspause nach den langen Monaten ununterbrochener Arbeit, die sich vom Herbstbeginn bis zum Hochsommer hinzog. Freud war gern auf Reisen, und er reiste, wie bereits erwähnt, höchst ungern ohne Begleitung: Dennoch entschädigte auch die Ferienzeit seine Frau nur in geringem Maße dafür, dass Freud zu Hause für sie die wenigste Zeit erübrigte. Auf große Auslandsreisen nahm Freud psychoanalytische Freunde mit – oder auch seine Schwägerin, nie seine Frau. Dafür gibt es zweierlei Erklärungen, eine von Freud selbst und eine von Jones. Jones schreibt:
Seine Frau hatte immer alle Hände voll zu tun und war selten beweglich genug für weitere Reisen, zumal sie mit Freuds ruhelosem Weiterstürmen und seiner unersättlichen Leidenschaft für Besichtigungen nicht Schritt halten konnte. (...) Doch fast jeden Tag sandte er ihr eine Postkarte oder ein Telegramm und alle paar Tage einen langen Brief. (E. Jones, 1960-1962, Bd. 2, S. 29°f.)
Wiederum ist es bemerkenswert, auf wie konventionelle und unanalytische Weise Jones denkt, wenn es sich um seinen Helden handelt: Er kommt gar nicht auf die Idee, dass ein Ehemann, der sich freut, seine Freizeit mit seiner Frau zu verbringen, seine Leidenschaft für Besichtigungen bezähmen könnte, um der weniger reisegewandten Frau das Mitreisen zu ermöglichen. Dass solch entschuldigende Erklärungen lediglich Rationalisierungen sind, wird aus einem anderen Entschuldigungsgrund deutlich. Am 15. September 1910 schreibt er seiner Frau aus Palermo, wo er sich mit Sándor Ferenczi aufhält:
Palermo war eine unerhörte Schwelgerei, die man sich eigentlich allein nicht gönnen darf. (...) Es tut mir schrecklich leid, dass ich Euch das nicht verschaffen kann. Um das alles zu sieben, zu neun oder auch zu dreien (...) zu genießen, hätte ich nicht Psychiater und angeblich Gründer einer neuen Richtung in der Psychologie, sondern Fabrikant von irgendetwas allgemein Brauchbarem – wie Klosettpapier, Zündhölzchen, Schuhknöpfen – werden müssen. Zum Umlernen ist jetzt lang zu spät, und so genieße ich [es] weiter egoistisch, aber unter prinzipiellem Bedauern, allein. (S. Freud, 1960, S. 280.) [VIII-169]
Welch typische Rationalisierungen! Und wie ähnlich den Rationalisierungen anderer Ehemänner, die ihre Ferien lieber mit Freunden verleben als mit der eigenen Frau! Erstaunlich ist wieder nur, wie blind Freud trotz aller Selbstanalyse dem Problem der eigenen Ehe gegenüberstand und wie ausgiebig er, ohne es zu merken, sein Verhalten rationalisierte. Da werden die Komplikationen ausgemalt, die sich bei neun oder sieben oder auch nur drei Mitreisenden ergeben, wo es doch nur um die Frau geht, um eine Reise zu zweit; und da muss man sich – bloß um zu erklären, warum man die Frau nicht mitnimmt – in Positur werfen: Ein armer, aber bedeutender Gelehrter ist darüber erhaben, mit der Fabrikation von Klosettpapier Reichtümer zu erwerben.
Wie problematisch Freuds Liebe war, zeigt einer der bekanntesten seiner Träume, in der Traumdeutung mitgeteilt und ausführlich besprochen.[6] So lautet der Traum in Freuds eigenen Worten:
Ich habe eine Monographie über eine bestimmte Pflanze geschrieben. Das Buch liegt vor mir, ich blättere eben eine eingeschlagene farbige Tafel um. Jedem Exemplar ist ein getrocknetes Spezimen der Pflanze beigebunden, ähnlich wie in einem Herbarium. (S. Freud, 1900a, S.175.)
Dazu der Anfang der Freudschen Analyse des Traums:
Ich habe am Vormittage im Schaufenster einer Buchhandlung ein neues Buch gesehen, welches sich betitelt: Die Gattung Zyklamen – offenbar eine Monographie über diese Pflanze. Zyklamen ist die Lieblingsblume meiner Frau. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich so selten daran denke, ihr Blumen mitzubringen, wie sie sich’s wünscht. (S. Freud, 1900a, S.175.)
Eine besondere Assoziationskette führt Freud von der Blume zu einem wesentlich anderen Thema: seinem Ehrgeiz. Er notiert:
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959120494
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Juni)
- Schlagworte
- Sigmund Freud Psychotherapie Psychoanalyse Psyche Seelenarzt Theorie Unbewusstes