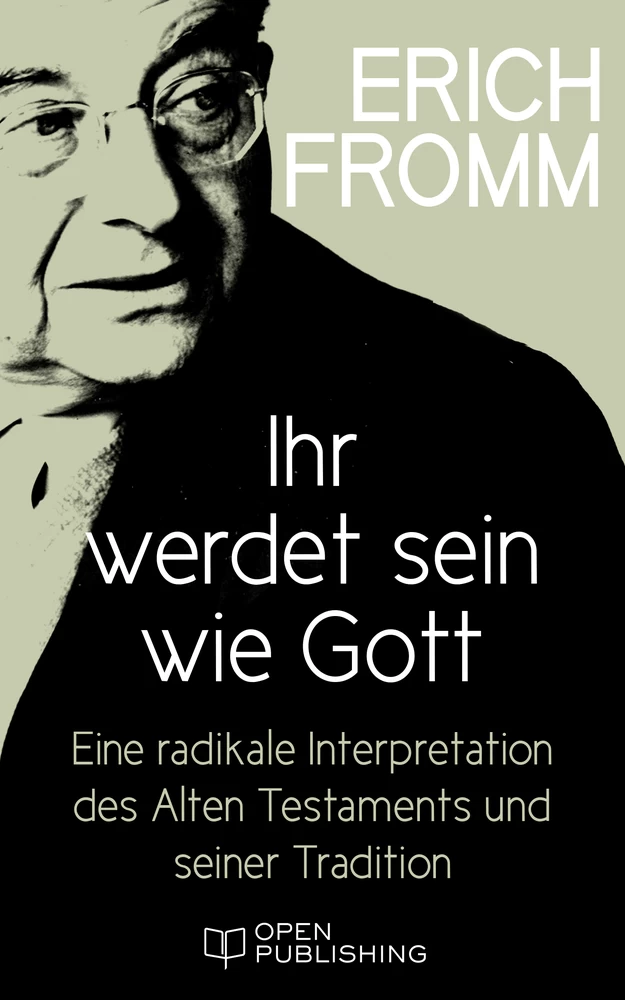Zusammenfassung
Seine humanistische Interpretation des Alten Testaments verdeutlicht Fromms eigenes Religionsverständnis: Religion soll dem Menschen zu einer weitgehenden Unabhängigkeit von fremden Mächten verhelfen. Sie soll ihn sogar von jeder Gottesvorstellung befreien und ist deshalb in erster Linie Religionskritik. Zugleich bekennt sich Fromm zu einer humanistischen Religiosität, wie sie in bestimmten Richtungen der Mystik (etwa bei Meister Eckhart oder im Zen-Buddhismus) zutage tritt.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Ihr werdet sein wie Gott Eine radikale Interpretation des Alten Testaments und seiner Tradition
- Inhalt
- 1. Einleitung
- 2. Das Gottesbild
- 3. Das Menschenbild
- 4. Das Geschichtsbild
- a) Über die Möglichkeit der Revolution
- b) Der Mensch als Gestalter seiner Geschichte
- c) Die biblische Vorstellung von der messianischen Zeit
- d) Die nachbiblische Entwicklung der messianischen Vorstellung
- e) Das Paradoxon der Hoffnung
- 5. Die Vorstellungen über Sünde und Buße
- 6. Der Weg: Halacha
- 7. Die Psalmen
- 8. Epilog
- 9. Anhang: Der 22. Psalm und die Leidensgeschichte Jesu
- Hinweise zur Übersetzung
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Ihr werdet sein wie Gott
Eine radikale Interpretation des Alten Testaments und seiner Tradition
(You Shall Be as Gods
A Radical Interpretation of the Old Testament and Its Tradition)
Erich Fromm
(1966a)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk
Aus dem Amerikanischen von Liselotte und Ernst Mickel
Erstveröffentlichung 1966 unter dem Titel You Shall Be as Gods. A Radical Interpretation of the Old Testament and Its Tradition beim Verlag Holt, Rinehart and Winston in New York. Eine erste deutsche Übersetzung von Harry Maór wurde 1970 unter dem Titel Die Herausforderung Gottes und des Menschen vom Diana Verlag in Zürich publiziert. Im Zusammenhang mit der Herausgabe der zehnbändigen Erich Fromm Gesamtausgabe 1980/81 wurde von Liselotte und Ernst Mickel eine neue Übersetzung angefertigt. In Absprache mit Erich Fromm wurde der deutsche Titel an den englischen Originaltitel angeglichen. Unter dem neuen Titel Ihr werdet sein wie Gott. Eine radikale Interpretation des Alten Testaments und seiner Tradition erschien das Buch mit neuer Übersetzung 1982 auch als Einzelband bei der Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, Band VI, S. 83-226.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1966 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
Inhalt
-
Ihr werdet sein wie Gott Eine radikale Interpretation des Alten Testaments und seiner Tradition
- Inhalt
- 1. Einleitung
- 2. Das Gottesbild
- 3. Das Menschenbild
- 4. Das Geschichtsbild
- 5. Die Vorstellungen über Sünde und Buße
- 6. Der Weg: Halacha
- 7. Die Psalmen
- 8. Epilog
- 9. Anhang: Der 22. Psalm und die Leidensgeschichte Jesu
- Hinweise zur Übersetzung
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
1. Einleitung
Ist die Hebräische Bibel, das Alte Testament, mehr als ein historisches Relikt, dem man seine Verehrung zollt, weil es der Urquell der drei großen westlichen Religionen ist?[1] Hat sie dem heutigen Menschen überhaupt noch etwas zu sagen – dem Menschen, der in einer Welt der Revolutionen, der Automation und der Atomwaffen lebt und einer materialistischen Philosophie huldigt, die ausdrücklich oder nicht ausdrücklich die religiösen Werte leugnet? Es sieht kaum so aus, als ob die Hebräische Bibel für uns noch von Bedeutung sein könnte. Das Alte Testament (einschließlich der Apokryphen) ist eine Sammlung von Schriften vieler Autoren, die während eines Zeitraums von über tausend Jahren (etwa zwischen 1200 und 100 v. Chr.) niedergeschrieben wurden. Sie enthält Gesetzesvorschriften, historische Berichte, Gedichte, prophetische Reden, die nur einen Teil einer umfangreicheren Literatur ausmachen, welche die Hebräer während dieser elfhundert Jahre hervorgebracht haben. (Vgl. etwa R. H. Pfeiffer, 1948.) Diese Bücher wurden in einem kleinen Land, wo sich die großen Verbindungsstraßen zwischen Afrika und Asien kreuzten, für Menschen geschrieben, die in einer Gesellschaft lebten, welche weder kulturell noch sozial der unsrigen im Geringsten ähnlich war.
Natürlich sind wir uns darüber klar, dass die Hebräische Bibel eine der anregendsten Quellen nicht nur für das Judentum, sondern auch für das Christentum und den Islam war, und so die kulturelle Entwicklung Europas, Amerikas und des Nahen Ostens tiefgehend beeinflusst hat. Nichtsdestoweniger scheint heute selbst für Juden und Christen die Hebräische Bibel nicht mehr zu sein als eine verehrungswürdige Stimme aus der Vergangenheit. Bei den meisten Christen wird das Alte Testament im Vergleich zum Neuen nur wenig gelesen. Außerdem wird das Gelesene oft durch Vorurteile entstellt. Häufig trifft man auf die Ansicht, dass das Alte Testament ausschließlich die Prinzipien der Gerechtigkeit und der Rache zum Ausdruck bringe, während das Neue Testament die der Liebe und des Erbarmens repräsentiere; viele glauben sogar, dass das Gebot, „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ aus dem Neuen Testament und nicht aus dem Alten stamme. Oder man meint, das Alte Testament sei nur in einem eng nationalistischen Geist verfasst und enthalte nichts von dem übernationalen Universalismus, der für das Neue Testament so kennzeichnend ist. Es sind zwar [VI-086] ermutigende Anzeichen vorhanden, dass sich bei Protestanten wie auch bei Katholiken ein Wandel hinsichtlich ihrer Einstellung und ihres praktischen Verhaltens vollzieht, doch bleibt immer noch viel zu tun.
Juden, die am Gottesdienst teilnehmen, sind mit dem Alten Testament besser vertraut, weil dort an jedem Sabbat und auch montags und donnerstags ein Abschnitt aus dem Pentateuch vorgelesen wird und im Ablauf des Jahres alle fünf Bücher Moses lückenlos an die Reihe kommen. (Hierbei folgt jeweils auf die Lesung aus dem Pentateuch ein Kapitel aus den Büchern der Propheten, so dass eine Mischung aus dem Geist des Pentateuchs und dem der Propheten entsteht.) Darüber hinaus lernen sie das Alte Testament auch noch durch das Studium des Talmud mit seinen zahllosen Zitaten aus den Heiligen Schriften kennen. Heute sind die Juden, die in dieser Tradition stehen, zwar in der Minderheit, doch entsprach sie noch vor hundertfünfzig Jahren allgemeiner jüdischer Lebensweise. Traditionsgemäß wurde dieses Bibelstudium bei den Juden dadurch gefördert, dass sie das Bedürfnis hatten, alle neuen Ideen und religiösen Unterweisungen auf die Autorität der Bibelverse zu gründen, was jedoch eine zwiespältige Wirkung hatte. Indem man die Bibelverse dazu benutzte, eine neue Idee oder ein religiöses Gebot zu untermauern, wurden sie oft außerhalb des Zusammenhangs zitiert und mit einer Interpretation belegt, die ihrer wahren Bedeutung nicht entsprach. Selbst dann, wenn sie nicht auf diese Weise verzerrt wurden, war man oft mehr an der „Brauchbarkeit“ eines Verses zur Bestätigung einer neuen Idee als an der Bedeutung des Verses in seinem Kontext interessiert. Tatsächlich war es auch so, dass der Text der Bibel mehr auf dem Weg über den Talmud und durch die allwöchentlichen Schriftlesungen bekannt war als durch direktes, systematisches Studium. Die Beschäftigung mit der mündlichen Tradition (Mischna, Gemara usw.) war wichtiger und stellte eine größere geistige Herausforderung dar.
Jahrhundertelang verstanden die Juden die Bibel nicht nur im Geist ihrer eigenen Tradition, sondern sie standen dabei in beträchtlichem Ausmaß auch unter dem Einfluss der Ideen anderer Kulturen, mit denen ihre Gelehrten in Berührung kamen. So verstand Philo das Alte Testament im Geiste Platons, Maimonides im Geiste des Aristoteles und Hermann Cohen im Geiste Kants. Die klassischen Kommentare stammen jedoch aus dem Mittelalter, und der hervorragendste Kommentator ist der unter dem Namen Raschi bekannte Rabbi Solomon ben Isaac (1040-1105), der die Bibel im konservativen Geist des mittelalterlichen Feudalismus interpretiert hat.[2] Dies trifft zu, obwohl er und andere Kommentatoren der Hebräischen Bibel den Text sprachlich und logisch klärten und dabei oft an die haggadischen Kompilationen der Rabbinen, an das jüdische mystische Erfahrungsgut und gelegentlich auch an arabische und jüdische Philosophen anknüpften und sich von ihnen bereichern ließen. [VI-087]
Für viele Generationen von Juden seit dem Ende des Mittelalters, vor allem bei den in Deutschland, Polen, Russland und Österreich lebenden, verstärkte der mittelalterliche Geist dieser klassischen Kommentare jene Tendenzen noch, die von der eigenen Gettosituation herrührten, in welcher sie nur wenig mit dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben der modernen Zeit Kontakt hatten. Andererseits zeigten jene Juden, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts an der zeitgenössischen europäischen Kultur Anteil hatten, im allgemeinen nur noch wenig Interesse am Studium des Alten Testaments.
Das Alte Testament ist ein Buch mit vielen Schattierungen, das im Laufe eines Jahrtausends von vielen Autoren geschrieben, redigiert und wieder umredigiert wurde und dessen Inhalt eine bemerkenswerte Entwicklung von einem primitiven Autoritäts- und Stammesbewusstsein zur Idee einer radikalen Freiheit des Menschen und der Brüderlichkeit aller Menschen aufweist. Das Alte Testament ist ein revolutionäres Buch; sein Thema ist die Befreiung des Menschen von den inzestuösen Bindungen an Blut und Boden, von der Unterwerfung unter Götzen, von der Sklaverei und von mächtigen Herren zur Freiheit des Individuums, der Nation und der ganzen Menschheit. (Dieser revolutionäre Charakter des Alten Testamentes war es auch, der es zur Richtschnur für die revolutionären christlichen Sekten vor und nach der Reformation machte.) Vielleicht können wir heute die Hebräische Bibel besser verstehen als irgendein anderes Zeitalter vor uns, gerade weil wir in einer Zeit der Revolution leben, in der der Mensch trotz vieler Irrtümer, die ihn nur in neue Formen der Abhängigkeit hineinführen, alle gesellschaftlichen Fesseln abschüttelt, die einst von „Gott“ und den „gesellschaftlichen Vorschriften“ sanktioniert waren. Vielleicht kann paradoxerweise eines der ältesten Bücher des westlichen Kulturkreises am besten von denen verstanden werden, die am wenigsten durch Tradition gebunden sind und die sich am meisten bewusst sind, wie radikal der Befreiungsprozess ist, der gegenwärtig im Gange ist.
Ich möchte noch einige Worte über mein Bibelverständnis in diesem Buch vorausschicken. Ich betrachte die Bibel nicht als „Wort Gottes“, und dies nicht nur nicht, weil die historische Forschung zeigt, dass sie ein Buch ist, welches von Menschen geschrieben wurde, von unterschiedlichen Menschen, die in unterschiedlichen Zeiten gelebt haben, sondern auch deshalb, weil ich kein Theist bin. Dennoch ist sie für mich ein außergewöhnliches Buch, in dem viele Normen und Prinzipien zum Ausdruck kommen, die über Jahrtausende hinweg ihre Gültigkeit bewahrt haben. Sie ist ein Buch, das den Menschen eine Vision verkündet, die noch immer gültig ist und immer noch auf ihre Verwirklichung wartet. Sie wurde nicht von einem einzigen Menschen geschrieben und auch nicht von Gott diktiert; es drückt sich in ihr vielmehr der Genius eines Volkes aus, das viele Generationen lang für Leben und Freiheit kämpfte.
Wenngleich ich die historische und literarische Kritik des Alten Testaments innerhalb ihres Bezugsrahmens für überaus wichtig halte, so glaube ich doch nicht, dass sie für den Zweck des vorliegenden Buches von wesentlicher Bedeutung ist, da es den biblischen Text verstehen helfen und keine historische Analyse geben möchte. Trotzdem werde ich, wenn immer es mir wichtig scheint, auf die Ergebnisse der historischen oder literarischen Analyse der Hebräischen Bibel hinweisen. [VI-088]
Die Redaktoren der Bibel haben die Widersprüche zwischen den verschiedenen von ihnen benutzten Quellen nicht immer ausgeglichen. Es müssen aber Männer von großer Einsicht und Weisheit gewesen sein, haben sie es doch verstanden, die vielen Teile zu einer Einheit zusammenzufügen, in der sich ein evolutionärer Prozess spiegelt, dessen Widersprüche Aspekte eines Ganzen sind. Ihre redaktionelle Tätigkeit, ja sogar die Arbeit der Weisen, welche die endgültige Auswahl der Heiligen Schriften trafen, entspricht im weiteren Sinn der eines Autors.
Meiner Ansicht nach kann man die Hebräische Bibel als ein Buch behandeln, und das ungeachtet der Tatsache, dass sie aus vielen Quellen zusammengetragen wurde. Nicht nur durch die Arbeit der verschiedenen Redaktoren wurde sie zu einem Buch, sondern auch dadurch, dass sie während der letzten zweitausend Jahre als ein Buch gelesen und verstanden wurde. Hinzu kommt, dass einzelne Stellen ihre Bedeutung ändern, wenn man sie aus ihren ursprünglichen Quellen heraus- und in den neuen Gesamtkontext des Alten Testaments hineinnimmt. Zwei Beispiele mögen dies veranschaulichen: Im Buch Genesis 1,26 sagt Gott: „Lass uns Menschen machen als unser Abbild.“ Nach Meinung vieler Alttestamentler ist dies ein archaischer Satz, der von dem Redaktor der „Priesterschrift“[3] im wesentlichen unverändert übernommen wurde. Nach manchen Autoren wird Gott hier als ein menschliches Wesen aufgefasst. Dies kann für den ursprünglichen archaischen Text auch tatsächlich vollkommen zutreffend sein. Es stellt sich aber die Frage, weshalb der Redaktor dieser Stelle, der doch zweifellos keine solch archaische Vorstellung von Gott mehr hatte, den Satz nicht änderte. Meiner Ansicht nach ist der Grund darin zu suchen, dass er die Stelle so verstand, dass der nach Gottes Vorbild geschaffene Mensch eine Gott ähnliche Qualität besitzt. Ein anderes Beispiel ist das Verbot, sich ein Abbild Gottes zu machen oder seinen Namen zu benutzen. Es ist durchaus möglich, dass der Sinn dieses Verbots ursprünglich in der archaischen, in einigen semitischen Kulturen gefundenen Sitte begründet lag, Gott und seinen Namen als Tabu zu betrachten; daher das Verbot, sich ein Abbild von ihm zu machen und seinen Namen zu benutzen. Aber im Gesamtkontext des Buches hat sich die Bedeutung des archaischen Tabus in eine neue Idee verwandelt, dass nämlich Gott kein Ding ist und daher weder durch einen Namen noch durch ein Bildnis dargestellt werden kann.
Das Alte Testament ist das Dokument, das die Entwicklung eines kleinen, primitiven Volkes beschreibt, dessen geistige Führer auf der Existenz eines einzigen Gottes und auf der Nichtexistenz von Götzen beharrten und die unbeirrt an ihrer Religion festhielten mit ihrem Glauben an einen namenlosen Gott, an eine zukünftige Vereinigung aller Menschen und an die völlige Freiheit eines jeden Individuums.
Als, die vierundzwanzig Bücher des Alten Testaments kodifiziert waren[4], war damit die jüdische Geschichte nicht zu Ende. Sie ging weiter, und damit kamen auch die Ideen, die von der Hebräischen Bibel ihren Ausgang genommen hatten, zu einer volleren Entwicklung. Die Weiterentwicklung erfolgte in zwei Bahnen: einmal im Neuen Testament, in der christlichen Bibel; und zum anderen in der jüdischen Weiterentwicklung, die man gewöhnlich als die „mündliche Überlieferung“ bezeichnet. Die jüdischen Schriftgelehrten haben stets nachdrücklich auf die Kontinuität und Einheit der schriftlichen Überlieferung (dem Alten Testament) und der mündlichen [VI-089] Überlieferung hingewiesen. Auch letztere wurde kodifiziert: in ihrem älteren Teil, der Mischna, um 200 n. Chr.; in ihrem späteren Teil, der Gemara, um das Jahr 500 n. Chr. Es ist eine paradoxe Tatsache, dass eben der Standpunkt, der die Bibel für das nimmt, was sie historisch ist, nämlich eine Auswahl von Schriften aus vielen Jahrhunderten, es einem leicht macht, der traditionellen Auffassung zuzustimmen, dass die schriftlichen und mündlichen Überlieferungen eine Einheit sind. Die mündliche Überlieferung enthält genau wie die schriftliche in der Bibel Ideen aus einem Zeitraum von mehr als zwölfhundert Jahren. Wenn wir uns vorstellen könnten, dass eine zweite jüdische Bibel geschrieben würde, so würde diese den Talmud, die Schriften des Maimonides, die Kabbala sowie die Aussprüche der chassidischen Meister enthalten. Wenn wir uns eine derartige Sammlung von Schriften vorstellen könnten, so würde sie nur wenige Jahrhunderte mehr umspannen als das Alte Testament; sie würde von vielen Autoren unter völlig unterschiedlichen Lebensumständen zusammengestellt werden und genauso viele widersprüchliche Ideen und Lehren enthalten wie die Bibel. Natürlich gibt es eine solche zweite Bibel nicht. Sie hätte aus vielerlei Gründen niemals zustande kommen können. Ich möchte damit nur zeigen, dass das Alte Testament die Entwicklung von Ideen über einen langen Zeitraum hin repräsentiert und dass diese Ideen sich über einen noch längeren Zeitraum hin weiterentwickelt haben, nachdem das Alte Testament bereits kodifiziert war. Diese Kontinuität liegt auf jeder beliebigen heute gedruckten Talmudseite dramatisch vor Augen: Diese enthält nicht nur die Mischna und die Gemara, sondern auch die späteren bis zum heutigen Tag verfassten Kommentare und Abhandlungen von der Zeit vor Maimonides bis nach der Zeit des Gaon von Wilna.[5]
Sowohl das Alte Testament als auch die mündliche Überlieferung enthalten Widersprüche, die jedoch etwas unterschiedlicher Art sind. Die im Alten Testament sind großenteils darauf zurückzuführen, dass sich die Hebräer aus einem kleinen Nomadenstamm zu einem in Babylonien lebenden Volk entwickelten, das später von der hellenistischen Kultur beeinflusst wurde. In der auf die Vollendung des Alten Testaments folgenden Periode liegen die Widersprüche nicht in der Entwicklung von einem archaischen zu einem zivilisierten Lebensstil begründet, sondern in der ständigen Zersplitterung der verschiedenen gegensätzlichen Tendenzen, die sich durch die gesamte Geschichte des Judentums durchzieht, von der Zerstörung des Tempels bis zur Vernichtung der Zentren der traditionellen jüdischen Kultur durch Hitler. Es handelt sich dabei um den Gegensatz zwischen Nationalismus und Universalismus, zwischen Konservatismus und Radikalismus, zwischen Fanatismus und Toleranz. Dabei ist die jeweilige Stärke der beiden Flügel – und vieler Sektoren innerhalb derselben – natürlich auf bestimmte Ursachen zurückzuführen, nämlich auf die spezifischen Bedingungen, unter denen das Judentum sich in den einzelnen Ländern (in Palästina, in Babylonien, im islamischen Nordafrika und Spanien, im christlich-mittelalterlichen Europa und im zaristischen Russland) entwickelte, sowie auf die spezifischen sozialen Klassen, denen die Gelehrten entstammten.[6] [VI-090]
Die vorstehenden Bemerkungen weisen auf die Schwierigkeiten bei der Interpretation der Bibel und der späteren jüdischen Überlieferung hin. Einen Interpretationsprozess interpretieren, heißt, die Entwicklung gewisser, sich in diesem Evolutionsprozess entfaltender Tendenzen aufzuzeigen. Eine solche Interpretation bringt die Notwendigkeit mit sich, jene Elemente auszuwählen, welche die Hauptströmung oder doch wenigstens eine Hauptströmung im Evolutionsprozess sind. Das bedeutet aber, dass man die Faktoren gegeneinander abwägt, dass man unter ihnen, je nachdem, ob sie mehr oder weniger repräsentativ sind, eine Auswahl treffen muss. Eine Geschichtsschreibung, die allen Tatsachen die gleiche Bedeutung beimisst, ist nichts anderes als eine Aufzählung von Ereignissen; sie fragt nicht nach dem Sinn dieser Ereignisse. Geschichtsschreibung bedeutet stets auch Geschichtsdeutung. Dabei geht es darum, dass der die Tatsachen Deutende das notwendige Wissen und die notwendige Achtung vor ihnen besitzt, um nicht in Gefahr zu geraten, bestimmte Daten auszuwählen, die eine vorgefasste These stützen. Die einzige Bedingung, die bei der Interpretation auf den folgenden Seiten zu stellen ist, lautet, dass die betreffenden Stellen aus der Bibel, aus dem Talmud und der späteren jüdischen Literatur nicht seltene, eine Ausnahme bildende Äußerungen, sondern von repräsentativen Persönlichkeiten getroffene Feststellungen und Teil eines zusammenhängenden, sich entwickelnden Denkmodells sind. Auch dürfen sich widersprechende Äußerungen nicht außer Acht gelassen werden, sondern sie sind als das zu nehmen, was sie sind: nämlich Teil eines Ganzen, in dem widersprüchliche Denkmodelle neben dem hier in den Vordergrund gerückten existierten. Es würde eine weit umfangreichere Arbeit erfordern, den Beweis zu erbringen, dass das radikale humanistische Denken die Hauptentwicklungsstufen der jüdischen Überlieferung kennzeichnet, während die konservativ-nationalistische Richtung das relativ unveränderte Relikt aus älteren Zeiten ist und nie an der progressiven Evolution des jüdischen Denkens und seinem Beitrag zu den universalen menschlichen Werten einen Anteil hatte.
Obwohl ich kein Spezialist auf dem Gebiet der Bibelforschung bin, ist dieses Buch doch die Frucht vieler Jahre des Nachdenkens, habe ich doch seit meiner Kindheit das Alte Testament und den Talmud studiert. Trotzdem hätte ich nicht gewagt, diese Kommentare zur Schrift zu veröffentlichen, hätte ich nicht meine Grundeinstellung zur Hebräischen Bibel und der späteren jüdischen Überlieferung von Lehrern vermittelt bekommen, die große rabbinische Gelehrte waren. Sie waren alle Vertreter des humanistischen Flügels der jüdischen Tradition und Juden strenger Observanz. Nichtsdestoweniger unterschieden sie sich erheblich voneinander. Ludwig Krause [VI-091] zum Beispiel war ein Traditionalist, der sich vom modernen Denken wenig berühren ließ. Nehemia Nobel dagegen war ein ganz von der jüdischen Mystik und den Ideen des westlichen Humanismus durchdrungener Mystiker. Der dritte, Salman B. Rabinkow, war in der chassidischen Tradition verwurzelt; er war Sozialist und ein moderner Gelehrter. Wenngleich keiner von ihnen ein umfangreiches Schrifttum hinterließ, zählten sie doch zu den hervorragendsten talmudischen Gelehrten, die vor der Nazi-Katastrophe in Deutschland lebten. Da ich selbst kein praktizierender oder „gläubiger“ Jude bin, stehe ich natürlich auf einem völlig anderen Standpunkt als sie, und ich würde um nichts in der Welt wagen, sie für die in diesem Buch geäußerten Ansichten verantwortlich zu machen. Und doch sind meine Auffassungen aus ihrer Lehre erwachsen, und es ist meine feste Überzeugung, dass die Kontinuität zwischen ihrer Lehre und meinen eigenen Ansichten nirgends unterbrochen ist. Auch hat mich das Beispiel des großen Kantianers Hermann Cohen zu diesem Buch ermutigt, der in seinem Werk Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums (H. Cohen, 1929) sich der Methode bediente, das Alte Testament zusammen mit der späteren jüdischen Überlieferung als ein Ganzes zu betrachten. Wenn sich auch diese bescheidene Arbeit nicht mit seinem großen Werk vergleichen lässt und meine Schlussfolgerungen auch manchmal von den seinen abweichen, so bin ich doch in Bezug auf meine Methode von seiner Art der Bibelbetrachtung stark beeinflusst worden.
Die Bibelinterpretation in diesem Buch ist die des radikalen Humanismus. Unter radikalem Humanismus verstehe ich eine globale Philosophie, die das Einssein der menschlichen Rasse, die Fähigkeit des Menschen, die eigenen Kräfte zu entwickeln, zur inneren Harmonie und zur Errichtung einer friedlichen Welt zu gelangen, in den Vordergrund stellt. Der radikale Humanismus sieht in der völligen Unabhängigkeit des Menschen sein höchstes Ziel, was bedeutet, dass er durch Fiktionen und Illusionen hindurch zum vollen Gewahrwerden der Wirklichkeit vordringen muss. Er impliziert ferner eine skeptische Haltung gegenüber der Anwendung von Gewalt, weil es in der gesamten Menschheitsgeschichte eben die Angst erzeugende Gewalt war, die den Menschen dazu bereit machte, die Fiktion für die Wirklichkeit und Illusionen für die Wahrheit zu halten, was auch heute noch gilt. Die Gewalt war es, die den Menschen unfähig machte, unabhängig zu werden und die so sein Denken und seine Gefühle verfälscht hat.
Es ist nur deshalb möglich, die Keime des radikalen Humanismus in den älteren Quellen der Bibel zu entdecken, weil wir den radikalen Humanismus eines Amos, eines Sokrates, der Humanisten der Renaissance und der Aufklärung sowie den von Kant, Herder, Lessing, Goethe, Marx und Schweitzer kennen. Man kann den Samen nur richtig identifizieren, wenn man die Blüte kennt; oft muss man die frühere Phase mit Hilfe der späteren interpretieren, wenngleich die frühere Phase der späteren genetisch vorausgeht.
Noch ein weiterer Aspekt des radikalen Humanismus ist zu erwähnen. Ideen wurzeln im realen Leben der Gesellschaft, besonders dann, wenn es sich nicht nur um die eines einzelnen Individuums handelt, sondern wenn sie dem historischen Prozess integriert sind. Wenn man daher annimmt, dass die Idee des radikalen Humanismus eine Haupttendenz der biblischen und nach-biblischen Tradition ist, so muss man auch [VI-092] annehmen, dass während der gesamten Geschichte der Juden Grundbedingungen existierten, die zur Entstehung und zum Wachstum der humanistischen Tendenz führten. Gibt es tatsächlich solche Grundbedingungen? Ich glaube ja, und meine, es sei nicht schwer, sie zu entdecken. Die Juden waren nur kurze Zeit im Besitz einer effektiven, eindrucksvollen weltlichen Macht, tatsächlich nur wenige Generationen lang. Nach der Regierung Davids und Salomons nahm der Druck der Großmächte im Norden und Süden solche Ausmaße an, dass Juda und Israel in ständig wachsender Gefahr lebten, erobert zu werden. Und sie wurden ja dann auch erobert und konnten sich nie mehr davon erholen. Auch wenn die Juden später, formal betrachtet, politisch unabhängig waren, so waren sie doch ein kleiner, machtloser Satellitenstaat, der von den Großmächten beherrscht wurde. Als die Römer schließlich dem Staat ein Ende bereiteten, nachdem der Rabbi Jochanan ben Sakkai zu ihnen übergegangen war (womit er nur die Erlaubnis zur Eröffnung einer Hochschule in Jabne zur Ausbildung zukünftiger Generationen rabbinischer Gelehrter zu erlangen hoffte), tauchte ein Judentum ohne Könige und Priester auf, das sich bereits seit Jahrhunderten hinter einer Fassade entwickelt hatte, der die Römer nur den letzten Stoß versetzten. Jenen Propheten, welche die götzendienerische Anbetung der weltlichen Macht angeprangert hatten, gab der Verlauf der Geschichte recht. So wurden die Lehren der Propheten und nicht die Herrlichkeit Salomons auf die Dauer zum dominierenden Einfluss im jüdischen Denken. Von da an gewannen die Juden als Nation nie mehr ihre Macht zurück. Im Gegenteil hatten sie im Laufe ihrer Geschichte meistens unter denen zu leiden, die in der Lage waren Gewalt auszuüben. Zweifellos konnte ihre Situation auch zur Entstehung von nationalem Ressentiment, zu einem engherzigen Stammesbewusstsein und zur Arroganz führen, und es ist auch tatsächlich dazu gekommen. Hier liegt die Wurzel für die andere Tendenz in der jüdischen Geschichte, die wir oben erwähnten.[7]
Aber ist es nicht natürlich, dass die Geschichte von der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, dass die Reden der großen humanistischen Propheten ein Echo fanden in den Herzen von Menschen, die die Gewalt nur als ihre leidenden Opfer und nie als ihre Handhaber erfahren hatten? Ist es verwunderlich, dass die prophetische Vision einer geeinten, friedlichen Menschheit, von Gerechtigkeit für die Armen und Hilflosen bei den Juden auf fruchtbaren Boden fiel und nie vergessen wurde? Ist es verwunderlich, dass die Juden, als die Mauern der Gettos fielen, in unverhältnismäßig großer Zahl zu denen gehörten, die die Ideale von Internationalismus, von Frieden und Gerechtigkeit proklamierten? Was von einem mundanen Standpunkt aus die Tragödie der Juden war – der Verlust ihres Landes und Staates –, war für sie vom humanistischen Standpunkt aus der größte Segen: Da sie zu den Leidenden und Verachteten gehörten, waren sie in der Lage, eine Tradition des Humanismus zu entwickeln und zu bewahren.
2. Das Gottesbild
Wörter und Begriffe, die sich auf Phänomene psychischer oder geistiger Erfahrung beziehen, entwickeln sich und wachsen mit dem Menschen, auf dessen Erfahrung sie sich beziehen – oder sie vergehen mit ihm. Sie verändern sich in dem Maß, wie er selbst sich verändert; sie haben genau wie er ein Leben.
Wenn ein sechsjähriger Junge zu seiner Mutter sagt: „Ich hab dich lieb“, so gebraucht er das Wort „Liebe“ entsprechend der Erfahrung, die er im Alter von sechs Jahren besitzt. Wenn das Kind sich weiterentwickelt hat und zum Mann herangereift ist und dann die gleichen Worte zu einer geliebten Frau sagt, so haben sie eine andere Bedeutung. Es kommt dann darin der weitere Bereich, die größere Tiefe, die größere Freiheit und Aktivität zum Ausdruck, die die Liebe eines Mannes von der eines Kindes unterscheidet. Aber wenn auch die Erfahrung, auf die sich das Wort „lieben“ bezieht, beim Kind eine andere ist als beim Mann, so hat sie doch in beiden Fällen den gleichen Kern, genauso wie der Mann sich vom Kind unterscheidet und doch mit ihm identisch ist.
Jedes Lebewesen kennzeichnen gleichzeitig Dauer und Wandlung; daher finden wir Dauer und Wandlung auch in jedem Begriff, in dem sich die Erfahrung eines lebendigen Menschen widerspiegelt. Dass aber auch Begriffe ihr eigenes Leben haben und dass auch sie wachsen, wird nur verständlich, wenn man sie nicht von der Erfahrung trennt, die sie zum Ausdruck bringen. Wenn der Begriff entfremdet, das heißt von der Erfahrung, auf die er sich bezieht, getrennt wird, so verliert er seine Realität und verwandelt sich in ein Kunstgebilde des menschlichen Geistes. Hierdurch entsteht die Fiktion, dass jeder, der den Begriff gebraucht, sich damit auf das Substrat der ihm zugrunde liegenden Erfahrung bezieht. Sobald dies geschieht – und dieser Prozess der Begriffsentfremdung ist eher die Regel als die Ausnahme –, verwandelt sich die eine Erfahrung ausdrückende Idee in eine Ideologie, welche sich widerrechtlich an die Stelle der Realität setzt, die ihr im lebendigen Menschen zugrunde liegt. Die Geschichte wird dann zu einer Geschichte der Ideologien anstatt einer Geschichte konkreter, realer Menschen, die ihre eigenen Ideen hervorbringen.
Diese Erwägungen sind wichtig, wenn man das Gottesbild begreifen will. Sie sind auch wichtig, wenn man den Standpunkt verstehen will, von dem aus diese [VI-094] Seiten geschrieben wurden. Ich glaube, dass das Gottesbild ein historisch bedingter Ausdruck einer inneren Erfahrung war. Ich kann verstehen, was die Bibel oder echt religiöse Menschen meinen, wenn sie über Gott sprechen, doch teile ich ihre Begriffsvorstellung nicht. Ich glaube vielmehr, dass der Begriff „Gott“ durch die sozio-politische Struktur bedingt war, in der Stammeshäuptlinge oder Könige die höchste Macht innehatten. Der Begriff des höchsten Wertes wurde verstanden in Analogie zur höchsten Macht in der Gesellschaft.
„Gott“ ist eine der vielen poetischen Ausdrucksweisen für den höchsten Wert im Humanismus und keine Realität an sich. Es lässt sich jedoch nicht vermeiden, dass ich bei der Diskussion der Ideen eines monotheistischen Systems mich oft des Wortes „Gott“ bediene, und es wäre recht umständlich, wollte ich jedes Mal meine eigene Wertung dieses Begriffes hinzufügen. Daher möchte ich meinen Standpunkt von vornherein klarstellen. Wenn ich meine Position annähernd definieren wollte, würde ich sie als nicht-theistische Mystik bezeichnen.
Auf welche Realität menschlicher Erfahrung bezieht sich der Gottesbegriff? Ist der Gott Abrahams derselbe wie der Gott von Moses, Jesaja, Maimonides, Meister Eckhart und Spinoza? Und wenn es nicht derselbe Gott ist, gibt es dann trotzdem ein gemeinsames Erfahrungssubstrat, das dem Begriff, wie er von all diesen verschiedenen Männern gebraucht wird, zugrunde liegt, oder könnte es sein, dass ein solcher gemeinsamer Boden bei einigen vorhanden ist, aber in Bezug auf andere nicht existiert?
Dass eine Idee, der begriffliche Ausdruck einer menschlichen Erfahrung, so leicht in eine Ideologie verwandelt wird, liegt nicht nur an der Angst des Menschen, sich ganz einer Erfahrung auszuliefern, sondern auch an der Eigenart der Beziehung zwischen Erfahrung und Idee (bei der Begriffsbildung). Ein Begriff kann niemals die ihm zugrunde liegende Erfahrung adäquat zum Ausdruck bringen. Er weist auf sie hin, aber ist sie nicht. Er ist, wie sich die Zen-Buddhisten ausdrücken, „der Finger, der auf den Mond zeigt“ – er ist nicht der Mond. Jemand kann sich mit dem Begriff a oder dem Symbol x auf seine Erfahrung beziehen; eine Gruppe von Personen kann sich des Begriffs a oder des Symbols x bedienen, um damit eine gemeinsame Erfahrung zu bezeichnen. In diesem Fall ist der Begriff oder das Symbol, auch dann wenn der Begriff der Erfahrung nicht entfremdet ist, nur annäherungsweise Ausdruck der Erfahrung. Das kann gar nicht anders sein, weil das Erleben eines Menschen niemals mit dem eines anderen Menschen identisch ist; es kann sich jenem nur so weit nähern, dass die Verwendung eines gemeinsamen Symbols oder Begriffs möglich wird. (Tatsächlich ist ja auch die Erfahrung ein und derselben Person bei zwei verschiedenen Gelegenheiten nie genau die gleiche, weil niemand in zwei verschiedenen Augenblicken seines Lebens genau der gleiche Mensch ist.) Der Begriff und das Symbol haben den großen Vorteil, dass sie es den Menschen ermöglichen, ihre Erfahrungen auszutauschen; sie haben den ungeheuren Nachteil, dass sie leicht der Entfremdung unterliegen.
Es gibt noch einen weiteren Faktor, der zur Entfremdung und „Ideologisierung“ beiträgt. Es scheint eine inhärente Tendenz des menschlichen Geistes zu sein, dass er nach Systematisierung und Vollständigkeit strebt. (Eine Wurzel dieser Tendenz [VI-095] dürfte im Streben des Menschen nach Sicherheit zu suchen sein – ein Streben, das nur allzu verständlich ist, wenn man die Gefährdung der menschlichen Existenz bedenkt.) Wenn wir einige Fragmente der Realität kennen, haben wir den Wunsch, sie so zu vervollständigen, dass sich etwas „Sinnvolles“ ergibt, das in ein System zu bringen ist. Aber auf Grund der Begrenztheit der menschlichen Natur bleibt unser Wissen immer nur „fragmentarisch“, und es ist niemals vollkommen. Daher neigen wir dazu, selbst einige zusätzliche Stücke zu fabrizieren und zu den Fragmenten hinzuzufügen, um ein Ganzes, ein System daraus zu machen. Durch die Intensität des Verlangens nach Sicherheit wird man oft den qualitativen Unterschied zwischen den „Fragmenten“ und dem Hinzugefügten nicht gewahr.
Man kann diesen Prozess häufig sogar in der Weiterentwicklung der Wissenschaft verfolgen. In vielen wissenschaftlichen Systemen finden wir eine Mischung aus echten Einsichten in die Wirklichkeit und fiktiven Stücken, die hinzugefügt wurden, um ein vollständiges System zu erreichen. Erst an einem späteren Entwicklungspunkt ist klar zu erkennen, welches die echten, aber fragmentarischen Elemente des Wissens waren und was „Polsterung“ war, die hinzugefügt wurde, um das System einleuchtender zu machen. Dem gleichen Prozess begegnen wir auch in der politischen Ideologie. Als die französische Bourgeoisie in der Französischen Revolution um ihre eigene Freiheit kämpfte, tat sie dies in der Illusion, dass sie für die universale Freiheit und das Glück als absolute Prinzipien, also im Namen aller Menschen, kämpfte.
Auch in der Geschichte der religiösen Vorstellungen treffen wir auf diesen Prozess. Als der Mensch ein fragmentarisches Wissen von der Möglichkeit hatte, dass man das Problem der menschlichen Existenz durch die volle Entwicklung der menschlichen Kräfte lösen könnte, als er das Gefühl hatte, er könnte dadurch zur Harmonie gelangen, dass er Liebe und Vernunft voll entwickelte, anstatt den tragischen Versuch zu unternehmen, zur Natur zu regredieren und die Vernunft auszulöschen, da gab er dieser neuen Vision, diesem X, viele Namen: Brahman, Tao, Nirwana oder Gott. Diese Entwicklung ging in den tausend Jahren zwischen 1500 und 500 vor Chr. auf der ganzen Welt vor sich, in Ägypten, Palästina, Indien, China und Griechenland (vgl. Karl Jaspers’ „Achsenzeit“). Welcher Art diese verschiedenen Vorstellungen waren, hing ab von den ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Grundlagen der betreffenden Kultur und der gesellschaftlichen Klassen sowie von den sich daraus ergebenden Denkmodellen. Aber das X, das Ziel, wurde bald in etwas Absolutes verwandelt; es wurde ein System darum herum errichtet, und die Zwischenräume wurden mit vielen fiktiven Annahmen ausgefüllt, bis das Gemeinsame der Vision fast ganz unter dem Gewicht der in jedem System produzierten fiktiven „Zusätze“ verschwand.
Jeder Fortschritt in der Wissenschaft, in den politischen Ideen, in Religion und Philosophie besitzt die Tendenz, Ideologien zu erzeugen, die miteinander rivalisieren und sich gegenseitig bekämpfen. Dieser Prozess wird noch dadurch gefördert, dass, sowie das Denksystem zum Kern einer Organisation wird, Bürokraten auftauchen, die zur Aufrechterhaltung ihrer Macht und Herrschaft lieber das Trennende als das Gemeinsame in den Vordergrund stellen und die daher ein Interesse daran haben, den fiktiven Zusätzen die gleiche oder gar eine noch größere Bedeutung zuzumessen als den [VI-096] ursprünglichen Fragmenten. Auf diese Weise verwandeln sich Philosophie, Religion, politische Ideen und manchmal sogar die Wissenschaft in Ideologien, die von den jeweiligen Bürokraten beherrscht werden.
Das Gottesbild des Alten Testaments hat sein eigenes Leben und es hat seine eigene Entwicklung genommen, die der Entwicklung eines Volkes in einer Zeitspanne von zwölfhundert Jahren entspricht. In dieser Gottesvorstellung ist ein gemeinsames Erfahrungselement enthalten, aber diese Erfahrung hat sich andererseits auch ständig verändert und mit ihm auch die Bedeutung des Wortes „Gott“ und der damit verbundene Begriff. Das Gemeinsame ist die Idee, dass weder die Natur noch Kunstprodukte die letzte Realität oder den höchsten Wert darstellen, sondern dass es nur das EINE gibt, welches den höchsten Wert und das höchste Ziel des Menschen repräsentiert: das Ziel, durch die volle Entfaltung der spezifisch menschlichen Fähigkeiten der Liebe und Vernunft mit der Welt eins zu werden.
Dem Gott Abrahams und dem Gott Jesajas ist dieses EINE gemeinsam, und doch unterscheiden sie sich so sehr voneinander, wie sich ein ungebildeter, primitiver Häuptling eines Nomadenstammes von einem universalistischen Denker unterscheidet, der ein Jahrtausend später in einem der Kulturzentren der Welt lebte. Die Gottesvorstellung wächst und entwickelt sich Hand in Hand mit dem Wachstum und der Entwicklung eines Volkes; der Kern bleibt der gleiche, aber die Unterschiede, die sich im Verlauf der historischen Entwicklung herausbilden, sind so groß, dass oft das Gemeinsame dahinter zurückzutreten scheint.
Auf der ersten Entwicklungsstufe wird Gott als absoluter Herrscher aufgefasst. Er hat die Natur und die Menschen geschaffen, und wenn er mit ihnen nicht zufrieden ist, kann er das, was er geschaffen hat, wieder vernichten. Aber das Gegengewicht zu dieser absoluten Macht Gottes über den Menschen bildet die Idee, dass der Mensch Gottes potenzieller Rivale ist. Der Mensch könnte Gott werden, wenn er nur vom Baum der Erkenntnis und vom Baum des Lebens essen würde. Die Frucht vom Baum der Erkenntnis gibt dem Menschen Gottes Weisheit; die Frucht vom Baum des Lebens würde ihm die Unsterblichkeit Gottes verleihen. Von der Schlange ermutigt, essen Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis und vollziehen damit den ersten der beiden Schritte. Gott fühlt sich in seiner Vormachtstellung bedroht. Er sagt: „Seht, der Mensch ist geworden wie wir; er erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt“ (Gen 3,22). Um sich vor dieser Gefahr zu schützen, vertreibt Gott den Menschen aus dem Paradies und beschränkt sein Leben auf hundertzwanzig Jahre.
Die christliche Interpretation der Geschichte vom Ungehorsam des Menschen als seinem „Sündenfall“ hat die augenfällige Bedeutung dieser Geschichte verdunkelt. Im biblischen Text kommt das Wort „Sünde“ überhaupt nicht vor; der Mensch fordert vielmehr Gott in seiner Vormachtstellung heraus, und er ist dazu befähigt, weil er selbst potenziell Gott ist. Der erste Akt des Menschen ist Rebellion, und Gott straft ihn, weil er aufbegehrte und weil Gott selbst die Vormachtstellung behalten will. Gott muss diese seine Vormachtstellung durch einen Gewaltakt schützen, indem er Adam und Eva aus dem Garten Eden vertreibt und sie so daran hindert, den zweiten Schritt zu Gott hin zu tun – nämlich vom Baum des Lebens zu essen. Der Mensch muss [VI-097] sich der überlegenen Macht Gottes fügen, aber er zeigt weder Bedauern noch Reue. Nach seiner Vertreibung aus dem Garten Eden beginnt er sein unabhängiges Leben; sein erster Akt des Ungehorsams ist der Beginn der menschlichen Geschichte, denn es ist der Anfang der menschlichen Freiheit.
Man kann die weitere Entwicklung des Gottesbegriffes nicht verstehen, wenn man den in der frühen Vorstellung enthaltenen Widerspruch nicht erkennt. Obgleich Gott der oberste Herrscher ist, hat er doch in seinem Geschöpf seinen potenziellen Herausforderer geschaffen; vom Anfang seiner Existenz an ist der Mensch der Rebell, der die potenzielle Gottheit in sich trägt. Wie wir noch sehen werden, befreit er sich in dem Maß, wie er sich entfaltet, immer mehr von der Oberhoheit Gottes, und umso mehr kann er wie Gott werden.[8] In der gesamten späteren Entwicklung des Gottesbildes spielt Gott als Eigentümer des Menschen eine immer kleinere Rolle.
Gott erscheint im Bibeltext noch ein zweites Mal als willkürlicher Herrscher, der mit seinen Geschöpfen verfahren kann wie der Töpfer, dem ein Gefäß nicht gefällt. Weil der Mensch „böse“ ist, beschließt Gott, alles Leben auf der Erde zu vertilgen.[9] Diese Geschichte führt im Weiteren dann jedoch zur ersten wichtigen Änderung in der Gottesvorstellung. Gott „bereut“ seinen Beschluss und entschließt sich, Noach, seine Familie und zwei Tiere von jeder Gattung zu retten. Das Entscheidende ist, dass Gott einen durch einen Regenbogen symbolisierten Bund (berit) mit Noach und dessen Nachkommen schließt. „Ich habe meinen Bund mit euch geschlossen. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden; nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben“ (Gen 9,11). Die Idee des Bundes zwischen Gott und dem Menschen mag archaischen Ursprungs sein und auf eine Zeit zurückgehen, wo Gott nur ein idealisierter Mensch war, der sich vielleicht nicht allzu sehr von den olympischen Göttern der Griechen unterschied – ein Gott, der den Menschen in seinen Tugenden und Lastern ähnlich war und von den Menschen herausgefordert werden konnte. Aber in dem Zusammenhang, in den die Redaktoren der Bibel die Geschichte vom Bund gestellt haben, bedeutet sie nicht eine Regression zu archaischeren Formen des Gottesbildes, sondern einen Fortschritt zu einer viel [VI-098] weiter entwickelten und reiferen Vision. Die Idee des Bundes ist tatsächlich ein ganz entscheidender Schritt in der religiösen Entwicklung des Judentums, ein Schritt, der der Vorstellung von der völligen Freiheit des Menschen, sogar seiner Freiheit von Gott, den Weg ebnet. Damit, dass Gott diesen Bund schließt, hört er auf, ein absoluter Herrscher zu sein. Er und der Mensch sind Vertragspartner geworden. Gott ist aus einem „absoluten“ zu einem „konstitutionellen“ Monarchen geworden. Er ist – genau wie der Mensch – an die Vertragsbedingungen gebunden. Gott hat die Freiheit verloren, willkürlich zu handeln, und der Mensch hat die Freiheit gewonnen, Gott unter Hinweis auf dessen Versprechungen und die im Bund festgelegten Grundsätze zur Rechenschaft zu ziehen. Es gibt nur eine Abmachung, aber sie ist grundsätzlicher Art: Gott verpflichtet sich zu einer unbedingten Ehrfurcht vor allem Leben, vor dem Leben der Menschen und aller lebenden Kreatur. Das Recht aller lebenden Wesen auf Leben ist im ersten Gesetz niedergelegt, das selbst Gott nicht mehr ändern kann. Wichtig ist, dass der erste Bund (in der endgültigen Redaktion der Bibel) ein Bund zwischen Gott und der Menschheit und nicht zwischen Gott und dem Stamm der Hebräer ist. Die Geschichte der Hebräer ist lediglich als ein Teil der Menschheitsgeschichte aufgefasst; der Grundsatz der „Ehrfurcht vor dem Leben“ (vgl. Albert Schweitzer) geht allen spezifischen Versprechungen an einen speziellen Stamm oder an ein bestimmtes Volk voraus.
Auf den ersten Bund zwischen Gott und der Menschheit folgt ein zweiter zwischen Gott und den Hebräern.[10] In Genesis 12,1-3 wird der Bund bereits angekündigt:
Zieh weg aus deinem Land, aus deiner Heimat und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde! Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will alle segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen.
In diesen letzten Worten finden wir wiederum den Universalismus. Der Segen wird nicht nur Abrahams Stamm zugutekommen; er wird auf das gesamte Menschengeschlecht ausgedehnt. Später wird Gottes Versprechen an Abraham auf einen Bund ausgedehnt, in dem seinen Nachkommen das Land zwischen dem Strom Ägyptens und dem Strom Euphrat versprochen wird. Dieser Bund wird in erweiterter Form in Genesis 17,7-10 wiederholt.
Den dramatischsten Ausdruck der radikalen Konsequenzen aus dem Bund finden wir in Abrahams Streitgespräch mit Gott, als dieser Sodom und Gomorra wegen ihrer „Schlechtigkeit“ vernichten will.[11] Als Gott Abraham seine Absicht eröffnet, tritt [VI-099] dieser näher und sagt:
Willst du auch den Gerechten mit den Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es fünfzig Menschen in der Stadt: Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vergeben wegen der fünfzig Gerechten dort? Das kannst du doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Gottlosen umbringen. Dann ginge es ja dem Gerechten genauso wie dem Gottlosen. Das kannst du doch nicht tun. Der Richter über die ganze Erde sollte sich nicht an das Recht halten? Da sprach der Herr: Wenn ich in Sodom, der Stadt, fünfzig Gerechte finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den fünfzig Gerechten fünf. Wirst du wegen der fünf die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, finde ich dort fünfundvierzig. Er fuhr fort, zu ihm zu reden: Vielleicht finden sich dort nur vierzig. Da sprach er: Ich werde es der vierzig wegen nicht tun. Und weiter sagte er: Mein Herr, zürne nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich dort nur dreißig. Er entgegnete: Ich werde es nicht tun, wenn ich dort dreißig finde. Darauf sprach er: Ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich dort nur zwanzig. Er antwortete: Ich werde sie um der zwanzig willen nicht vernichten. Und nochmals sagte er: Mein Herr, zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden sich dort nur zehn. Und wiederum sprach er: Ich werde sie um der zehn willen nicht vernichten. (Gen 18,23-32)
„Der Richter über die ganze Erde sollte sich nicht an das Recht halten?“ Dieser Satz lässt erkennen, welch fundamentale Veränderung des Gottesbildes der Bund bewirkt hat. Mit höflichen Worten, aber mit der Kühnheit eines Helden fordert Abraham Gott auf, sich an die Grundsätze der Gerechtigkeit zu halten. Er verhält sich nicht wie ein demütiger Bittsteller, sondern wie ein stolzer Mann, der das Recht hat, von Gott zu verlangen, dass dieser sich an das Prinzip der Gerechtigkeit hält. Abrahams Sprache bewegt sich höchst geschickt zwischen formeller Höflichkeit und Herausforderung – d.h. zwischen der Anrede in der dritten Person Singular („Mein Herr zürne nicht“) und der zweiten Person („Wirst du wegen der fünf die ganze Stadt vernichten?“)
Mit Abrahams Herausforderung ist ein neues Element in die biblische und die spätere jüdische Überlieferung hineingekommen. Eben weil Gott durch die Normen von Gerechtigkeit und Liebe gebunden ist, ist der Mensch nicht länger sein Sklave. Der Mensch kann Gott zur Rechenschaft ziehen – genauso wie Gott den Menschen zur Rechenschaft ziehen kann –, weil beide an festgelegte Prinzipien und Normen gebunden sind.
Adam und Eva begehrten ebenfalls auf gegen Gott mit ihrem Ungehorsam; aber sie mussten nachgeben. Abraham begehrte nicht dadurch gegen Gott auf, dass er ihm [VI-100] nicht gehorchte, sondern indem er ihm vorhielt, er wolle seine eigenen Versprechungen und seine eigenen Prinzipien verletzen.[12] Abraham ist kein rebellischer Prometheus; er ist ein freier Mann, der das Recht hat, Forderungen zu stellen, und Gott hat nicht das Recht, ihre Erfüllung zu verweigern.
Die dritte Phase in der Evolution des Gottesbegriffs ist erreicht, als Gott sich Moses offenbart. Aber selbst an diesem Punkt sind noch nicht alle anthropomorphen Elemente verschwunden. Ganz im Gegenteil „spricht“ Gott noch immer; er „wohnt auf einem Berg“; später wird er das Gesetz auf die beiden Tafeln schreiben. Diese anthropomorphe Sprache bei der Beschreibung Gottes zieht sich durch die ganze Bibel. Neu ist aber, dass Gott sich als der Gott der Geschichte und nicht als der Gott der Natur offenbart; noch wichtiger ist, dass der Unterschied zwischen Gott und einem Götzen in der Idee des namenlosen Gottes zum Ausdruck kommt.
Wir werden auf die Geschichte von der Befreiung aus Ägypten noch an späterer Stelle ausführlicher eingehen. Hier möge der Hinweis genügen, dass Gott dabei auf verschiedene von Moses vorgebrachte Einwände hin wiederholt Konzessionen macht. So meint Moses, die heidnischen Hebräer könnten die Sprache der Freiheit oder die Idee eines Gottes nicht verstehen, der sich nur als Gott der Geschichte offenbare, ohne einen Namen zu nennen, wenn er sage: „Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs“ (Ex 3,6). Moses wendet ein, die Hebräer würden ihm nicht glauben:
Da sagte Moses zu Gott: Ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Sie aber werden mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen dann sagen? (Ex 3,13)
Es ist ein triftiger Einwand, macht es doch das Wesen eines Götzen aus, dass er einen Namen hat; jedes Ding hat einen Namen, weil es etwas zeitlich und räumlich in sich Abgeschlossenes ist. Die an den Götzendienst gewöhnten Hebräer konnten sich unter einem namenlosen Gott der Geschichte nichts vorstellen, denn ein namenloser Götze ist ein Widerspruch in sich. Gott sieht das ein und macht dem Verständnisvermögen der Hebräer ein Zugeständnis. Er gibt sich einen Namen und sagt zu Moses: „Ich bin der ‚Ich-bin-da’.“ Und er fuhr fort: „So sollst du zu den Israeliten sagen: der ‚Ich-bin-da’ hat mich zu euch gesandt“ (Ex 3,14).
Was bedeutet dieser merkwürdige Name, den Gott sich da selbst gibt? Im hebräischen Text steht ehja ascher ehje oder „Ehje hat mich zu euch gesandt“.
Ehje ist die erste Person Imperfekt des hebräischen Verbs „sein“. Wir müssen uns daran erinnern, dass es im Hebräischen kein Präsens, sondern nur zwei Grundzeitformen gibt, nämlich Perfekt und Imperfekt. Das Präsens kann mit Hilfe des Partizips gebildet werden wie beim englischen „I am writing“, aber für die Form „I write“ (ich [VI-101] schreibe) gibt es keine entsprechende Zeitform. Sämtliche Zeitrelationen werden mit Hilfe sekundärer Veränderungen des Verbs ausgedrückt. (Vgl. W. Gesenius, 1910a, S. 117.) Dabei wird grundsätzlich jede Handlung entweder als vollendet oder als unvollendet empfunden. Bei Wörtern, die Handlungen in der physikalischen Welt bezeichnen, bezieht sich das Perfekt notwendigerweise auf die Vergangenheit. Wenn ein Brief vollendet ist, habe ich das Schreiben beendet; es gehört dann der Vergangenheit an. Aber bei Tätigkeiten nicht-physikalischer Art, wie zum Beispiel beim Wissen, ist das anders. Wenn ich mein Wissen vervollkommnet habe, so gehört das nicht unbedingt der Vergangenheit an, sondern das Perfekt von wissen kann im Hebräischen oft auch soviel bedeuten wie „ich weiß vollkommen“, „ich bin mir völlig klar darüber“. Das gleiche gilt für Verben wie „lieben“ und ähnliche.[13]
Bei der Beurteilung des „Namens“ Gottes ist wichtig, dass Ehje das Imperfekt des Verbums „sein“ ist. Das bedeutet, dass Gott ist, dass aber sein Sein nicht wie das eines Dinges vollendet, sondern ein lebendiger Prozess, ein Werden ist; nur ein Ding, das ist, das seine endgültige Form erreicht hat, kann einen Namen haben. Frei übersetzt würde Gottes Antwort an Moses lauten: „Mein Name ist Namenlos; sage ihnen, ‚Namenlos’ habe dich gesandt.“[14] Nur Götzen haben Namen, weil sie Dinge sind. Der „lebendige“ Gott kann keinen Namen haben. Im Namen Ehje finden wir einen ironischen Kompromiss zwischen Gottes Zugeständnis an die Unwissenheit des Volkes und seinem Beharren darauf, dass er ein namenloser Gott sein muss.
Dieser sich in der Geschichte manifestierende Gott kann nicht durch irgendein Bildnis, weder durch ein Klangbild – d.h. durch einen Namen – noch durch ein Abbild aus Stein oder Holz dargestellt werden. Dieses Verbot jeglicher Darstellung Gottes ist klar in den Zehn Geboten ausgedrückt, wenn es heißt:
Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten, im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen. (Ex 20,4-5)
Dieses Gebot ist eines der grundlegenden Prinzipien der jüdischen „Theologie“. [VI-102] Obgleich Gott mit einem paradoxen Namen (JHWH)[15] bezeichnet wurde, durfte selbst dieser Name nicht „missbraucht“ werden, wie es in den Zehn Geboten heißt. Nachmanides erläutert in seinem Kommentar, dieses „missbrauchen“ bedeute soviel wie „unnötigerweise aussprechen“; aus der späteren jüdischen Tradition und religiösen Praxis geht hervor, was dieses „unnötigerweise aussprechen“ bedeutet. Gesetzestreue Juden sprechen bis zum heutigen Tag niemals das Wort JHWH aus, sondern sagen statt dessen Adonai, was soviel bedeutet wie „mein Herr“, und sie sagen nicht einmal Adonai, außer im Gebet oder wenn sie die Bibel lesen. Wenn sie über Gott sprechen, so ersetzen sie Adonai durch Adoschem (den ersten Buchstaben von Adonai plus dem Wort schem, das einfach „Name“ bedeutet).
Selbst wenn ein gesetzestreuer Jude in einer fremden Sprache, z.B. auf Englisch, schreibt, so wird er statt God G’d schreiben, um Gottes Namen nicht unnötigerweise auszusprechen. Mit anderen Worten bedeutet in der jüdischen Tradition das biblische Verbot, Gott irgendwie darzustellen und Gottes Namen unnötigerweise auszusprechen, dass man zwar mit Gott im Gebet sprechen kann, in einem Akt, in dem man zu Gott in Beziehung tritt, dass man aber über Gott nicht sprechen darf, damit er sich nicht in einen Götzen verwandelt.[16] Wir werden in diesem Kapitel noch darauf zu sprechen kommen, welche Konsequenzen dieses Verbot in Bezug auf die Möglichkeit einer „Theologie“ hatte.
Die Entwicklung des Gottesbegriffes von einem Stammeshäuptling zu einem namenlosen Gott, von dem keine Darstellung erlaubt ist, findet ihre fortgeschrittenste und radikalste Formulierung fünfzehnhundert Jahre später in der Theologie des Moses Maimonides (1135-1204). Dieser war ein ganz hervorragender und sehr einflussreicher Gelehrter in der rabbinischen Tradition. Außerdem war er der bedeutendste jüdische Philosoph – oder Theologe – des Mittelalters. In seinem in arabischer Sprache geschriebenen philosophischen Hauptwerk, dem Führer der Unschlüssigen, entwickelt er seine „negative Theologie“, in der er es für unzulässig erklärt, positive Attribute zu gebrauchen, um Gottes Wesen (Existenz, Leben, Macht, Einheit, Weisheit, Willen usw.) zu beschreiben, während es zulässig sei, Attribute zu benutzen, die sich auf das Wirken Gottes beziehen.
Maimonides sagt:
Der Meister der Weisen, unser Lehrer Mose, stellte zwei Bitten, und es kam ihm auch von Gott auf beide eine Antwort zu. Die eine ging dahin, Gott möge ihn sein wahres Wesen, die andere schon früher gestellte dahin, Gott möge ihn seine Eigenschaften kennen lernen lassen. Gott antwortete ihm auf beide Bitten, indem er ihm verhieß, ihn alle seine Eigenschaften wissen zu lassen – und diese seien seine Wirkungen –, ihn aber belehrte, dass sein Wesen, so wie es wirklich ist, nicht erkannt werden könne. Gott machte ihn jedoch darauf aufmerksam, dass es im Denken einen Gesichtspunkt gebe, von welchem aus man zum letzten Ende der Erkenntnis gelangen könne, die zu erreichen dem Menschen möglich ist. (Maimonides, 1972, S. 117°f.) [VI-103]
Maimonides unterscheidet zwischen dem, was man unwissenden und einfachen Menschen und dem, was man Menschen mit philosophischer Bildung sagen sollte. Es genüge, ersteren zu sagen, sie sollten sich damit zufriedengeben, dass Gott der Eine sei, dass er unkörperlich und niemals einem äußeren Einfluss unterworfen und mit nichts außer mit sich selbst vergleichbar sei.
Wenn aber Maimonides den Gottesbegriff für die Nicht-Einfältigen erörtert, kommt er zu dem Schluss:
(...) dann wirst du erkennen müssen, dass Gott in keiner Weise und in keinem Sinn ein Wesensattribut zukommt, und dass es ebenso unmöglich ist, dass er ein Wesensattribut besitze, wie es unmöglich ist, dass er ein Körper sei. Wer aber glaubt, dass er Einer sei, desungeachtet aber zahlreiche Eigenschaften besitze, der nennt ihn zwar mit seinem Worte Einen, hält ihn aber in seinem Denken für eine Vielheit. (Maimonides, 1972, S. 151.)
Maimonides gelangt zu folgender Schlussfolgerung:
Somit kommt Gott auf keinerlei Weise ein positives Attribut zu. In der Tat sind es die verneinenden Aussagen, deren wir uns bedienen müssen, um das Denken zu dem hinzuleiten, was wir in Bezug auf Gott glauben müssen, weil aus ihnen in keiner wie immer gearteten Weise die Vorstellung einer Vielheit in Gott entstehen kann, und weil sie das Denken zu dem äußersten Endziele hinleiten, welches von Gott zu erkennen dem Menschen möglich ist. (Maimonides, 1972, S. 198°f.)
Maimonides’ Auffassung, dass man Gottes Wesen mit keinem positiven Attribut erfassen kann, führt zu einer naheliegenden Frage, die er folgendermaßen formuliert:
Es könnte jemand folgende Frage aufwerfen. Da es kein Mittel gibt, Gottes wahres Wesen zu erkennen, und klare Beweise es als unabweisbar ergeben, dass nur das einzige Ding erkannt werden kann, dass Gott existiert, indes die bejahenden Aussagen, wie wir gezeigt haben, unmöglich sind: in welcher Hinsicht können somit einzelne Denker vor den anderen einen Vorzug haben? Muss denn nicht das, was Mose und Salomo erkannt haben, dasselbe sein wie das, was irgendein beliebiger Schüler erkennt, und in dem es kein Mehr gibt? Und dennoch ist es bei den Gesetzeskundigen wie bei den Philosophen in gleicher Weise allgemein anerkannt, dass in dieser Hinsicht zwischen einem und dem anderen vielfache Abstufungen bestehen. (...) Denn ebenso wie das Dargestellte, je mehr Bestimmungen von ihm ausgesagt werden, desto mehr gekennzeichnet wird und der Darstellende dadurch desto näher zur Erkenntnis seines wahren Wesens gelangt, ebenso gelangst du umso näher zur Erkenntnis Gottes, je mehr verneinende Aussagen du von ihm machst. Jedenfalls bist du ihm näher als derjenige, der ihm nichts von dem abspricht, was erwiesenermaßen Gott abgesprochen werden muss. (Maimonides, 1972, S. 202; Hervorhebungen E. F.)
Maimonides beschließt diese Erörterung mit der Bemerkung, dass der Psalmist, wenn er sagt: „Schweigen ist dir Lob“ [vgl. Psalm 65,2] seine Idee von der Unangemessenheit positiver Attribute damit am besten zum Ausdruck bringe.[17] [VI-104]
Wie wir sahen, sind in Maimonides’ Doktrin von den Attributen zwei miteinander verflochtene Aspekte enthalten: die Wirkattribute und die Lehre von den negativen Attributen (vgl. J. Guttmann, 1964). Er möchte die Gottesvorstellung von allen Unreinheiten befreien und beseitigt alle positiven Wesensattribute, weil diese solche Unreinheiten enthalten. Er ist allerdings weniger radikal als die griechischen Neuplatoniker, an deren Lehren er sich anschließt, denn er führt doch bis zu einem gewissen Grad positive Attribute wieder ein, wenn auch nicht in die formale Struktur seines Denkens. Wenn wir zum Beispiel sagen, Gott sei nicht ohnmächtig, so implizieren wir, dass Gott allmächtig ist. Und das gleiche gilt für alle Negationen von Privationen.[18] Aus diesem Grund haben mittelalterliche Philosophen gegen Maimonides’ negative Attribute Einwände erhoben und argumentiert, diese führten
indirekt zur Aussage eben der Attribute, die nach Maimonides nicht direkt von Gott ausgesagt werden sollten. Indem wir (Gottes) Unwissenheit negieren, bekräftigen wir in Wirklichkeit sein Wissen; indem wir seine Ohnmacht negieren, bekräftigen wir in Wirklichkeit seine Macht. (J. Guttmann, 1964, S. 161.)
Guttmann fasst dies so zusammen:
Maimonides’ Lehre von der Negation der Privationen gibt uns lediglich die Möglichkeit zu sagen, dass das einfache Wesen Gottes Vollkommenheiten in sich schließt, welche auf die eine oder andere Art den Qualitäten des Wissens, des Willens und der Macht entsprechen, aber deren Wesen unbestimmt bleibt. (J. Guttmann, 1964, S. 164.)
Wenn dies auch eine annehmbare Interpretation ist, ändert es doch nichts an der Tatsache, dass sich die formale Struktur von Maimonides’ Denken in seiner Betonung der Unerkennbarkeit von Gottes Wesen nicht von den griechischen Neuplatonikern unterscheidet. Wir treffen hier, wie auch bei anderen Aspekten des Maimonides, auf gewisse Widersprüche, die vermutlich mit einem Widerspruch in Maimonides selbst zusammenhängen: mit dem Widerspruch zwischen dem kühnen Philosophen, der stark vom griechischen und arabischen Denken beeinflusst war, und dem talmudischen traditionalistischen Rabbi, der den Kontakt mit der traditionellen Grundlage des jüdischen Denkens nicht verlieren wollte. Meine eigene Interpretation von Maimonides’ Theologie gründet sich auf den einen Aspekt dieser Theologie. Mir scheint dies zulässig, wenn man sich darüber klar ist, dass seine Position tatsächlich ambivalent ist.
Die Gottesvorstellung hat eine Entwicklung durchgemacht vom eifersüchtigen Gott Adams über den namenlosen Gott Moses’ bis hin zum Gott des Maimonides, von [VI-105] dem der Mensch nur wissen kann, was er nicht ist. Die „negative Theologie“ des Maimonides führt in letzter Konsequenz – die Maimonides allerdings selbst nicht ins Auge gefasst hat – zum Ende der Theologie. Wie kann es eine „Wissenschaft von Gott“ geben, wenn man über Gott nichts sagen oder denken kann? Wenn Gott selbst der undenkbare, der „verborgene“, der „schweigende“ Gott, das Nichts ist?[19]
Die Entwicklung vom namenlosen Gott des Moses zu Maimonides’ Gott ohne Wesensattribute wirft zwei Fragen auf: 1. Welche Rolle spielt die Theologie in der biblischen und in der späteren jüdischen Überlieferung? 2. Was bedeutet es in dieser Überlieferung, dass der Mensch die Existenz Gottes bejaht?
Was die Frage nach der Rolle der Theologie[20] und nach der Entwicklung einer Orthodoxie, d.h. „Rechtgläubigkeit“ angeht, so ist es eine Tatsache, dass weder die Bibel noch das spätere Judentum eine großangelegte Theologie entwickelt haben. Natürlich finden wir in der Bibel eine Überfülle von Aussagen über Gottes Wirken. Er hat die Natur und den Menschen geschaffen; er hat die Hebräer aus Ägypten befreit; er hat sie ins Gelobte Land geführt. Gott ist, bedeutet soviel wie Gott wirkt; er belohnt und bestraft voll Liebe, Erbarmen und Gerechtigkeit. Aber es finden sich keine Spekulationen über das Wesen und die Natur Gottes. Dass Gott ist, ist das einzige theologische Dogma – wenn man es überhaupt so nennen will –, das sich im Alten Testament findet, und es findet sich nichts darüber, was oder wer Gott ist. Wenn es im Pentateuch heißt: „Was noch verborgen ist (ha-nistaroth), steht bei dem Herrn, unserem Gott; was schon offenbar ist, gilt für uns und unsere Kinder“ (Dtn 29,28), so scheint das in der Tat jede theologische Spekulation über die Natur Gottes ausdrücklich zu verurteilen.
Die meisten der bedeutenden Propheten, angefangen von Amos, befassen sich wenig mit theologischen Spekulationen. Sie sprechen von Gottes Wirken, von seinen Geboten für den Menschen, von seinen Belohnungen und Strafen, aber sie geben sich keinerlei Spekulationen über Gott hin und befürworten sie auch nicht, genauso wie sie nicht viel vom Ritual halten.
Auf den ersten Blick scheinen der Talmud und die spätere jüdische Tradition mehr an Theologie und an Orthodoxie zu enthalten. Das wichtigste in diesem Zusammenhang zu erwähnende talmudische Beispiel, bei dem es sich allerdings nicht um eine Aussage über das Wesen Gottes handelt, ist die nachdrückliche Beteuerung der Pharisäer, dass ein frommer Jude an die Auferstehung der Toten (die oft nicht deutlich [VI-106] von der Unsterblichkeit der Seele unterschieden wird), glauben müsse, und ihre Warnung, dass er nicht an der „kommenden Welt“ teilhaben werde, wenn er diesen Glauben nicht teile. Bei näherem Zusehen erkennt man jedoch, dass dieses eine Ausnahme bildende Dogma ein Symptom des Kampfes zwischen den beiden gesellschaftlichen Gruppen der Pharisäer und Sadduzäer ist und nicht die theologische Ursache des Schismas zwischen ihnen. Die Sadduzäer repräsentierten die Aristokratie (die weltliche Aristokratie und den Priesteradel), während die Pharisäer der gelehrte, intellektuelle Teil der Mittelklasse waren. Ihre sozialen und politischen Interessen waren diametral entgegengesetzt, was sich auch auf ihre theologischen Ansichten übertrug. (Vgl. L. Finkelstein, Band II, 1962.) Am meisten unterschieden sie sich in ihren Ansichten über das Dogma der Auferstehung. Die Pharisäer behaupteten fest, dass der Glaube an die Auferstehung in der Bibel verankert sei; die Sadduzäer bestritten dies. Die Pharisäer versuchten, die Richtigkeit ihres Standpunktes mit Bibelzitaten zu beweisen. Aber ihre Zitate widerlegten ihre Ansicht, denn die „Beweise“, die sie anboten, waren bestenfalls ziemlich gewaltsame Interpretationen von Bibelstellen.[21] Realistisch betrachtet hatten die Sadduzäer zweifellos recht, wenn sie behaupteten, dass die Bibel die Auferstehung nicht lehre. Aus dem Text in der Mischna (Sanhedrin X) geht klar hervor, dass die Pharisäer die Sadduzäer damit bekämpfen wollten, dass sie ihnen das Heil absprachen, weil sie neben anderen Ketzereien nicht an die Auferstehung glaubten.[22]
Abgesehen von dieser Kontroverse mit den Sadduzäern findet sich im Talmud nur wenig, was man als „Theologie“ oder „Orthodoxie“ bezeichnen könnte. Die Weisen des Talmud argumentieren hauptsächlich über Auslegungen des Gesetzes, über Grundsätze der Lebensführung, aber nicht über Glaubensüberzeugungen in Bezug auf Gott. Der Grund hierfür ist, dass in der jüdischen Tradition „an Gott glauben“ soviel bedeutet wie „seine Taten nachahmen“, nicht aber „etwas über ihn wissen“. Ich hebe das Wort über hervor, weil mir damit ein Wissen gekennzeichnet scheint, das man nur über Dinge besitzen kann. Es stimmt freilich, dass die Propheten und Maimonides von dem Wissen um Gott (daat) als dem ersten Prinzip sprechen, das [VI-107] jeder religiösen Handlung zugrunde liege. Aber dieses Wissen ist etwas völlig anderes als ein Wissen, das die Möglichkeit gäbe, Gott positive Attribute zuzuschreiben. Ich möchte damit sagen, dass „um Gott wissen“ im prophetischen Sinn das gleiche ist wie „Gott lieben“ oder „Gottes Existenz bekennen“; es ist keine Spekulation über Gott oder über seine Existenz; es ist keine Theo-logie.[23]
Eine interessante Illustration hierzu ist ein Talmud-Kommentar zu der Klage des Propheten Jeremia „Mich aber haben sie verlassen und mein Gesetz nicht befolgt“ (Jer 16,11). In Pesikta de Ray Kahana finden wir den Kommentar: „Wenn sie nur mich verlassen und mein Gesetz gehalten hätten!“ Dieser Kommentar besagt natürlich nicht, dass sein Verfasser wollte, dass die Juden sich von Gott abkehrten; aber er bedeutet, dass es, wenn man vor der Entscheidung stünde, immer noch wichtiger wäre, das Gesetz zu halten, als an Gott zu glauben. Die Kommentatoren versuchen die Schroffheit dieser Behauptung zu mildern, indem sie sagen, wenn die Juden das Gesetz befolgten, würden sie schließlich zu Gott zurückfinden.
Für die untergeordnete Rolle der theologischen Dogmen in der späteren jüdischen Entwicklung könnte nichts charakteristischer sein als das Schicksal der „Dreizehn Glaubensartikel“, die Maimonides formuliert hat. Was geschah mit diesen Artikeln? Wurden sie als Dogmen oder als Glaubensartikel angenommen, von denen das Heil abhing? Nichts dergleichen. Sie wurden nie „angenommen“ oder dogmatisiert – tatsächlich war das Höchste, was mit ihnen geschah, dass sie im traditionellen Gottesdienst der aschkenasischen Juden[24] in einer poetischen Version an Feiertagen und am Sabbat zum Schluss des Abendgottesdienstes und von einigen aschkenasischen Gemeinden nach den Morgengebeten gesungen wurden.
Die beiden großen Schismen, zu denen es in der späteren jüdischen Geschichte kam, hatten mit der eigentlichen Theologie nur wenig zu tun, wenngleich die Kontrahenten die dabei vorgebrachten Argumente als „theologisch“ im weiteren Sinn auffassten.[25]
Das eine Schisma entstand im siebzehnten Jahrhundert nach dem Fiasko des falschen Messias Sabbatai Zwi in der Auseinandersetzung mit einer Minderheit, die nicht glauben wollte, dass sie dem grausamen Schwindel eines Usurpators zum Opfer gefallen war. Das andere Schisma entstand zwischen den Chassidim und ihren Gegnern, den Mitnagdim. In ihm kam der Konflikt der armen, ungebildeten Massen in Galizien, Polen und Litauen mit den gelehrten Rabbinern zum Ausdruck, die das Hauptgewicht auf intellektuelles Wissen und Gelehrsamkeit legten.[26] [VI-108] Unsere Erörterung der Gottesvorstellung hat uns zu dem Schluss geführt, dass es nach Auffassung der Bibel und der späteren jüdischen Tradition nur etwas gibt, worauf es wirklich ankommt, dass nämlich Gott ist. Der Spekulation über Gottes Natur und Wesen wird nur geringe Bedeutung zugeschrieben. Aus diesem Grund hat keine theologische Entwicklung stattgefunden, die mit der des Christentums zu vergleichen wäre. Aber man kann dieses Phänomen, dass das Judentum keine einflussreiche Theologie entwickelt hat, nur verstehen, wenn man vollständig begreift, dass die jüdische „Theologie“ eine negative Theologie war, und das nicht nur im Sinn des Maimonides, sondern auch noch in einem anderen Sinn: Das Bekenntnis zu Gott ist im Grunde die Negation von Götzen.
Jedem, der in der Hebräischen Bibel liest, muss es auffallen, dass, während sich kaum etwas von Theologie darin findet, ihr zentrales Thema der Kampf gegen den Götzendienst ist.
Die Zehn Gebote, der Kern des biblischen Gesetzes, beginnen zwar mit der Erklärung: „Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, aus dem Sklavenhaus“ (Gott ist der Gott der Befreiung), sie führen dann aber als erstes Gebot das Verbot des Götzendienstes auf: „Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgend etwas im Himmel droben, auf der Erde unten, im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen“ (Ex 20,3-6).
Der Kampf gegen den Götzendienst ist das religiöse Hauptthema, das sich vom Pentateuch bis zu Jesaja und Jeremia durch das ganze Alte Testament zieht. Die grausame Kriegführung gegen die in Kanaan lebenden Stämme und viele der Ritualgesetze kann man nur verstehen, wenn man bedenkt, dass sie das Volk vor der Ansteckung durch den Götzendienst bewahren sollten. Bei den Propheten spielt das Thema der Bekämpfung des Götzendienstes die gleiche hervorragende Rolle; aber anstelle des Gebots, die Götzenverehrer auszurotten, wird hier der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass alle Völker den Götzendienst aufgeben und sich in seiner Ablehnung zusammenfinden werden.
Was ist Götzendienst? Was ist ein Götze? Weshalb will die Bibel so unbedingt jede Spur von Götzendienst ausrotten? Was ist der Unterschied zwischen Gott und Götzen? Der Unterschied liegt nicht in erster Linie darin, dass es nur einen Gott und dass es viele Götzen gibt. Wenn der Mensch nur einen Götzen und nicht viele anbeten würde, so bliebe dieser doch ein Götze und wäre nicht Gott. Und wie oft war denn auch tatsächlich die Verehrung Gottes nichts als die Verehrung eines Götzen, der als Gott der Bibel verkleidet war?
Wenn man verstehen will, was ein Götze ist, muss man zunächst verstehen, was Gott nicht ist. Gott als höchster Wert und höchstes Ziel ist nicht ein Mensch, er ist nicht der Staat, er ist keine Institution, ist nicht die Natur, nicht Macht, Besitz, Sexualkräfte oder irgendein vom Menschen künstlich gefertigtes Gebilde. Die Beteuerungen „ich liebe Gott“, „ich folge Gott nach“, „ich möchte Gott ähnlich werden“, bedeuten vor allem: „Ich liebe keine Götzen, ich folge ihnen nicht nach und ahme sie nicht nach.“
Ein Götze repräsentiert den Gegenstand der zentralen Leidenschaft des Menschen: [VI-109] seinen Wunsch, zur Mutter-Erde zurückzukehren, das Streben nach Besitz, Macht, Ruhm und so weiter. Die vom Götzen repräsentierte Leidenschaft ist gleichzeitig der höchste Wert innerhalb des Wertsystems des Menschen. Nur eine Geschichte des Götzendienstes könnte die Hunderte von Götzen aufzählen und analysieren, die menschliche Leidenschaften und Wünsche repräsentieren. Hier möge die Feststellung genügen, dass die Geschichte der Menschheit bis zum heutigen Tage in erster Linie die Geschichte der Götzenverehrung ist, von den primitiven, aus Lehm und Holz geformten Götzen bis zu den modernen Idolen von Staat, Führer, Produktion und Konsum, denen ein zum Götzen gemachter Gott seinen Segen gibt.
Der Mensch überträgt seine eigenen Leidenschaften und Eigenschaften auf den Götzen (das Idol). Je mehr er sich selbst arm macht, umso größer und stärker wird der Götze. Der Götze ist die entfremdete Form der Selbsterfahrung des Menschen.[27] Indem der Mensch den Götzen verehrt, verehrt er sich selbst. Aber dieses Selbst ist nur eine begrenzter Teilaspekt des Menschen: seine Intelligenz, seine physische Kraft, seine Macht, sein Ruhm und so fort. Wenn der Mensch sich mit einem Teilaspekt seiner selbst identifiziert, so beschränkt er sich auf diesen Aspekt. Er verliert dann seine Totalität als menschliches Wesen und hört auf zu wachsen. Er wird abhängig von dem Götzen, denn nur wenn er sich diesem unterwirft, findet er den Schatten, wenn auch nicht die Substanz seiner selbst.
Der Götze ist ein Ding, er ist nichts Lebendiges. Gott dagegen ist ein lebendiger Gott. „Der Herr aber ist in Wahrheit Gott, lebendiger Gott“ (Jer 10,10); oder „Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott“ (Ps 42,3). Der Mensch, der versucht, wie Gott zu sein, ist ein offenes System; er nähert sich Gott an; der Mensch, der sich Götzen unterwirft, ist ein geschlossenes System und wird selbst zu einem Ding. Der Götze ist ohne Leben; Gott ist lebendig. Der Gegensatz zwischen Götzendienst und der Anerkennung Gottes ist letzten Endes der zwischen der Liebe zum Toten und der Liebe zum Lebendigen. (Vgl. E. Fromm, Die Seele des Menschen (1964a), GA II, S. 179-198.)
Der Gedanke, dass der Götze ein vom Menschen gefertigtes Ding, ein Werk seiner Hände ist, das er anbetet und vor dem er sich beugt, wird häufig zum Ausdruck gebracht. Jesaja sagt:
Man bezahlt einen Goldschmied, damit er einen Gott daraus macht. Man wirft sich nieder und betet das Götterbild an. Man trägt es auf der Schulter und schleppt es umher; dann stellt man es wieder auf seinen Platz, und dort bleibt es stehen; es rührt sich nicht von der Stelle. Ruft man es an, so antwortet es nicht; wenn man in Not ist, kann es nicht helfen. (Jes 46,6-7)
Die Goldschmiede machen einen Gott daraus – einen Gott, der sich nicht bewegen, der nicht antworten, nicht reagieren kann; einen Gott, der tot ist; einen, dem der Mensch sich zwar unterwerfen, aber zu dem er nicht in Beziehung treten kann. Es gibt bei Jesaja noch eine andere, stark ironisch gefärbte Darstellung des Götzen: [VI-110]
Der Schmied facht die Kohlenglut an,
er formt (das Götterbild) mit seinem Hammer
und bearbeitet es mit kräftigem Arm.
Dabei wird er hungrig und müde;
trinkt er kein Wasser, so verlässt ihn die Kraft.
Der Schnitzer misst das Holz mit der Messschnur,
er entwirft das Bild mit dem Stift
und schnitzt es mit seinem Messer;
er umreißt es mit seinem Zirkel
und formt die Gestalt eines Menschen;
in einem eigenen Haus soll es stehen.
Man fällt eine Zeder, wählt eine Eiche oder sonst einen mächtigen Baum,
den man stärker werden ließ als die übrigen Bäume im Wald.
Oder man pflanzt einen Lorbeerbaum, den der Regen groß werden lässt.
Das Holz der Bäume nehmen die Menschen zum Heizen;
man macht ein Feuer und wärmt sich daran.
Auch schürt man das Feuer und bäckt damit Brot.
Oder man schnitzt daraus einen Gott und wirft sich nieder vor ihm;
man macht ein Götterbild und bewegt die Knie vor ihm.
Den einen Teil des Holzes wirft man ins Feuer
und röstet Fleisch an der Glut
und sättigt sich an dem Braten.
Oder man wärmt sich am Feuer und sagt:
Oh, wie warm! Ich spüre das Feuer.
Aus dem Rest des Holzes aber macht man sich einen
Gott, einen Götzen;
man wirft sich vor ihm auf die Knie
und betet zu ihm und sagt:
Hilf mir, du bist doch mein Gott!
Unwissend sind sie und dumm;
denn sie sind verblendet,
ihre Augen sehen nichts mehr
und ihr Herz wird nicht klug,
Sie überlegen nicht, was sie tun,
sie handeln ohne Erkenntnis und Einsicht;
nicht einer sagt zu sich selbst:
Den einen Teil habe ich ins Feuer geworfen,
habe Brot in der Glut gebacken
und Fleisch gebraten und es gegessen.
Aus dem Rest des Holzes aber habe ich mir einen
abscheulichen Götzen gemacht,
und nun knie ich nieder vor einem Holzklotz.
(Jesaja 44,12-19) [VI-111]
Man könnte das Wesen des Götzendienstes tatsächlich nicht drastischer beschreiben: Der Mensch verehrt Götzen, die nicht sehen können, und schließt selbst die Augen, so dass auch er nicht sehen kann.
Der gleiche Gedanke findet einen schönen Ausdruck im 115. Psalm:
(...) mit ihren Händen können sie (die Götzen) nicht greifen, mit den Füßen nicht gehen, sie bringen keinen Laut hervor aus ihrer Kehle. Die sie gemacht haben, sollen ihrem Machwerk gleichen.
Mit diesen Worten sagt der Psalmist, worin das Wesen des Götzendienstes besteht: Der Götze ist tot, und wer ihn macht, ist ebenfalls tot. Es dürfte kein Zufall sein, dass der Verfasser des Psalms, der von der Liebe zum Leben tief durchdrungen gewesen sein muss, ein paar Verse weiter unten schreibt: „Tote können den Herrn nicht mehr loben, keiner der ins Schweigen hinabfuhr.“
Wenn der Götze die entfremdete Manifestation der eigenen Kräfte des Menschen ist und wenn dieser nur durch eine unterwürfige Bindung an den Götzen mit diesen Mächten in Kontakt kommt, so folgt daraus, dass Götzendienst mit Freiheit und Unabhängigkeit notwendigerweise unvereinbar ist. Immer und immer wieder bezeichnen die Propheten den Götzendienst als Selbstzüchtigung und Selbstdemütigung, und die Verehrung Gottes als Selbstbefreiung und als Befreiung von anderen.[28] Aber, so könnte man einwenden, ist der hebräische Gott nicht auch ein Gott, den man fürchtet? Das trifft zweifellos zu, solange Gott der willkürliche Herrscher ist. Abraham fürchtet zwar Gott noch immer, wagt aber, ihn herauszufordern; und Moses wagt, mit ihm zu argumentieren. Die Angst vor Gott und die Unterwerfung unter ihn werden immer geringer, je weiter sich das Gottesbild im Laufe der späteren Überlieferung entwickelt. Der Mensch wird Gottes Partner und fast seinesgleichen; Gott bleibt natürlich der Gesetzgeber, der belohnt und bestraft; aber seine Belohnungen und Strafen sind keine Willkürakte mehr (wie beispielsweise Gottes Entscheidungen über das Schicksal der Menschen im Calvinismus); sie richten sich danach, ob der Mensch das moralische Gesetz erfüllt oder verletzt, und unterscheiden sich nicht allzu sehr vom unpersönlichen indischen Karma. In der Bibel und in der späteren jüdischen Tradition erlaubt Gott dem Menschen frei zu sein; er offenbart ihm das Ziel des menschlichen Lebens, den Weg, auf dem er dieses Ziel erreichen kann; aber er zwingt ihn nicht, die eine oder die andere Richtung einzuschlagen. Das könnte auch kaum anders sein in einem religiösen System, in dem die höchste Norm für die Entwicklung des Menschen die Freiheit ist, wie ich im folgenden Kapitel zu zeigen versuche. Götzendienst verlangt seinem Wesen nach nach Unterwerfung – die Verehrung Gottes dagegen verlangt Unabhängigkeit.
Die logische Konsequenz des jüdischen Monotheismus ist die Absurdität der Theologie. Wenn Gott keinen Namen hat, gibt es nichts, über das man reden könnte. Aber alles Reden über Gott – und daher auch alle Theologie – impliziert, dass man Gottes Namen unnötigerweise gebraucht; ja, es verführt fast zum Götzendienst. [VI-112] Andererseits haben Götzen Namen; bei ihnen handelt es sich um Dinge. Sie sind nicht im Werden, sie sind fertig gestellt. Daher kann man auch über sie reden; man muss sogar über sie reden, denn wie könnte man vermeiden, ihnen unwissentlich zu dienen, wenn man sie nicht kennen würde?
Wenngleich für die Theologie kein Platz ist, möchte ich doch meinen, eine „Idologie“ sei angebracht und notwendig. Es ist Aufgabe der „Wissenschaft von den Idolen“, das Wesen der Götzen und des Götzendienstes aufzuzeigen und die verschiedenen Götzen zu identifizieren, die bis zum heutigen Tag in der Geschichte der Menschheit verehrt wurden und weiter verehrt werden. Einst waren die Götzen Tiere, Bäume, Sterne oder Figuren von Männern und Frauen. Sie hießen Baal oder Astarte und waren noch unter tausenderlei anderen Namen bekannt. Heute nennt man sie Ehre, Fahne, Staat, Mutter, Familie, Ruhm, Produktion, Konsum und vieles andere. Aber weil der offizielle Gegenstand der Verehrung Gott ist, erkennt man die Götzen von heute nicht mehr als das, was sie sind – als reale Objekte menschlicher Verehrung. Daher brauchen wir eine „Idologie“, welche die einflussreichen Idole einer jeden Epoche untersucht sowie die Art der ihnen gezollten Verehrung, die ihnen dargebrachten Opfer, ihre Synkretisierung mit der Gottesverehrung und die Verwandlung von Gott selbst in einen Götzen – ja tatsächlich oft in den Obergötzen, der den anderen seinen Segen gibt. Besteht denn wirklich ein so großer Unterschied, wie wir annehmen, zwischen den Menschenopfern, welche die Azteken ihren Göttern brachten, und den modernen Menschenopfern, die wir im Krieg den Idolen des Nationalismus und des souveränen Staates darbringen?
In der jüdischen Überlieferung wird immer wieder auf die enorme Gefährlichkeit des Götzendienstes hingewiesen. So heißt es im Talmud: „Wer den Götzendienst ablehnt, erfüllt damit gleichsam die ganze Tora“ (Talmud, Hullin 5a). In der späteren Entwicklung wurde die Besorgnis laut, dass sogar religiöse Akte sich in Götzenanbetung verwandeln könnten. So sagte einer der großen chassidischen Meister, der Kosker Rabbi:
Das Verbot der Herstellung von Götzen schließt das Verbot ein, auch die mitzwot (die religiösen Handlungen) zu vergötzen. Wir sollten uns nie einbilden, der Hauptzweck einer mitzwa sei ihre äußere Form, und ihre innere Bedeutung sei zweitrangig. Wir wollten genau die entgegengesetzte Haltung einnehmen. (L. I. Newman, 1934, S. 193.)
Die „Idologie“ kann zeigen, dass ein entfremdeter Mensch unausweichlich ein Götzenanbeter ist, da er sich selbst beraubt hat, indem er seine lebendigen Kräfte auf Dinge außerhalb seiner selbst übertrug, die er nun verehren muss, um ein Körnchen seiner selbst zu behalten und letzten Endes, um sich sein Identitätsgefühl zu bewahren.
In der biblischen und in der späteren jüdischen Überlieferung nimmt das Verbot des Götzendienstes eine ebenso hohe, ja vielleicht noch höhere Stelle ein als das Gebot der Verehrung Gottes. Diese Überlieferung lässt keinen Zweifel daran, dass man Gott nur verehren kann, wenn jede Spur von Götzendienst getilgt ist, und zwar nicht nur in dem Sinn, dass alle sichtbaren und bekannten Götzen beseitigt sind, sondern dass auch die Einstellung des Götzendienstes, nämlich Unterwerfung und Entfremdung, verschwindet. [VI-113]
Tatsächlich kann das Wissen um die Idole und der Kampf gegen den Götzendienst Menschen aller Religionen und auch die ohne jede Religion vereinen. Auseinandersetzungen über Gott werden die Menschen nur untereinander entzweien, es werden dabei Worte an die Stelle der Realität menschlicher Erfahrung treten, was schließlich zu neuen Formen des Götzendienstes führen wird. Das soll nicht heißen, dass die Anhänger der Religion nicht auch weiterhin ihrem Glauben als einem Glauben an Gott Ausdruck verleihen sollten (vorausgesetzt sie haben ihren Glauben von allen Elementen des Götzendienstes gereinigt), sondern dass die Möglichkeit besteht, die Menschheit in der Ablehnung von Götzen und so in einem nichtentfremdeten gemeinsamen Glauben geistig zu einen.
Die Richtigkeit dieser Interpretation der Rolle der Theologie und der Negation des Götzendienstes findet ihre Bestätigung in einer der bedeutsamsten Entwicklungen in der nachbiblischen jüdischen Tradition, nämlich in der Lehre von den „Noachiden“, den Söhnen Noachs.
Um deren Ideen zu begreifen, müssen wir das besondere Dilemma verstehen, in dem sich die talmudischen Weisen und ihre Nachfolger befanden. Sie erwarteten nicht, dass andere Völker der Welt den jüdischen Glauben annehmen würden, und wünschten dies nicht einmal. Andererseits war in der messianischen Idee die schließliche Vereinigung und Errettung der gesamten Menschheit enthalten. Hieß das, dass im messianischen Zeitalter alle Völker den jüdischen Glauben annehmen und im Glauben an den einen Gott vereint sein würden?
Wenn das der Fall war, wie konnte es dazu kommen, wo es doch den Juden widerstrebte, zu missionieren? Die Antwort auf diese Frage gaben die Noachiden, wenn sie sagten:
Unsere Rabbi haben gelehrt: „Die Söhne Noachs erhielten folgende sieben Gebote: soziale Gesetze zur Errichtung von Gerichtshöfen (oder nach Nachmanides das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit), das Verbot der Blasphemie (Lästerung des Namens Gottes), des Götzendienstes, des Ehebruchs, des Blutvergießens, des Raubs und des Genusses des Fleisches lebender Tiere.“ (Talmud, Sanhedrin 56a)
Ich möchte hier die Meinung vertreten, dass die Nachkommen Noachs schon lange bevor Gott sich offenbart und auf dem Berge Sinai Moses die Tora gegeben hatte, durch gemeinsame Vorschriften für das ethische Verhalten geeint waren. Eine dieser Vorschriften bezieht sich auf das Verbot einer archaischen Form der Ernährung, nämlich den Genuss des Fleisches lebender Tiere.[29] Vier Vorschriften beziehen sich auf die Beziehung von Mensch zu Mensch: das Verbot des Blutvergießens, des Raubs und des Ehebruchs und das Gebot, ein System von Recht und Gerechtigkeit zu errichten. Nur zwei Gebote haben einen religiösen Inhalt: das Verbot, Gottes Namen zu lästern und das Verbot des Götzendienstes. Es fehlt das Gebot, Gott zu verehren.
Dies scheint an und für sich nicht weiter verwunderlich. Wie konnte der Mensch Gott verehren, wenn er nicht wusste, wer Gott war? Aber die Dinge liegen noch verwickelter. Wenn er nicht wusste, wer Gott war, wie konnte man ihm dann gebieten, ihn nicht zu lästern und keine Götzen zu verehren? Historisch – auf die Nachkommen Noachs [VI-114] bezogen – haben diese beiden negativen Verbote kaum einen Sinn.[30] Aber wenn man die Erklärung im Talmud nicht für eine historische Tatsache, sondern für eine ethisch-religiöse Auffassung nimmt, dann erkennt man, dass die Rabbinen ein Prinzip formulierten, in dem die „negative Theologie“ (in einem anderen Sinn als bei Maimonides), nämlich nicht zu lästern und Götzen nicht zu verehren, alles war, was von den Söhnen Noachs verlangt wurde. Dieses spezielle Zitat aus dem Talmud besagt lediglich, dass die beiden negativen Gebote nur für die Zeit gelten, bevor Gott sich Abraham offenbarte, und die Möglichkeit bleibt nicht ausgeschlossen, dass nach diesem Ereignis die Verehrung Gottes eine gültige Norm für alle Völker sein könnte. Aber eine andere Auffassung, die sich in der rabbinischen Literatur findet, nämlich die von den „Frommen unter den Völkern der Welt“, von den frommen Heiden (chassidej umot ha-olam) weist darauf hin, dass dies nicht der Fall ist. Diese Gruppe wird definiert als diejenigen, welche die sieben Gebote Noachs erfüllen. Das Wesentliche an dieser neuen Auffassung ist, dass es von ihnen heißt: „Die Gerechten unter den Völkern haben in der kommenden Welt ihren Platz“ (Tosefta, Sanhedrin XIII,2). Dieser „Platz in der kommenden Welt“ ist der traditionelle Ausdruck für das Heil, das allen Juden, die nach der Tora leben, in Aussicht gestellt wird. Die rechtliche Formulierung findet sich in Maimonides’ Mischne Tora XIV, 5,8: „Ein Heide, der die sieben Gebote (Noachs) anerkennt und sie gewissenhaft erfüllt, ist ein ‚gerechter Heide’ und wird teilhaben an der kommenden Welt.“
Was bedeutet diese Auffassung letzten Endes? Die Menschheit braucht, um das Heil zu erlangen, nicht unbedingt Gott anzubeten. Alles, was sie tun muss, ist Gott nicht lästern und Götzen nicht anbeten. So haben die Schriftgelehrten den Konflikt zwischen der messianischen Idee, dass alle Menschen erlöst werden, und ihrer Abneigung gegen das Missionieren gelöst. Die universale Erlösung hängt nicht davon ab, dass man sich zum Judentum bekennt; sie hängt nicht einmal davon ab, dass man Gott anbetet. Das Menschengeschlecht wird den Zustand des Heils erreichen, wenn es nur Götzen nicht anbetet und Gott nicht lästert. Dies ist die praktische Anwendung der „negativen Theologie“ auf das Problem der Erlösung und der Einigung des Menschengeschlechts. Wenn die Menschheit zur Solidarität und zum Frieden gelangt ist, ist sogar nicht einmal die gemeinsame Verehrung des einen Gottes notwendig. (Vgl. hierzu H. Cohen, 1929.)
Aber ist es nicht unlogisch, dass man Menschen, die nicht an Gott glauben, verbietet, ihn zu lästern? Weshalb sollte es eine Tugend sein, Gott nicht zu lästern, wenn man nicht an ihn glaubt? Mir scheint, dass dieser naheliegende Einwand die Dinge zu sehr vereinfacht, indem er die Aussagen allzu wörtlich nimmt. Vom Standpunkt der biblischen und nachbiblischen Überlieferung aus besteht kein Zweifel, dass Gott existiert. Wenn jemand Gott lästert, dann greift er das an, was die Gottesvorstellung [VI-115] symbolisiert. Wenn er lediglich Gott nicht anbetet, so kann das vom Standpunkt des Gläubigen aus an seiner Unwissenheit liegen und braucht noch keinen positiven Angriff auf die Gottesvorstellung zu bedeuten. Auch sollten wir nicht vergessen, dass in der jüdischen Tradition die Gotteslästerung die spezielle Bedeutung der Verletzung eines mächtigen Tabus hat. Meiner Ansicht nach läuft die Unterlassung der Lästerung Gottes mit der Unterlassung der Verehrung von Götzen parallel; in beiden Fällen vermeidet der Betreffende einen positiven Irrtum, wenn er nach Meinung des Theisten auch die Wahrheit nicht ganz erfasst.
Wir sahen, dass in der jüdischen Überlieferung die Nachahmung der Handlungsweise Gottes an die Stelle der Kenntnis von Gottes Wesen getreten ist. Es ist noch hinzuzufügen, dass Gott in der Geschichte wirkt und sich in der Geschichte offenbart. Dieser Gedanke hat zwei Konsequenzen: Die eine besteht darin, dass der Glaube an Gott ein Interesse an der Geschichte und – im weitesten Sinn des Wortes – ein politisches Interesse impliziert. Wir erkennen dieses politische Interesse am deutlichsten bei den Propheten. In völligem Gegensatz zu den Meistern des Fernen Ostens denken die Propheten in historischen und politischen Begriffen. „Politisch“ bedeutet hier, dass ihnen historische Ereignisse am Herzen liegen, die nicht nur Israel, sondern alle Völker der Welt betreffen. Es bedeutet ferner, dass die Kriterien, nach denen sie die historischen Ereignisse beurteilen, geistig-religiöser Art sind: Gerechtigkeit und Liebe. Entsprechend diesen Kriterien beurteilen sie die Völker, genau wie sie den Einzelnen an seinen Taten messen.
Wir sahen, dass die Juden aus historischen Gründen dem X, dem die Menschen sich annähern sollten, um ganz Mensch zu sein, den Namen „Gott“ gaben. Sie entwickelten ihren Gedanken bis zu dem Punkt, wo Gott aufhört, mit irgendwelchen positiven Wesensattributen definierbar zu sein, und wo – für den Einzelnen wie für die Völker – die rechte Art zu leben an die Stelle der Theologie tritt. Wenngleich der nächste Schritt in der jüdischen Entwicklung ein System ohne „Gott“ gewesen wäre, so ist es doch für ein theistisch-religiöses System unmöglich, diesen Schritt zu vollziehen, ohne seine Identität zu verlieren. Wer die Gottesvorstellung nicht annehmen kann, findet sich außerhalb des Vorstellungssystems, das die jüdische Religion ausmacht. Trotzdem könnten solche Menschen dem Geist der jüdischen Tradition recht nahestehen, vorausgesetzt, dass sie die Aufgabe „recht zu leben“ zu ihrem höchsten Lebensziel machen, auch wenn das „rechte Leben“ nicht in der Erfüllung der Rituale und vieler spezifisch jüdischer Gebote besteht, sondern in einem Handeln im Geist von Gerechtigkeit und Liebe innerhalb des Rahmens unseres modernen Lebens. Sie werden den Buddhisten nahestehen und jenen Christen, die wie Abbé Pire sagen: „Worauf es heute ankommt, ist nicht der Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen, sondern der zwischen den Menschen mit Herz und denen ohne Herz.“
Bevor wir dieses Kapitel abschließen, müssen wir uns noch mit einer anderen Frage beschäftigen, die schon vielen Lesern gekommen sein mag. Wenn ich die imitatio dei und nicht die Theologie als den wesentlichen Inhalt des jüdischen Religionssystems bezeichne, sage ich dann damit nicht, dass das Judentum im wesentlichen ein ethisches System sei, das vom Menschen verlangt, gerecht, wahrhaftig und mitfühlend zu handeln? Ist dann das Judentum vielleicht eher ein ethisches als ein religiöses System? [VI-116]
Auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Die erste ist im Begriff der Halacha (s. u.) enthalten, welcher besagt, dass der Mensch nicht nur nach den allgemeinen Prinzipien der Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe handeln soll, sondern dass jeder Akt des Lebens dadurch „geheiligt“ sein sollte, dass er von religiösem Geist erfüllt ist. „Rechtes Handeln“ bezieht sich auf alles: auf das Gebet am Morgen, auf die Segenssprüche über dem Essen, auf den Anblick des Meeres und die erste Blume im Jahr, den Armen zu helfen, den Besuch von Kranken und darauf, dass man einen Menschen in Gegenwart anderer nicht beschämt.
Aber selbst diese Auffassung der Halacha könnte man einfach als ein sehr stark erweitertes System einer „ethischen Kultur“ verstehen. Die Frage bleibt offen, ob das Judentum trotz seiner starken Betonung einer globalen Ethik mehr ist als ein ethisches System.
Bevor wir uns mit dem Unterschied zwischen dem ethischen (guten) Menschen und dem religiösen Menschen befassen, bedarf das Problem der Ethik noch einiger Klärung. Es ist wichtig, dass man zwischen einer „autoritären“ und einer „humanistischen“ Ethik, und entsprechend zwischen einem solchen Gewissen, unterscheidet. (Vgl. E. Fromm, Psychoanalyse und Ethik (1947a), GA II, S. 10-14.) – Ein autoritäres Gewissen (Freuds „Über-Ich“) ist die Stimme der internalisierten Autorität, wie etwa der Eltern, des Staates, der Religion. „Internalisiert“ bedeutet, dass der Betreffende sich die Vorschriften und Verbote der Autorität so zu eigen gemacht hat und dass er ihnen so gehorcht, als ob er sich selbst gehorchte; er erlebt diese Stimme als die seines eigenen Gewissens. Diese Art von Gewissen, die man auch als heteronomes Gewissen bezeichnen kann, garantiert, dass man sich darauf verlassen kann, dass der Betreffende stets den Forderungen seines Gewissens entsprechend handeln wird; gefährlich wird das aber, wenn die Autoritäten böse Dinge verlangen. Ein Mensch mit einem „autoritären Gewissen“ hält es für seine Pflicht, sich nach den Befehlen der Autoritäten zu richten, denen er sich unterwirft, ohne nach dem Inhalt dieser Befehle zu fragen; es gibt in der Tat kein Verbrechen, das nicht schon im Namen von Pflicht und Gewissen begangen worden wäre.
Etwas völlig anderes als das autoritäre (heteronome) Gewissen ist das „humanistische“ (autonome) Gewissen. Es ist nicht die internalisierte Stimme einer Autorität, der wir gefallen oder der wir nicht missfallen möchten. Es ist die Stimme unserer totalen Persönlichkeit, in der die Forderungen des Lebens und des Wachstums zum Ausdruck kommen. Für das humanistische Gewissen ist alles „gut“, was dem Leben dient; „böse“ ist alles, was das Leben hemmt und erstickt. Das humanistische Gewissen ist die Stimme unseres Selbst, die uns auf uns selbst zurückruft, damit wir das werden, was wir potenziell sind. (Vgl. E. Fromm, Psychoanalyse und Ethik (1947a), GA II, S. 101-105.) Ein Mensch mit einem im wesentlichen autonomen Gewissen[31] tut das Rechte nicht, indem er sich zwingt, der Stimme der internalisierten Autorität zu gehorchen, sondern weil es ihm Freude macht, das Rechte zu tun, wenngleich es oft einiger Übung bedarf, bis es einem [VI-117] wirklich Freude bereitet, seinen Prinzipien entsprechend zu handeln. Er kommt seiner „Schuld“ nicht nach (von „jemandem etwas schulden“), indem er einer Autorität gehorcht, sondern er fühlt sich „verantwortlich“ (von „antworten“), weil er auf die Welt reagiert, an der er als lebendiges, innerlich aktives menschliches Wesen teilhat.
Wenn wir von der „ethischen“ im Vergleich zur „religiösen“ Einstellung sprechen, spielt es daher eine große Rolle, ob wir von einer in erster Linie autoritären oder von der humanistischen Ethik sprechen. Eine autoritäre Ethik hat stets etwas von Götzendienst an sich. Ich handele nach den Befehlen einer Autorität, die ich verehre, weil ich glaube, dass sie absolut sicher weiß, was recht und was unrecht ist; die autoritäre Ethik ist stets ihrem Wesen nach eine entfremdete Ethik. Sie repräsentiert eine Haltung, die in vieler Hinsicht der eines religiösen Menschen in dem Sinn, wie wir ihn auf den folgenden Seiten beschreiben, widerspricht. Die Haltung der humanistischen Ethik ist nicht entfremdet und ist frei von jedem Götzendienst. Daher steht sie nicht im Widerspruch zur religiösen Einstellung, was allerdings nicht bedeutet, dass überhaupt kein Unterschied zwischen beiden besteht.
Angenommen, die der jüdischen Überlieferung zugrunde liegende Haltung transzendiere den ethischen Bereich, so erhebt sich die Frage, worin ihr spezielles religiöses Element besteht. Es wäre einfach, würde man antworten, dieses Element bestehe im Glauben an Gott als ein übernatürliches höchstes Wesen. Nach dieser Auffassung wäre ein religiöser Mensch einer, der an Gott glaubt und der (infolge seines Glaubens) gleichzeitig ein ethischer Mensch wäre. Eine derartige Definition wirft aber viele Fragen auf. Ist das Religiöse[32] bezüglich seiner Qualität dann nicht ganz und gar auf ein Denkkonzept, nämlich „Gott“ gegründet? Folgt daraus, dass man einen Zen-Buddhisten oder die „Frommen unter den Völkern“ dann nicht als religiös bezeichnen kann?
Hier stehen wir vor einer zentralen Frage. Ist die religiöse Erfahrung notwendigerweise an eine theistische Auffassung gebunden? Ich glaube nicht. Man kann eine „religiöse“ Erfahrung als eine menschliche Erfahrung beschreiben, die gewissen typisch theistischen, wie auch nicht-theistischen, atheistischen oder selbst anti-theistischen Vorstellungen gemeinsam zugrunde liegt. Der Unterschied liegt in der Art, wie diese Erfahrung begrifflich erfasst wird, nicht im Erfahrungssubstrat, welches den unterschiedlichen begrifflichen Formulierungen zugrunde liegt. Diese Art der Erfahrung kommt am klarsten in der christlichen, islamischen und jüdischen Mystik sowie im Zen-Buddhismus zum Ausdruck. Wenn man daher die Erfahrung und nicht seine begriffliche Fassung analysiert, so kann man von einer theistischen ebenso wie von einer nicht-theistischen religiösen Erfahrung sprechen.
Bleibt noch die erkenntnistheoretische Schwierigkeit. Es gibt in den abendländischen Sprachen kein Wort für das Substrat dieser Art religiöser Erfahrung außer im Zusammenhang mit dem Theismus. Daher ist es eine zweideutige Sache, sich des Wortes „religiös“ zu bedienen, und selbst das Wort „spirituell“ ist nicht viel besser, da es [VI-118] ebenfalls einen irreführenden Beiklang hat. Daher ziehe ich es vor, wenigstens in diesem Buch von der X-Erfahrung zu sprechen[33], die sich in religiösen und philosophischen Systemen (zum Beispiel in dem Spinozas) findet, ob sie nun eine Gottesvorstellung enthalten oder nicht.
Eine psychologische Analyse der X-Erfahrung würde weit über den Bereich dieses Buches hinausgehen. Ich möchte jedoch wenigstens kurz auf folgende Hauptgesichtspunkte des Phänomens hinweisen:
- Das erste charakteristische Element ist, dass man das Leben als ein Problem erfährt, als eine „Frage“, die einer Antwort bedarf. Ein Mensch ohne diese X-Erfahrung empfindet keine tiefe oder doch jedenfalls keine bewusste Unruhe über die existenziellen Dichotomien des Lebens. Das Leben als solches ist ihm kein Problem, das Bedürfnis nach einer Lösung quält ihn nicht. Wenigstens bewusst genügt es ihm, den Sinn seines Lebens in seiner Arbeit oder dem Vergnügen oder in Macht oder Ruhm oder auch – wie das beim ethischen Menschen der Fall ist – darin zu finden, dass er seinem Gewissen entsprechend handelt. Für ihn hat das irdische Leben seinen Sinn, und er leidet nicht unter seiner Absonderung von Mensch und Natur und unter dem leidenschaftlichen Wunsch, diese Absonderung zu überwinden und zum Eins-Werden (at-one-ment) zu gelangen.
- Für die X-Erfahrung gibt es eine klar umrissene Hierarchie der Werte. Der höchste Wert ist die optimale Entwicklung der eigenen Kräfte der Vernunft, der Liebe, des Mitgefühls und des Mutes. Alle weltlichen Leistungen sind diesen höchsten humanen (oder spirituellen oder X-)Werten untergeordnet. Diese Hierarchie der Werte erfordert kein Asketentum; sie schließt weltliche Vergnügungen und Freuden nicht aus, sie macht aber den weltlichen Teil des Lebens zu einem Bestandteil des spirituellen Lebens; oder besser gesagt, das weltliche Leben ist von den spirituellen Zielsetzungen durchdrungen.
- Verwandt mit der Hierarchie der Werte ist ein anderer Aspekt der X-Erfahrung. Für den Durchschnittsmenschen ist besonders in einer materialistischen Kultur das Leben ein Mittel zu Zwecken, die außerhalb der Person selbst liegen. Solche Zwecke sind: Lust, Geld, Macht, die Erzeugung und Verteilung von Gebrauchsgütern und so fort. Wenn der Mensch nicht von anderen für deren Zwecke benutzt wird, benutzt er sich selbst für seine eigenen Zwecke; in beiden Fällen wird er ein Mittel zum Zweck. Für den X-Menschen dagegen ist der Mensch ausschließlich Zweck und nie Mittel zum Zweck. Außerdem besteht seine Gesamteinstellung zum Leben darin, dass er auf alles, was geschieht, von dem Standpunkt aus reagiert, ob es dazu beiträgt oder [VI-119] nicht, ihn so zu verwandeln, dass er humaner wird. Ob es sich um Kunst oder Wissenschaft, um Freude oder Kummer, um Arbeit oder Spiel handelt, alles, was geschieht, ist für ihn ein Anreiz, stärker und empfindungsfähiger zu werden. Dieser Prozess der ständigen inneren Umwandlung, bei dem man im Akt des Lebens ein Teil der Welt wird, ist das Ziel, dem alle anderen Ziele untergeordnet sind. Der Mensch ist kein Subjekt, das der Welt gegenübersteht, um diese zu verwandeln; er ist vielmehr in der Welt und nimmt sein In-der-Welt-Sein zum Anlass, sich ständig selbst zu wandeln. Daher ist die Welt (der Mensch und die Natur) kein ihm gegenüberstehendes Objekt, sondern das Medium, in dem er seine eigene Realität und die Realität der Welt immer tiefer entdeckt. Er ist auch kein „Subjekt“, der kleinste unteilbare Teil der menschlichen Substanz (ein Atom, ein Individuum) und nicht einmal Descartes’ stolzes denkendes Subjekt, sondern ein Selbst, das gerade so lebendig und stark ist, dass es aufhört, sich an sich selbst zu klammern, und das ist, indem es reagiert.
- Noch spezieller kann man die X-Einstellung auch folgendermaßen beschreiben: als ein Loslassen des eigenen „Ich“, der eigenen Gier und damit der eigenen Angst, als das Aufgeben des Wunsches, sich an das „Ich“ zu klammern, als ob dieses ein unzerstörbares, separates Gebilde wäre; als ein Leerwerden, um sich mit „Welt“ füllen zu können, um auf sie zu reagieren, mit ihr eins zu werden, sie zu lieben. Leer werden ist kein Ausdruck von Passivität, sondern von Offenheit. Wenn man nicht leer werden kann, wie kann man dann auf die Welt reagieren? Wie kann man sehen, hören, fühlen, lieben, wenn man ganz vom eigenen Ich erfüllt ist, wenn man von Gier angetrieben wird?[34]
- Die X-Erfahrung kann man auch als eine Erfahrung der Transzendenz bezeichnen. Aber hier stehen wir wieder vor dem gleichen Problem wie bei dem Wort „religiös“. Das Wort „Transzendenz“ benutzt man herkömmlicherweise im Sinne von Gottes „Transzendenz“. Als menschliches Phänomen aber bedeutet es, dass man sein Ich transzendiert, dass man das Gefängnis seiner Selbstsucht und Isolierung verlässt. Ob man dieses Transzendieren als auf Gott gerichtet auffasst, ist eine Angelegenheit der begrifflichen Formulierung. Die Erfahrung ist im wesentlichen dieselbe, ob sie sich nun auf Gott bezieht oder nicht.
Die X-Erfahrung, ob theistisch oder nicht, ist durch die Verminderung – und in ihrer vollkommensten Form durch das Verschwinden – des Narzissmus gekennzeichnet. Um offen für die Welt zu werden, um mein Ich zu transzendieren, muss ich fähig sein, meinen Narzissmus zu reduzieren oder ganz aufzugeben. Ich muss außerdem alle Formen der inzestuösen Fixierung und der Gier aufgeben. Ich muss meine Destruktivität und meine nekrophilen Tendenzen überwinden. Ich muss fähig werden, das Leben zu lieben. Außerdem muss ich ein Kriterium besitzen, um zwischen einer falschen X-Erfahrung, die in Hysterie und anderen Formen geistig-seelischer Krankheit wurzelt, und der nicht-pathologischen Erfahrung der Liebe und Vereinigung unterscheiden [VI-120] zu können. Ich muss eine Vorstellung haben von der echten Unabhängigkeit und muss unterscheiden können zwischen einer rationalen und einer irrationalen Autorität, zwischen Idee und Ideologie, zwischen der Bereitschaft, für meine Überzeugungen zu leiden, und Masochismus.[35]
Aus all diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Analyse der X-Erfahrungen sich von der Ebene der Theologie auf die der Psychologie und speziell der Psychoanalyse verschiebt, und dies vor allem deshalb, weil es notwendig wird, zwischen bewusstem Denken und gefühlsmäßiger Erfahrung zu unterscheiden, was in adäquaten Begriffen ausgedrückt werden kann oder auch nicht. Zweitens deshalb, weil die psychoanalytische Theorie die Möglichkeit gibt, diese unbewussten Erfahrungen, die der X-Erfahrung zugrunde liegen oder die ihr andererseits zuwiderlaufen und sie blockieren, zu verstehen. Wenn man die unbewussten Prozesse nicht versteht, ist es schwer, den relativen und oft zufälligen Charakter unseres bewussten Denkens richtig einzuschätzen. Wenn die Psychoanalyse aber die X-Erfahrung verstehen will, muss sie ihr Begriffssystem über das von Freud vorgezeichnete hinaus erweitern. Das zentrale Problem des Menschen ist nicht das seiner Libido; es sind die mit seiner Existenz gegebenen Dichotomien, seine Isolierung, seine Entfremdung, sein Leiden, seine Angst vor der Freiheit, sein Wunsch nach Einheit, seine Fähigkeit zu Hass und Zerstörung, seine Fähigkeit zu Liebe und Vereinigung.
Kurz, wir brauchen eine empirische psychologische Anthropologie, die die X-Erfahrung und die Nicht-X-Erfahrung als menschliche Erlebnisphänomene ohne Rücksicht auf ihre begriffliche Formulierung untersucht. Eine solche Untersuchung könnte zu einem rationalen Nachweis der Überlegenheit der X-Methode über alle anderen Methoden führen, ein Nachweis, den Buddha methodologisch bereits erbracht hat. Es könnte sein, dass, während das Mittelalter sich mit dem Beweis von Gottes Existenz mit philosophischen und logischen Argumenten befasste, die Zukunft sich damit beschäftigen wird, die grundsätzliche Richtigkeit der X-Methode auf der Grundlage einer hochentwickelten Anthropologie darzulegen.
Fassen wir die Hauptgedanken dieses Kapitels noch einmal zusammen: Die Idee des einen Gottes ist eine neue Antwort zur Lösung der Dichotomien der menschlichen Existenz; der Mensch kann zum Einssein mit der Welt nicht dadurch gelangen, dass er zu einem vormenschlichen Zustand regrediert, sondern nur durch die volle Entwicklung seiner spezifisch menschlichen Eigenschaften: der Liebe und der Vernunft. Die Verehrung Gottes ist vor allem die Negation des Götzendienstes. Die Gottesvorstellung hat sich zunächst entsprechend der politischen und gesellschaftlichen Vorstellung von einem Stammeshäuptling oder Stammeskönig herausgebildet. Dann entwickelt sich das Bild eines konstitutionellen Monarchen, der verpflichtet ist, sich dem Menschen gegenüber an seine eigenen Prinzipien zu halten: an die von Liebe und Gerechtigkeit. Er wird zum namenlosen Gott, zu dem Gott, über den man keine [VI-121] Wesensattribute aussagen kann. Dieser Gott ohne Attribute wird „im Schweigen“ verehrt. Er ist kein autoritärer Gott mehr. Der Mensch muss völlig unabhängig werden, und das heißt auch unabhängig von Gott. In der „negativen Theologie“ wie auch in der Mystik finden wir den gleichen revolutionären Geist der Freiheit, der den Gott der Revolution gegen Ägypten kennzeichnet. Ich könnte diesem Geist keinen besseren Ausdruck verleihen als mit den Worten Meister Eckharts:
Dass ich ein Mensch bin,
Habe ich gemeinsam mit allen Menschen.
Dass ich sehe und höre
Und esse und trinke,
Ist mir gemeinsam mit allen Tieren.
Aber dass ich ich bin, ist nur mir eigen
Und gehört mir
Und niemand sonst,
Keinem anderen Menschen,
Noch einem Engel, noch Gott,
Außer dass ich eins bin mit ihm.
(Fragmente)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959120470
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Juni)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychologie Psychoanalyse Religion Gott altes Testament Humanismus Religionskritik Mystik Freiheit Zen-Buddhismus Meister Eckhart