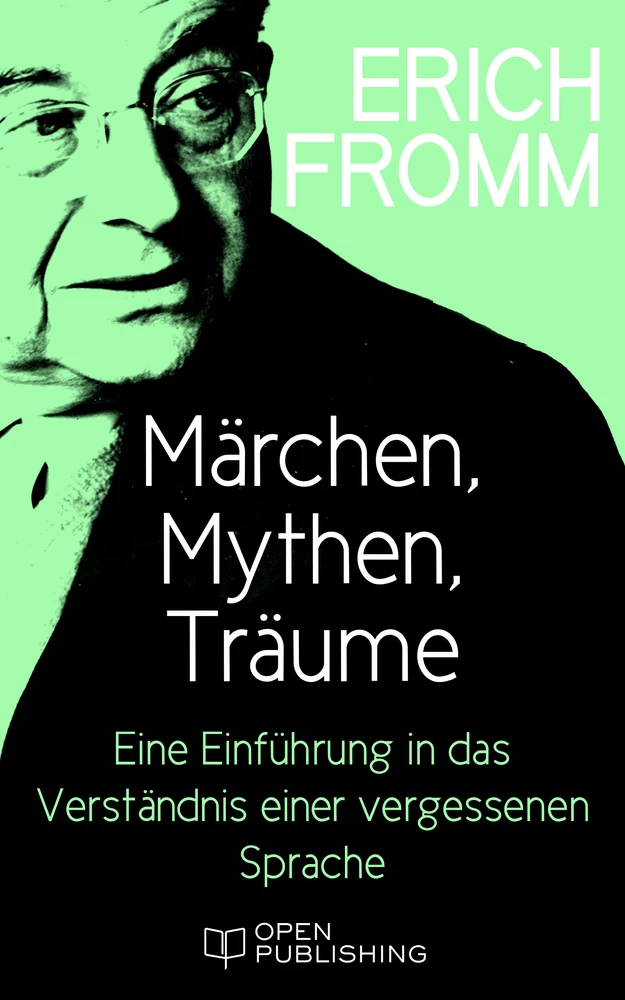Zusammenfassung
Fromm blickt auf die Traum- und Traumdeutungstheorien von Freud und Jung und illustriert die Universalität der Symbolsprache an Beispielen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen: am griechischen Ödipusmythos, an den babylonischen und christlichen Schöpfungsgeschichten, am Märchen "Das Rotkäppchen", am biblischen Sabbatritual und an Franz Kafkas Roman "Der Prozess".
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Märchen, Mythen, Träume. Eine Einführung in das Verständnis einer vergessenen Sprache
- Inhalt
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Das Wesen der symbolischen Sprache
- 3. Das Wesen der Träume
- 4. Der Traum bei Freud und bei Jung
- 5. Die Geschichte der Traumdeutung
- a) Die frühe, nicht-psychologische Traumdeutung
- b) Die psychologische Traumdeutung
- 6. Die Kunst der Traumdeutung
- 7. Die symbolische Sprache in Mythos, Märchen, Ritual und Roman
- a) Der Ödipusmythos
- b) Der Schöpfungsmythos
- c) Rotkäppchen
- d) Das Sabbatritual
- e) Kafkas Roman „Der Prozess“
- Literatur
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Märchen, Mythen, Träume.
Eine Einführung in das Verständnis einer vergessenen Sprache
(The Forgotten Language.
An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths)
Erich Fromm
(1951a)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk
Aus dem Amerikanischen von Liselotte und Ernst Mickel
Erstveröffentlichung unter dem Titel The Forgotten Language. An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths bei Holt, Rinehart and Winston, New York 1951; eine erste deutsche Übersetzung, angefertigt von Ernst Bucher, wurde 1957 vom Diana Verlag, Zürich, unter dem Titel Märchen, Mythen, Träume. Eine Einführung zum Verständnis von Träumen, Märchen und Mythen herausgebracht. Für die Veröffentlichung in der zehnbändigen Erich Fromm-Gesamtausgabe 1980 wurde der Untertitel dem englischen Original angepasst; außerdem fertigten Liselotte und Ernst Mickel eine neue Übersetzung an, die auch in die Einzelpublikation bei der Deutsche Verlags-Anstalt (Stuttgart 1980) sowie in die zwölfbändige Erich Fromm-Gesamtausgabe (München 1999) Eingang fand.
Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, Band IX, S. 169-309.
Die Zahlen in [eckigen Klammern] geben die Seitenwechsel in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder.
Copyright © 1951 by Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
Inhalt
-
Märchen, Mythen, Träume. Eine Einführung in das Verständnis einer vergessenen Sprache
- Inhalt
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Das Wesen der symbolischen Sprache
- 3. Das Wesen der Träume
- 4. Der Traum bei Freud und bei Jung
- 5. Die Geschichte der Traumdeutung
- 6. Die Kunst der Traumdeutung
- 7. Die symbolische Sprache in Mythos, Märchen, Ritual und Roman
- Literatur
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Ein ungedeuteter Traum gleicht einem ungelesenen Brief.
Talmud, Berachot 55a
Der Schlaf entkleidet uns des Kostüms der äußeren Umstände.
Er wappnet uns mit einer schrecklichen Freiheit,
sodass jeder Wille sofort in die Tat umgesetzt wird.
Ein darin geübter Mensch liest seine Träume,
um sich selbst kennenzulernen;
jedoch nicht die Einzelheiten, sondern die Qualität.
Emerson
Vorwort
Diesem Buch[1] liegen Vorlesungen zugrunde, die ich bei Einführungskursen für graduierte Studenten gehalten habe, welche zur weiteren Ausbildung das William Alanson White Institute of Psychiatry besuchten sowie vor nichtgraduierten Studenten im Bennington College. Es richtet sich an einen ähnlichen Leserkreis, an Studenten der Psychiatrie und Psychologie sowie an interessierte Laien. Wie aus dem Untertitel hervorgeht, handelt es sich um eine Einführung in das Verständnis der symbolischen Sprache. Aus diesem Grund beschäftigt es sich auch nicht mit vielen der verwickelteren Probleme auf diesem Gebiet. Ich gehe beispielsweise auf Freuds Theorie nur im Hinblick auf seine „Traumdeutung“ ein und lasse die schwierigen Probleme, die er in seinen späteren Schriften entwickelte, unberücksichtigt. Ich setze mich auch nicht mit jenen Aspekten der Symbolsprache auseinander, die zwar zum vollen Verständnis der einschlägigen Probleme dazugehörten, die aber die allgemeine Information voraussetzen, welche diese Seiten zu vermitteln versuchen. All diesen weitergehenden Fragen möchte ich in einer späteren Veröffentlichung nachgehen.[2]
Ich spreche im Titel ausdrücklich von einer Einführung in das Verständnis einer vergessenen Sprache und nicht, wie sonst üblich, von ihrer Deutung. Wenn – wie ich auf den folgenden Seiten zu zeigen versuche – die symbolische Sprache eine eigenständige Sprache ist, wenn sie tatsächlich die einzige universale Sprache ist, die die Menschheit jemals entwickelt hat, so geht es darum, sie zu verstehen, und nicht darum, sie zu deuten, so als ob man es mit einem künstlich hergestellten Geheimcode zu tun hätte. Nicht nur für den Psychotherapeuten, der seelische Störungen zu beheben versucht, sondern für jeden, der mit sich selbst in Berührung kommen möchte, ist es wichtig, diese Symbolsprache verstehen zu können. Deshalb sollte auf unseren höheren Schulen und auf den Universitäten ebenso wie der Unterricht in anderen „Fremdsprachen“, so auch der Unterricht in der Symbolsprache in den Lehrplan aufgenommen werden. Dieses Buch möchte zur Verwirklichung dieses Zieles einen Beitrag leisten.
Mein Dank gilt Dr. Edward S. Tauber, der das Manuskript gelesen hat und mir mit seiner konstruktiven Kritik und seinen Anregungen eine große Hilfe war.[3]
Erich Fromm, 1951.
1. Einleitung
Wenn es stimmt, dass die Fähigkeit zu staunen der Anfang aller Weisheit ist, dann wirft das ein trauriges Licht auf die Weisheit des heutigen Menschen. Wir mögen über eine noch so hohe literarische und allgemeine Bildung verfügen, die Gabe, über etwas staunen zu können, haben wir verloren. Alles wird als bekannt vorausgesetzt, und wenn wir selbst nicht darüber Bescheid wissen, so gibt es irgendeinen Spezialisten, dessen Aufgabe es ist, das zu wissen, was wir selbst nicht wissen. Sich über etwas zu wundern, ist geradezu peinlich und gilt als Zeichen dafür, dass man geistig nicht auf der Höhe ist. Sogar unsere Kinder sind nur selten von etwas überrascht, oder sie versuchen es sich wenigstens nicht anmerken zu lassen. Mit zunehmendem Alter verlieren wir dann immer mehr die Fähigkeit, uns noch über etwas zu wundern. Uns kommt es darauf an, immer die richtige Antwort bereit zu haben; dass man die richtigen Fragen zu stellen weiß, gilt vergleichsweise als weit weniger wichtig.
Diese Einstellung könnte einer der Gründe dafür sein, dass eine der erstaunlichsten Erscheinungen in unserem Leben, nämlich unsere Träume, uns so wenig Anlass zum Staunen und Fragen geben. Wir alle träumen; wir verstehen unsere Träume nicht und verhalten uns doch so, als ob im Schlaf nicht etwas Seltsames in uns vorginge, seltsam wenigstens verglichen mit unserem logischen, zweckorientierten Denken im wachen Zustand.
Wenn wir wach sind, sind wir aktive, vernünftige Wesen, eifrig darauf bedacht, das zu bekommen, was wir haben möchten, und bereit, uns gegen Angriffe zu wehren. Wir handeln und beobachten; wir sehen die Dinge um uns herum vielleicht nicht so, wie sie wirklich sind, aber doch wenigstens so, dass wir sie nutzen und handhaben können. Freilich besitzen wir nicht viel Vorstellungsvermögen – und sofern wir keine Kinder oder Dichter sind, beschränkt sich dieses meist darauf, die Geschichte und Pläne unserer alltäglichen Erlebnisse zu wiederholen. Wir sind tüchtig, doch dabei phantasiearm. Wir bezeichnen das, was wir tagsüber beobachten, als „die Wirklichkeit“ und sind stolz auf unseren „Realismus“, der uns in die Lage versetzt, sie so geschickt zu handhaben.
Wenn wir schlafen, erwachen wir zu einer anderen Daseinsform. Wir träumen. Wir erfinden Geschichten, die sich nie ereignet haben und für die es im wirklichen Leben [IX-173] manchmal keine Entsprechung gibt. Manchmal sind wir der Held, manchmal der Bösewicht; manchmal erleben wir die herrlichsten Dinge und sind glücklich; oft werden wir in höchsten Schrecken versetzt. Doch welche Rolle wir auch immer im Traum spielen, wir sind der Autor, es ist unser Traum, wir haben die Handlung erfunden.
Die meisten unserer Träume haben ein Merkmal gemeinsam: Sie richten sich nicht nach den Gesetzen der Logik, die unser waches Denken beherrschen. Die Kategorien von Raum und Zeit werden außer Acht gelassen. Verstorbene sehen wir lebendig; viele Jahre zurückliegende Ereignisse erleben wir als gegenwärtig. Wir träumen von zwei Ereignissen, als ob sie sich gleichzeitig abspielten, während das in Wirklichkeit völlig unmöglich wäre. Ebenso wenig kümmern wir uns um die Gesetze des Raumes. Es fällt uns keineswegs schwer, uns im Nu an einen fernen Ort zu begeben, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, zwei Personen in eine zu verschmelzen oder eine Person plötzlich in eine andere zu verwandeln. Im Traum sind wir tatsächlich Schöpfer einer Welt, in der Zeit und Raum, die allen Betätigungen unseres Körpers Grenzen setzen, keine Macht besitzen.
Merkwürdig an unseren Träumen ist auch, dass wir uns an Begebenheiten und an Personen erinnern, an die wir jahrelang nicht mehr gedacht haben und die uns im wachen Zustand niemals mehr eingefallen wären. Im Traum tauchen sie plötzlich als gute Bekannte auf, an die wir oft gedacht haben. Es ist, als ob wir im Schlaf das große Reservoir von Erfahrungen und Erinnerungen anzapften, von dessen Existenz wir tagsüber nichts wissen.
Aber trotz all dieser merkwürdigen Eigenschaften sind unsere Träume – solange wir träumen – für uns ebenso wirklich wie nur irgendein Erlebnis unseres wachen Lebens. Im Traum gibt es kein „als ob“. Der Traum ist gegenwärtiges, reales Erleben, und das so sehr, dass er uns zwei Fragen nahelegt: Was ist Wirklichkeit? Woher wissen wir, dass das, was wir träumen, unwirklich und das, was wir wachend erleben, wirklich ist? Ein chinesischer Dichter hat das treffend ausgedrückt: „Ich habe letzte Nacht geträumt, ich sei ein Schmetterling, und jetzt weiß ich nicht, ob ich ein Mensch bin, der träumt, er sei ein Schmetterling, oder ob ich vielleicht ein Schmetterling bin, der jetzt träumt, er sei ein Mensch.“
All diese erregenden, lebhaften nächtlichen Erlebnisse verschwinden nicht nur, wenn wir aufwachen, es fällt uns sogar außerordentlich schwer, uns daran zu erinnern. Die meisten vergessen wir so gründlich, dass wir uns nicht einmal mehr daran erinnern, in dieser anderen Welt gelebt zu haben. An manche Träume erinnern wir uns im Augenblick des Erwachens noch undeutlich, und im nächsten Augenblick schon können wir sie uns nicht mehr ins Gedächtnis zurückrufen. An einige wenige erinnern wir uns tatsächlich, und diese Träume meinen wir, wenn wir sagen: „Ich habe einen Traum gehabt.“ Es ist, als ob wohlwollende oder böse Geister uns besucht hätten und bei Tagesanbruch plötzlich verschwunden wären; wir können uns kaum noch daran erinnern, dass sie da waren und wie intensiv wir uns mit ihnen beschäftigt haben.
Vielleicht noch erstaunlicher als alles bisher Erwähnte ist die Ähnlichkeit der Erzeugnisse unserer Kreativität im Schlaf mit den ältesten Schöpfungen der Menschheit – den Mythen. Allerdings machen uns die Mythen heute kein allzu großes Kopfzerbrechen mehr. Wenn sie dadurch, dass sie in unsere Religion eingingen, respektabel [IX-174] geworden sind, zollen wir ihnen eine konventionelle, oberflächliche Anerkennung als Teil einer ehrwürdigen Tradition. Besitzen sie diese traditionelle Autorität nicht, so sehen wir in ihnen kindliche Ausdrucksformen der Ideen von noch nicht durch die Wissenschaft aufgeklärten Menschen. Jedenfalls gehören die Mythen – ob ignoriert, verachtet oder respektiert – einer Welt an, die unserem heutigen Denken völlig fremd ist. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass viele unserer Träume sowohl ihrem Stil als auch ihrem Inhalt nach den Mythen ähnlich sind, und wenn sie uns auch beim Erwachen seltsam und weit hergeholt vorkommen, so besitzen wir doch im Schlaf die Fähigkeit, diese mythenähnlichen Schöpfungen hervorzubringen.
Auch im Mythos gibt es dramatische Begebenheiten, die in einer von den Gesetzen von Zeit und Raum beherrschten Welt unmöglich wären: Der Held verlässt Vaterhaus und Vaterland, um die Welt zu erretten, oder er flieht vor seinem Auftrag und lebt im Bauch eines großen Fisches; er stirbt und wird wiedergeboren; der mythische Vogel verbrennt und steigt aus der Asche wieder hervor – schöner als zuvor.
Natürlich haben die verschiedenen Völker unterschiedliche Mythen geschaffen, wie ja auch verschiedene Menschen unterschiedliche Träume träumen. Aber trotz all dieser Unterschiede haben alle Mythen und Träume eines gemeinsam: Alle sind in der gleichen Sprache – der symbolischen Sprache – geschrieben. Die Mythen der Babylonier, Inder, Ägypter, Hebräer und Griechen sind in der gleichen Sprache geschrieben wie die der Aschantis und Irokesen. Die Träume eines heutigen Einwohners von New York oder Paris sind die gleichen wie die, welche von Menschen berichtet werden, die vor ein paar tausend Jahren in Athen oder Jerusalem lebten. Die Träume antiker und moderner Menschen sind in der gleichen Sprache geschrieben wie die Mythen, deren Urheber zu Beginn der Geschichte lebten.
Die Symbolsprache ist eine Sprache, in der innere Erfahrungen, Gefühle und Gedanken so ausgedrückt werden, als ob es sich um sinnliche Wahrnehmungen, um Ereignisse in der Außenwelt handelte. Es ist eine Sprache, die eine andere Logik hat als unsere Alltagssprache, die wir tagsüber sprechen. Die Symbolsprache hat eine Logik, in der nicht Zeit und Raum die dominierenden Kategorien sind, sondern Intensität und Assoziation. Es ist die einzige universale Sprache, welche die Menschheit je entwickelt hat und die für alle Kulturen im Verlauf der Geschichte die gleiche ist. Es ist eine Sprache sozusagen mit eigener Grammatik und Syntax, eine Sprache, die man verstehen muss, wenn man die Bedeutung von Mythen, Märchen und Träumen verstehen will.
Aber der moderne Mensch hat diese Sprache vergessen, nicht wenn er schläft, aber wenn er wach ist. Ist es wichtig für uns, dass wir diese Sprache auch im wachen Zustand verstehen?
Für die Menschen vergangener Zeiten, die in den großen Kulturen des Ostens und Westens lebten, gab es keinen Zweifel, wie die Frage zu beantworten ist. Für sie gehörten Mythen und Träume zu den bedeutungsvollsten Ausdrucksformen des Geistes, und sie nicht zu verstehen, wäre gleichbedeutend gewesen mit Analphabetentum. Erst in den letzten Jahrhunderten hat sich in der westlichen Kultur diese Einstellung geändert. Man hielt jetzt die Mythen bestenfalls für naive Erzeugnisse des vorwissenschaftlichen Denkens, die erfunden wurden, lange bevor der Mensch [IX-175] seine großen Entdeckungen über die Natur gemacht und sie einigermaßen zu beherrschen gelernt hatte.
Die Träume kamen im Urteil der modernen Aufklärung noch schlechter weg. Man hielt sie für schlechthin sinnlos und der Beachtung erwachsener Menschen nicht wert, die eifrig mit so wichtigen Dingen wie der Herstellung von Maschinen beschäftigt waren und sich für „Realisten“ hielten, weil sie nichts weiter sahen als die Realität von Dingen, die man erobern und gebrauchen konnte – Realisten, die für jedes Automodell eine spezielle Bezeichnung, aber für die Liebe mit ihren höchst verschiedenartigen Gefühlserlebnissen nur ein einziges Wort besitzen.
Es kommt hinzu, dass wir unseren Träumen vielleicht wohlwollender gegenüberstünden, wenn es sich bei allen um angenehme Phantasien handelte, in denen unsere Herzenswünsche erfüllt werden. Aber viele hinterlassen eine beklommene Stimmung; oft sind es Albträume, und wir sind beim Erwachen dankbar, nur geträumt zu haben. Andere Träume wieder sind zwar keine Albträume, doch beunruhigen sie uns aus anderen Gründen. Sie passen nicht recht zu der Person, für die wir uns tagsüber halten. Wir träumen, wie wir Menschen hassen, die wir zu schätzen glauben, und lieben jemanden, an dem wir kein Interesse zu haben meinen. Wir träumen von unserem Ehrgeiz, wo wir doch von unserer Bescheidenheit so fest überzeugt sind. Wir träumen, wir seien unterwürfig und ordneten uns anderen unter, wo wir doch auf unsere Unabhängigkeit so stolz sind. Aber das Allerschlimmste ist, dass wir unsere Träume nicht verstehen, obwohl wir als wache Menschen überzeugt sind, alles begreifen zu können, wenn wir uns nur damit beschäftigen. Statt dass wir uns mit einem so überwältigenden Beweis der Begrenztheit unseres Verstandes abfinden, werfen wir lieber den Träumen vor, sie seien sinnlos.
In den letzten Jahrzehnten ist es zu einer tiefgreifenden Änderung dieser Einstellung zu den Mythen und Träumen gekommen. Dieser Wandel wurde hauptsächlich durch die Arbeiten von Freud in die Wege geleitet. Nachdem dieser zunächst nur versucht hatte, neurotischen Patienten zu helfen, die Gründe für ihre Erkrankung zu verstehen, erkannte er den Traum als ein universales menschliches Phänomen, das auf gleiche Weise bei kranken wie bei gesunden Menschen zu finden ist. Er fand, dass Träume sich im wesentlichen nicht von Mythen und Märchen unterscheiden und dass man – versteht man einmal die Sprache der Träume – auch die der Mythen und Märchen verstehen kann. Die Arbeit der Anthropologen lenkte die Aufmerksamkeit erneut auf die Mythen. Man sammelte und erforschte sie, und einigen auf diesem Gebiet bahnbrechenden Gelehrten gelang es mit ihrer Hilfe, wie vor ihnen J. J. Bachofen, ein neues Licht auf die Vorgeschichte der Menschheit zu werfen.
Aber noch immer steckt die Erforschung der Mythen und Träume in den Kinderschuhen. Verschiedenes steht ihr im Wege: Einmal ist es ein gewisser Dogmatismus und eine gewisse Sturheit verschiedener psychoanalytischer Schulen, die sämtlich behaupten, sie allein verständen die symbolische Sprache richtig. So verlieren wir den Blick für die Vielseitigkeit der Symbolsprache und versuchen, sie in das Prokrustesbett einer einzigen Bedeutung zu zwängen.
Ein weiteres Hindernis ist die immer noch verbreitete Meinung, die Traumdeutung sei nur legitim, wenn der Psychiater sie bei der Behandlung neurotischer Patienten [IX-176] anwende. Ich halte im Gegenteil die Symbolsprache für die einzige Fremdsprache, die jeder von uns lernen sollte. Wenn wir sie verstehen, kommen wir mit dem Mythos in Berührung, der eine der bedeutsamsten Quellen der Weisheit ist, wir lernen die tieferen Schichten unserer eigenen Persönlichkeit kennen. Tatsächlich verhilft sie uns zum Verständnis einer Erfahrungsebene, die deshalb spezifisch menschlich ist, weil sie nach Inhalt und Stil der ganzen Menschheit gemeinsam ist.
Der Talmud (Berachot 55a) sagt: „Ein ungedeuteter Traum gleicht einem ungelesenen Brief.“ Tatsächlich sind sowohl Träume wie Mythen wichtige Mitteilungen von uns selbst an uns selbst. Wenn wir diese Sprache nicht verstehen, verlieren wir einen großen Teil von dem, was wir in den Stunden wissen und uns sagen, in denen wir nicht damit beschäftigt sind, die Außenwelt zu beherrschen.
2. Das Wesen der symbolischen Sprache
Nehmen wir einmal an, wir wollten jemandem den Unterschied im Geschmack von weißem und rotem Wein klarmachen. Das dürfte uns recht einfach vorkommen. Wir kennen ja den Unterschied sehr gut, weshalb sollte es uns dann schwerfallen, ihn einem anderen zu beschreiben? Dennoch dürfte es uns die größten Schwierigkeiten machen, den Geschmacksunterschied in Worte zu fassen. Schließlich werden wir vermutlich der Sache ein Ende bereiten, indem wir sagen: „Ach was, ich kann dir das nicht erklären. Trink einfach erst ein Glas Rotwein und dann ein Glas Weißwein, dann wirst du den Unterschied schon merken.“ Es fällt uns nicht schwer, jemandem die komplizierteste Maschine zu erklären, aber zur Beschreibung einer einfachen Geschmacksempfindung fehlen uns offenbar die Worte.
Sehen wir uns nicht der gleichen Schwierigkeit gegenüber, wenn wir ein Gefühlserlebnis zu beschreiben versuchen? Nehmen wir eine Stimmung, in der man sich verloren und im Stich gelassen fühlt, in der die Welt grau in grau scheint, in der sie uns beängstigend, wenn auch nicht gerade bedrohlich vorkommt. Man möchte einem Freund diese Stimmung beschreiben, aber auch da sucht man vergebens nach Worten und hat schließlich das Gefühl, nichts von dem, was man sagte, gebe die vielfältigen Stimmungsnuancen richtig wieder. In der folgenden Nacht hat man dann einen Traum. Man sieht sich kurz vor Tagesanbruch in den Außenbezirken einer Stadt; die Straßen sind noch leer, nur ein Milchwagen ist zu sehen, die Häuser machen einen armseligen Eindruck, die Gegend kommt uns fremd vor, wir vermissen die üblichen Verkehrsmittel, die uns wieder in vertraute Bezirke bringen könnten, wo wir uns zu Hause fühlen. Wachen wir dann auf und erinnern uns an den Traum, dann fällt uns ein, dass das Gefühl, das wir im Traum hatten, genau das graue, trostlose Gefühl war, das wir tags zuvor unserem Freund vergeblich zu beschreiben versuchten. Es ist nur ein Bild, zu dessen Wahrnehmung wir kaum eine Sekunde brauchten, und trotzdem ist dieses Bild eine lebendigere und genauere Beschreibung, als jene, die wir hätten geben können, wenn wir lang und breit darüber gesprochen hätten. Das im Traum wahrgenommene Bild ist ein Symbol für etwas, das wir fühlten.
Was ist ein Symbol? Ein Symbol wird oft definiert als „ etwas, das stellvertretend für etwas anderes steht“. Diese Definition kommt uns ziemlich nichtssagend vor. Sie wird [IX-178] jedoch interessanter, wenn wir uns mit jenen Symbolen befassen, die Sinneswahrnehmungen – etwa Sehen, Hören, Riechen und Berühren – betreffen und die stellvertretend für etwas „anderes“ stehen, das eine innere Erfahrung, ein Gefühl oder ein Gedanke ist. Ein Symbol dieser Art ist etwas außerhalb von uns selbst; was es symbolisiert, ist etwas in uns. Die Symbolsprache ist die Sprache, in der wir innere Erfahrungen so zum Ausdruck bringen, als ob es sich dabei um Sinneswahrnehmungen handelte, um etwas, was wir tun, oder um etwas, was uns in der Welt der Dinge widerfährt. Die Symbolsprache ist eine Sprache, in der die Außenwelt ein Symbol der Innenwelt, ein Symbol unserer Seele und unseres Geistes ist.
Wenn wir ein Symbol definieren als „etwas, das stellvertretend für etwas anderes steht“, dann lautet die entscheidende Frage: „Welcher besondere Zusammenhang besteht zwischen dem Symbol und dem, was es symbolisiert?“
Wenn wir diese Frage beantworten wollen, müssen wir zwischen drei Arten von Symbolen unterscheiden: dem konventionellen, dem zufälligen und dem universalen Symbol. Wie sich sogleich herausstellen wird, drücken nur die beiden letzteren Arten von Symbolen innere Erfahrungen so aus, als ob es sich um Sinneswahrnehmungen handelte, und nur sie weisen die Merkmale der Symbolsprache auf.
Das konventionelle Symbol ist uns von den drei Arten das geläufigste, da wir es in unserer Alltagssprache gebrauchen. Wenn wir das Wort „Tisch“ geschrieben sehen oder wenn wir das Lautgebilde „Tisch“ hören, dann stehen die Buchstaben T-I-S-C-H stellvertretend für etwas anderes, nämlich für den Gegenstand Tisch, den wir sehen, berühren und benutzen. Welcher Zusammenhang besteht nun zwischen dem Wort „Tisch“ und dem Gegenstand „Tisch“? Besteht eine innere Beziehung zwischen ihnen? Offensichtlich ist dies nicht der Fall. Der Gegenstand Tisch hat mit dem Lautgebilde Tisch nichts zu tun, und der einzige Grund, weshalb das Wort den Gegenstand symbolisiert, ist die Übereinkunft, diesen besonderen Gegenstand mit diesem besonderen Namen zu bezeichnen. Wir lernen diesen Zusammenhang als Kinder dadurch, dass wir das Wort immer wieder im Zusammenhang mit dem Gegenstand hören, sodass schließlich eine bleibende Assoziation entsteht und wir nicht erst nachzudenken brauchen, um die richtige Bezeichnung zu finden.
Es gibt jedoch gewisse Wörter, bei denen die Assoziation nicht nur konventioneller Art ist. Wenn wir zum Beispiel „Pfui“ sagen, vollführen wir mit unseren Lippen eine Bewegung, die bewirkt, dass wir die Luft rasch ausstoßen. Es ist dies ein Ausdruck des Abscheus, an dem unser Mund sich beteiligt. Durch dieses schnelle Ausstoßen von Luft drücken wir unsere Absicht nachahmend aus, etwas von uns zu stoßen, es aus unserem Körper zu entfernen. In diesem Fall – wie in einigen anderen Fällen – steht das Symbol in einem inneren Zusammenhang mit dem Gefühl, das es symbolisiert. Aber selbst wenn wir annehmen, dass ursprünglich viele – oder sogar alle Wörter – ihren Ursprung in einem solchen inneren Zusammenhang zwischen dem Symbol und dem Symbolisierten haben, so besitzen doch die meisten Wörter für uns heute diese Bedeutung nicht mehr, wenn wir eine Sprache lernen.
Wörter sind nicht die einzigen Beispiele für konventionelle Symbole, wenn sie auch die häufigsten und die uns geläufigsten sind. Auch Bilder können konventionelle Symbole sein. Eine Flagge kann zum Beispiel ein bestimmtes Land symbolisieren, [IX-179] obwohl zwischen ihren Farben und dem Land, das sie repräsentieren, kein Zusammenhang besteht. Sie wurden als Wahrzeichen des betreffenden Landes akzeptiert, und wir übersetzen den visuellen Eindruck der Flagge in unsere Vorstellung von dem betreffenden Land – auch dies wiederum aus konventionellen Gründen. Gewisse bildhafte Symbole sind nicht ausschließlich konventionell, wie zum Beispiel das Kreuz. Das Kreuz kann ein rein konventionelles Symbol der christlichen Kirche sein und unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von der Flagge. Aber die besondere Bedeutung des Kreuzes, die sich auf Jesu Tod oder noch darüber hinaus auf die gegenseitige Durchdringung der materiellen und der geistigen Ebene bezieht, hebt die Beziehung zwischen diesem Symbol und dem, was es symbolisiert, auf eine höhere Ebene als die der nur konventionellen Symbole.
Das genaue Gegenteil des konventionellen Symbols ist das zufällige Symbol. Allerdings haben beide eines miteinander gemeinsam, dass nämlich zwischen dem Symbol und dem, was es symbolisiert, keine innere Beziehung besteht.[4] Nehmen wir beispielsweise an, jemand habe in einer bestimmten Stadt ein betrübliches Erlebnis gehabt. Hört er dann den Namen dieser Stadt, so wird er ihn leicht mit einer niedergedrückten Stimmung in Verbindung bringen, genauso wie er ihn mit einer fröhlichen Stimmung in Zusammenhang brächte, falls er dort ein glückliches Erlebnis gehabt hätte. Natürlich hat die Stadt an sich nichts Trauriges oder Fröhliches an sich. Es ist das mit ihr verbundene persönliche Erlebnis, das sie zu einem Symbol dieser Stimmung macht. Zur gleichen Reaktion kann es in Verbindung mit einem bestimmten Haus, einer Straße, einem Kleid, einer gewissen Szenerie oder irgendetwas sonst kommen, was irgendwann einmal mit einer spezifischen Stimmung in Zusammenhang gestanden hat.
Wir könnten zum Beispiel träumen, wir befänden uns in einer bestimmten Stadt. Möglicherweise ist im Traum keine bestimmte Stimmung mit ihr verbunden; wir sehen nur eine Straße oder auch nur einfach den Namen der Stadt. Wir fragen uns, weshalb uns im Schlaf ausgerechnet diese Stadt eingefallen ist, und entdecken vielleicht, dass wir in einer Stimmung eingeschlafen sind, die der ähnlich war, welche diese Stadt für uns symbolisiert. Das Bild im Traum repräsentiert diese Stimmung, die Stadt „steht stellvertretend“ für die einst in ihr erlebte Stimmung. Hier ist der Zusammenhang zwischen dem Symbol und dem symbolisierten Erlebnis rein zufällig.
Im Gegensatz zum konventionellen Symbol kann am zufälligen Symbol kein anderer teilhaben, es sei denn, wir erzählten ihm unsere mit dem Symbol zusammenhängenden Erlebnisse. Aus diesem Grund kommen zufällige Symbole nur selten in Mythen, Märchen oder in Kunstwerken vor, die in einer symbolischen Sprache abgefasst sind, denn sie sind nicht mitteilbar, außer wenn der Verfasser jedem von ihm benutzten Symbol einen entsprechenden Kommentar beifügt. In Träumen dagegen kommen zufällige Symbole häufig vor. Ich werde an späterer Stelle in diesem Buch noch auf die Methode zu sprechen kommen, wie man sie verstehen lernen kann.
Beim universalen Symbol dagegen besteht eine innere Beziehung zwischen dem Symbol und dem, was es repräsentiert. Wir haben bereits als Beispiel den Traum in den Außenbezirken der Stadt angeführt. Das sinnliche Erlebnis einer verlassenen, fremden, armseligen Gegend besitzt tatsächlich eine deutliche Verwandtschaft mit [IX-180] einer trostlosen, angstvollen Stimmung. Wenn wir niemals in den Außenbezirken einer Stadt gewesen wären, kämen wir natürlich nie auf dieses Symbol, so wie ja auch das Wort „Tisch“ für uns sinnlos wäre, wenn wir nie einen Tisch gesehen hätten. Außenbezirke einer Stadt können nur für Stadtbewohner einen Symbolwert haben, nicht aber für Menschen, die in einer Kultur ohne große Städte leben. Viele andere universale Symbole sind in der Erfahrung eines jeden Menschen verwurzelt. Nehmen wir zum Beispiel das Symbol des Feuers. Wir sind von bestimmten Eigenschaften des Feuers im Kamin fasziniert, vor allem von seiner Lebendigkeit. Es verändert und bewegt sich die ganze Zeit und besitzt doch eine gewisse Beständigkeit. Es bleibt das Gleiche, ohne gleich zu bleiben. Es macht den Eindruck von Kraft, von Energie, von Anmut und Leichtigkeit. Es ist, als ob es tanzte und eine unerschöpfliche Energiequelle besäße. Wenn wir uns des Feuers als eines Symbols bedienen, dann beschreiben wir innere Erlebnisse, die durch die gleichen Elemente gekennzeichnet sind, die wir beim Anblick des Feuers sinnlich wahrnehmen: Wir haben ein Gefühl von Kraft, Leichtigkeit, Bewegung, Anmut und Fröhlichkeit – wobei in unserem Gefühl einmal das eine, einmal das andere dieser Elemente dominiert.[5]
In gewisser Hinsicht ähnlich und doch auch wieder anders ist das Symbol des Wassers – des Meeres oder eines Flusses. Auch hier finden wir die Mischung von ständiger Bewegung und gleichzeitiger Beständigkeit. Auch hier empfinden wir das Lebendige, die Kontinuität, die Energie. Aber ein Unterschied ist vorhanden: Während das Feuer etwas Abenteuerliches, Behendes, Aufregendes an sich hat, ist das Wasser ruhig, langsam und stetig. Dem Feuer ist ein Element der Überraschung eigen, während das Wasser etwas Voraussagbares an sich hat. Das Wasser symbolisiert ebenfalls eine lebhafte Stimmung, doch ist sie „schwerer“, „gemächlicher“ und eher beruhigend als aufregend.
Dass eine Erscheinung aus der physikalischen Welt ein inneres Erlebnis adäquat ausdrücken kann, dass die Welt der Dinge ein Symbol für die Welt der Seele sein kann, ist nicht weiter verwunderlich. Wir alle wissen, dass unsere Seele sich in unserem Körper ausdrückt. Das Blut steigt uns zu Kopf, wenn wir wütend sind, und es entweicht aus dem Kopf, wenn wir Angst haben; unser Herz schlägt schneller, wenn wir uns ärgern, und unser gesamter Körper hat einen anderen Tonus, wenn wir glücklich sind, als wenn wir traurig sind. Unsere Stimmung kommt in unserem Gesichtsausdruck, und unsere Einstellung und unsere Gefühle kommen in unseren Bewegungen und Gesten so genau zum Ausdruck, dass andere sie deutlicher aus unserem Benehmen als aus unseren Worten ablesen. Der Körper ist in der Tat ein Symbol – und keine Allegorie – der Seele. Ein tiefes, echtes Gefühl, ja sogar ein echt empfundener Gedanke findet seinen Ausdruck in unserem gesamten Organismus. Beim universalen Symbol treffen wir auf den gleichen Zusammenhang zwischen seelischen und körperlichen Erlebnissen. Gewisse körperliche Erscheinungen deuten durch ihre ganze Art auf gewisse emotionale und seelische Erlebnisse hin, und wir drücken unsere emotionalen Erfahrungen in der Sprache körperlicher Erlebnisse, d.h. symbolisch, aus.
Das universale Symbol ist das einzige, bei dem die Beziehung zwischen dem Symbol und dem, was es symbolisiert, nicht zufällig, sondern ihm immanent ist. Es wurzelt in der Erfahrung von der inneren Beziehung zwischen Emotion oder Gedanke [IX-181] einerseits und der sinnlichen Erfahrung andererseits. Man kann es deshalb als universal bezeichnen, weil es allen Menschen gemeinsam ist, und dies nicht nur im Gegensatz zu dem rein zufälligen Symbol, das seiner Natur nach rein persönlich ist, sondern auch im Gegensatz zum konventionellen Symbol, das sich auf eine Gruppe von Menschen beschränkt, die die gleiche Übereinkunft getroffen haben. Das universale Symbol ist in den Eigenschaften unseres Körpers, unserer Sinne und unseres Geistes verwurzelt, die allen Menschen gemeinsam und daher nicht auf einzelne Individuen oder spezifische Gruppen beschränkt sind. Tatsächlich ist das universale Symbol die einzige von der ganzen Menschheit entwickelte Sprache, eine Sprache, die wieder vergessen wurde, bevor sie sich zu einer konventionellen Universalsprache entwickeln konnte.
Wir brauchen daher nicht von einer gattungsmäßigen Vererbung zu sprechen, um den universalen Charakter von Symbolen zu erklären. Jedes menschliche Wesen, das ja seine wesentlichen körperlichen und geistig-seelischen Merkmale mit der übrigen Menschheit teilt, kann die Symbolsprache sprechen und verstehen, die sich auf diese gemeinsamen Eigenschaften gründet. Genauso wie wir das Weinen nicht erst erlernen müssen, wenn wir traurig sind, oder das Erröten, wenn wir uns ärgern, und genauso wie diese Reaktionen nicht auf eine bestimmte Rasse oder Bevölkerungsgruppe beschränkt sind, muss man auch die symbolische Sprache nicht erst erlernen, und sie beschränkt sich nicht auf irgendeinen Teil der menschlichen Gattung. Deshalb ist die Symbolsprache, so wie sie in Mythen und Träumen vorkommt, in allen Kulturen – den sogenannten primitiven Kulturen wie auch in den hochentwickelten der Ägypter und Griechen – anzutreffen. Überdies sind die in diesen verschiedenen Kulturen gebrauchten Symbole einander so auffallend ähnlich, weil sie alle auf die gleichen Sinneswahrnehmungen und emotionalen Erfahrungen zurückgehen, die den Menschen aller Kulturen gemeinsam sind. Zusätzliche Beweise dafür haben neuere Experimente erbracht, bei denen Menschen, die von der Theorie der Traumdeutung nichts wussten, unter Hypnose in der Lage waren, die Symbolik ihrer Träume ohne Schwierigkeiten zu verstehen. Als sie dann aus der Hypnose erwachten und aufgefordert wurden, dieselben Träume zu deuten, erklärten sie verwirrt: „Sie haben überhaupt keine Bedeutung – sie sind reiner Unsinn.“
Diese Feststellung bedarf jedoch einer Qualifizierung. Es gibt auch einige Symbole, die in den verschiedenen Kulturen entsprechend ihrer realitätsbezogenen Bedeutung einen jeweils unterschiedlichen Sinn haben. So ist beispielsweise die Funktion und dementsprechend auch die Bedeutung der Sonne in den nordischen Ländern eine andere als in den Tropen. In den nordischen Ländern, wo Wasser reichlich vorhanden ist, hängt alles Wachstum von der ausreichenden Sonnenbestrahlung ab. Die Sonne ist daher eine warme, Leben spendende, beschützende, liebende Macht. Im Nahen Osten, wo die Sonneneinstrahlung viel stärker ist, ist die Sonne eine gefährliche, ja bedrohliche Macht, vor der sich der Mensch schützen muss, während das Wasser als die Quelle allen Lebens und als wichtigste Voraussetzung für das Wachstum empfunden wird. Wir können von Dialekten der universalen Symbolsprache sprechen, die durch den Unterschied in den Naturgegebenheiten bedingt sind, welche dazu führen, dass bestimmte Symbole in den verschiedenen Regionen der Erde eine unterschiedliche Bedeutung haben. [IX-182]
Etwas ganz anderes als diese „symbolischen Dialekte“ ist die Tatsache, dass viele Symbole entsprechend den verschiedenartigen Erlebnissen, die mit ein und derselben Naturerscheinung verbunden sein können, mehr als eine Bedeutung haben. Kommen wir noch einmal auf das Symbol des Feuers zurück. Wenn wir das Feuer im Kamin beobachten, wo es Wohlbehagen ausstrahlt, dann drückt es eine lebhafte warme und angenehme Stimmung aus. Sehen wir dagegen ein Gebäude oder einen Wald brennen, dann ist es für uns ein drohendes, schreckliches Erlebnis, das uns die Machtlosigkeit des Menschen den Elementen der Natur gegenüber empfinden lässt. Daher kann das Feuer sowohl innere Lebendigkeit und Glück als auch Angst, Machtlosigkeit und eigene destruktive Neigungen symbolisieren. Das Gleiche gilt für das Symbol Wasser. Das Wasser kann eine äußerst destruktive Macht sein, wenn es vom Sturm aufgepeitscht wird oder wenn ein angeschwollener Fluss über die Ufer tritt. Daher kann es symbolisch Grauen und Chaos und andererseits auch Trost und Frieden bedeuten.
Ein anderes einschlägiges Beispiel ist das Symbol eines Tales. Das von Bergen eingeschlossene Tal kann in uns ein Gefühl der Sicherheit und des Behagens, des Geborgenseins vor allen äußeren Gefahren wecken. Aber die schützenden Berge können auch Mauern sein, die uns isolieren und hindern, aus dem Tal herauszukommen, weshalb das Tal auch zu einem Symbol des Eingekerkertseins werden kann. Die spezielle Bedeutung eines Symbols kann jeweils nur aus dem gesamten Kontext heraus verstanden werden, in dem es auftaucht, und unter Berücksichtigung der vorherrschenden Erfahrungen des Menschen, der sich dieses Symbols bedient. Bei der Erörterung der Traumsymbole werden wir hierauf noch zurückkommen.
Ein gutes Beispiel für die Funktion des universalen Symbols ist eine in der Symbolsprache geschriebene Geschichte, die fast jeder in unserem westlichen Kulturbereich kennt: das Buch Jona. Jona hat Gottes Stimme vernommen, die ihm gebietet, nach Ninive zu gehen und den Bewohnern zu verkünden, sie sollten von ihrem bösen Wandel ablassen, weil sie sonst vom Untergang bedroht seien. Jona kann Gottes Stimme nicht überhören, was ihn zum Propheten macht. Aber er ist ein Prophet wider Willen, und obgleich er weiß, was er tun sollte, versucht er, sich dem Befehl Gottes (man könnte auch sagen, der Stimme seines Gewissens) zu entziehen. Er ist ein Mensch, der kein Herz für seine Mitmenschen hat. Er ist ein Mensch mit einem starken Gefühl für Gesetz und Ordnung, doch fehlt ihm die Liebe. (Vgl. E. Fromm, Psychoanalyse und Ethik, 1947a, GA II, S. 65°f., wo ich die Jona-Geschichte unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung von Liebe aufgreife.) Wie wird nun das, was sich im Innern von Jona abspielt, in der Geschichte dargestellt?
Wir erfahren, dass Jona nach Jafo hinabgeht und dort ein Schiff findet, das nach Tarschisch fährt. Als er sich jedoch mitten auf dem Meer befindet, erhebt sich ein gewaltiger Sturm, und während alle anderen voller Angst und Aufregung sind, steigt Jona in den unteren Teil des Schiffes hinab und fällt in einen tiefen Schlaf. Die Seeleute, die glauben, Gott habe den Sturm geschickt, weil sich jemand auf dem Schiff befindet, der bestraft werden soll, wecken Jona, der ihnen zuvor erzählt hatte, dass er vor Jahwes Gebot auf der Flucht sei. Er sagt ihnen, sie sollten ihn nehmen und ins Meer werfen, damit dieses sich beruhige. Die Seeleute (die einen [IX-183] bemerkenswerten Sinn für Menschlichkeit erkennen lassen, da sie zunächst alles andere versuchen, bevor sie seiner Anweisung nachkommen) nehmen schließlich Jona und werfen ihn ins Meer, das sofort zu toben aufhört. Jona wird von einem großen Fisch verschlungen, in dessen Bauch er drei Tage und drei Nächte zubringt. Er betet im Bauch des Fisches zu Gott, er möge ihn aus seinem Gefängnis befreien, und der Herr befiehlt dem Fisch, Jona ans Land zu speien. Nun begibt sich Jona nach Ninive, erfüllt Gottes Befehl und rettet so die Bewohner der Stadt.
Die Geschichte wird erzählt, als ob die Dinge sich wirklich so zugetragen hätten. Sie ist jedoch in symbolischer Sprache geschrieben, und alle darin als real geschilderten Ereignisse sind Symbole für die inneren Erfahrungen des Helden. Wir treffen auf eine Reihe aufeinanderfolgender Symbole: die Besteigung des Schiffes, das Hinabsteigen in den Bauch des Schiffes, das Einschlafen, der Aufenthalt im Meer und im Bauch des Fisches. Alle diese Symbole stehen stellvertretend für die gleiche innere Erfahrung: den Zustand der Geborgenheit und Isolierung eines Menschen, der sich aus Gründen der eigenen Sicherheit von der Kommunikation mit anderen Menschen zurückzieht. Sie repräsentieren einen Zustand, den man auch mit einem anderen Symbol, nämlich dem des Fötus im Mutterleib ausdrücken könnte. So verschieden der Rumpf eines Schiffes, der tiefe Schlaf, das Meer und der Bauch eines Fisches realistisch gesehen auch sein mögen, so sind sie doch Ausdruck der gleichen inneren Erfahrung, jener Mischung aus Geborgenheit und Absonderung.
In der manifesten Geschichte ereignen sich die Dinge in Raum und Zeit: Zuerst geht er in den Rumpf des Schiffes; dann schläft der Held ein; dann wird er ins Meer geworfen; dann wird er vom Fisch verschlungen. Eines geschieht nach dem anderen, und wenn sich auch einiges ereignet, was offensichtlich nicht der Wirklichkeit entsprechen kann, so besitzt die Geschichte doch in Bezug auf Zeit und Raum ihre eigene folgerichtige Logik. Und wenn wir begreifen, dass es nicht die Absicht des Verfassers war, uns den Ablauf äußerer Ereignisse zu berichten, sondern dass er das innere Erlebnis eines Mannes schildern wollte, der zwischen seinem Gewissen und dem Wunsch, seiner inneren Stimme zu entfliehen, hin- und hergerissen wurde, dann wird uns klar, dass seine verschiedenen aufeinanderfolgenden Handlungen alle die gleiche ihn beherrschende Stimmung ausdrücken und dass die zeitliche Abfolge die wachsende Intensität des gleichen Gefühls ausdrückt. Indem Jona versucht, sich der Pflicht seinen Mitmenschen gegenüber zu entziehen, sondert er sich mehr und mehr von ihnen ab, bis schließlich im Bauch des Fisches das Gefühl der Geborgenheit so sehr dem Gefühl des Eingekerkertseins weicht, dass er es nicht länger erträgt und Gott bitten muss, ihn aus dem Gefängnis zu befreien, in das er sich selbst hineingebracht hat. (Es ist dies ein für die Neurose äußerst charakteristischer Mechanismus. Der Betreffende nimmt zur Abwehr einer Gefahr eine bestimmte Haltung ein, die dann jedoch weit über ihre ursprüngliche Abwehrfunktion hinauswächst und zu einem neurotischen Symptom wird, von dem der Betreffende sich zu befreien versucht.) So endet Jonas Flucht in die Geborgenheit der Isolation in der Qual des Eingesperrtseins, und er greift sein Leben dort wieder auf, wo er zu entrinnen versuchte.
Es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen der Logik der manifesten und der Logik der latenten Erzählung. In der manifesten Erzählung besteht ein logischer [IX-184] Kausalzusammenhang zwischen den äußeren Ereignissen. Jona will übers Meer fahren, weil er vor Gott fliehen will, er schläft ein, weil er müde ist, er wird über Bord geworfen, weil man ihn für die Ursache des Sturmes hält, und er wird von dem Fisch verschlungen, weil es im Meer Menschen fressende Fische gibt. Ein Ereignis ergibt sich aus dem vorhergehenden. (Der letzte Teil der Geschichte ist zwar unrealistisch, aber nicht unlogisch.) In der latenten Geschichte herrscht dagegen eine andere Art von Logik. Die verschiedenen Ereignisse stehen durch ihre Assoziation mit derselben inneren Erfahrung miteinander in Verbindung. Was als kausale Abfolge äußerer Ereignisse erscheint, steht stellvertretend für Ereignisse, die auf Grund ihrer Assoziation mit inneren Erlebnissen miteinander zusammenhängen. Es ist dies ebenso logisch wie es die manifeste Geschichte ist – doch handelt es sich um eine Logik anderer Art.
Wenn wir uns jetzt der Untersuchung des Wesens der Träume zuwenden, wird uns die in der Symbolsprache herrschende Logik noch deutlicher werden.
3. Das Wesen der Träume
Die Ansichten über das Wesen der Träume weichen im Laufe der Jahrhunderte und in den verschiedenen Kulturen erheblich voneinander ab. Aber ob jemand glaubt, Träume seien reale Erlebnisse unserer körperlosen Seele, die während des Schlafes den Körper verlassen hat, oder ob man meint, die Träume seien uns von Gott oder von bösen Geistern eingegeben, ob man in ihnen den Ausdruck unserer irrationalen Leidenschaften oder ganz im Gegenteil unserer höchsten und edelsten Kräfte sieht, eines bleibt unbestritten: Alle Träume haben einen Sinn und eine Bedeutung. Sinnvoll sind sie, weil sie eine Botschaft enthalten, die man verstehen kann, wenn man den Schlüssel zu ihrer Entzifferung besitzt. Bedeutungsvoll sind sie, weil wir nichts Nebensächliches träumen, selbst wenn es sich in einer Sprache ausdrückt, die das Bedeutsame der Traumbotschaft hinter einer nichtssagenden Fassade verbirgt.
Erst in den letzten Jahrhunderten hat man diese Ansicht radikal aufgegeben. Die Traumdeutung wurde in den Bereich des Aberglaubens verwiesen, und die Aufgeklärten und Gebildeten – ob Laien oder Wissenschaftler – zweifelten nicht daran, dass die Träume sinn- und bedeutungslose Manifestationen unserer Seele oder bestenfalls seelische Reflexe körperlicher, im Schlaf empfangener Eindrücke seien. Es war Freud, der zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts die alte Auffassung neu bestätigte, dass die Träume sinn- und bedeutungsvoll sind, dass wir nichts träumen, was nicht ein wichtiger Ausdruck unseres Innenlebens ist, und dass man alle Träume verstehen kann, wenn man nur den Schlüssel dazu besitzt. Freud bezeichnete die Traumdeutung als die via regia, als den Königsweg zur Erkenntnis des Unbewussten (S. Freud, 1900a, S. 613) und den Traum als stärkste Kraft, die unser pathologisches wie auch unser normales Verhalten motiviert. Neben dieser mehr allgemeinen Feststellung über das Wesen der Träume hat sich Freud nachdrücklich und etwas unnachgiebig zu einer der ältesten diesbezüglichen Theorien bekannt, dass nämlich Träume die Erfüllung irrationaler Leidenschaften seien, die wir in unserem wachen Dasein verdrängt haben.
Ich möchte an dieser Stelle noch nicht näher auf die Traumtheorien Freuds und auf solche aus früheren Zeiten eingehen, sondern in einem späteren Kapitel darauf zurückkommen. Zunächst möchte ich jetzt das Wesen des Traums erörtern, wie ich es [IX-186] mit Hilfe der Arbeiten Freuds und auf Grund eigener Erfahrungen als Träumender und Traumdeuter verstehen lernte.
Angesichts der Tatsache, dass es keine Äußerung der Seelentätigkeit gibt, die nicht im Traum auftaucht, glaube ich, dass die einzige Definition des Wesens des Traumes, die dieses Phänomen weder entstellt noch bagatellisiert, die allgemein gehaltene Definition ist: Träumen ist eine sinn- und bedeutungsvolle Äußerung jeglicher Seelentätigkeit im Schlafzustand.
Diese Definition ist zweifellos zu allgemein gehalten, als dass sie uns wesentlich zum Verständnis der Natur der Träume weiterhelfen könnte, wenn wir nicht etwas Genaueres über den „Schlafzustand“ und dessen besondere Auswirkung auf unsere Seelentätigkeit sagen können. Wenn wir aber herausfinden können, welche spezifische Wirkung der Schlaf auf unsere Seelentätigkeit hat, können wir vielleicht beträchtlich mehr über das Wesen des Träumens in Erfahrung bringen.
Physiologisch betrachtet ist der Schlaf ein Zustand der chemischen Regeneration des Organismus. Während alle Tätigkeit ruht und so gut wie jede sinnliche Wahrnehmung ausgeschaltet ist, wird neue Energie gespeichert. Psychologisch gesehen unterbricht der Schlaf die für unser waches Dasein kennzeichnende Hauptfunktion: unsere Reaktion auf die Umwelt durch Wahrnehmung und Handeln. Dieser Unterschied zwischen den biologischen Funktionen von Wachen und Schlafen bedeutet tatsächlich einen Unterschied zwischen zwei Zuständen unseres Daseins.
Um die Wirkung des Schlafzustandes auf unser Seelenleben richtig beurteilen zu können, müssen wir uns zunächst mit einem allgemeinen Problem befassen: mit der gegenseitigen Abhängigkeit unserer jeweiligen Tätigkeit und des damit verbundenen Denkprozesses. Was wir denken, wird weitgehend durch das bestimmt, was wir tun und was wir vollbringen möchten. Das soll nicht heißen, dass unser Denken durch unser jeweiliges Interesse entstellt werde, sondern nur, dass es sich dementsprechend verändert.
Welche Einstellung haben zum Beispiel unterschiedliche Menschen zu einem Wald? Ein Maler, der sich in einen Wald begibt, um dort zu malen, der Eigentümer des Waldstücks, der sich darüber klar werden will, was es ihm einbringen wird, ein Offizier, der sich für das taktische Problem interessiert, wie das Gebiet zu verteidigen ist, ein Wanderer, der sich daran erfreuen will – jeder von ihnen wird eine völlig andere Einstellung zu diesem Wald haben, weil einem jeden ein anderer Aspekt desselben wichtig ist. Das Interesse des Malers wird den Formen und Farben gelten, das des Geschäftsmanns wird sich auf Größe, Alter und Anzahl der Bäume richten, der Offizier wird sich für die Sicht- und Deckungsmöglichkeiten interessieren, während es dem Wanderer auf die Waldpfade und seine körperliche Bewegung ankommt. Alle werden sich zwar in Bezug auf die abstrakte Feststellung, dass sie am Rande eines Waldes stehen, einig sein, aber die Art ihres Erlebnisses, „einen Wald zu sehen“, hängt von der verschiedenartigen Tätigkeit ab, die sie im Sinn haben.
Der Unterschied zwischen den biologischen und den psychologischen Funktionen von Schlafen und Wachen ist grundsätzlich anderer Art als irgendein Unterschied zwischen anderen Tätigkeiten, und dementsprechend ist auch der Unterschied zwischen den die beiden Zustände betreffenden Begriffssystemen unvergleichlich [IX-187] größer.[6] Im wachen Zustand reagieren unsere Gedanken und Gefühle in erster Linie auf die an sie gestellten Anforderungen – auf die Aufgabe, mit unserer Umwelt fertig zu werden, sie zu verändern oder uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Zu überleben ist die Aufgabe des wachen Menschen; er ist den Gesetzen unterworfen, welche die Realität beherrschen. Das bedeutet, dass er in den Begriffen von Zeit und Raum denken muss.
Während wir schlafen, geben wir uns nicht damit ab, die Außenwelt unseren Zwecken zu unterwerfen. Wir sind hilflos, und man hat den Schlaf daher mit Recht den „Bruder des Todes“ genannt. Aber wir sind auch frei, freier als im Wachen. Wir sind befreit von der Last der Arbeit, von der Aufgabe anzugreifen oder uns zu verteidigen, wir brauchen die Wirklichkeit nicht zu beobachten und zu meistern. Wir brauchen nicht auf die Außenwelt zu achten. Wir richten unseren Blick nach innen und beschäftigen uns ausschließlich mit uns selbst. Im Schlaf könnte man uns mit einem Embryo oder sogar mit einem Toten vergleichen; oder auch mit Engeln, die den Gesetzen der „Realität“ nicht unterworfen sind. Im Schlaf hat das Reich der Notwendigkeit dem Reich der Freiheit Platz gemacht, in dem das „Ich bin“ das einzige ist, auf das sich unsere Gedanken und Gefühle beziehen.
Während des Schlafs weist die seelische Tätigkeit eine andere Logik auf als im wachen Dasein. Im Schlaf brauche ich mich nicht um Dinge zu kümmern, die nur im Umgang mit der Wirklichkeit von Bedeutung sind. Wenn ich zum Beispiel von einem Menschen das Gefühl habe, dass er ein Feigling ist, dann kann ich von ihm träumen, er habe sich aus einem Menschen in ein Huhn verwandelt. Diese Verwandlung ist in Bezug auf mein Gefühl gegenüber dieser Person sinnvoll, unsinnig ist sie nur in Bezug auf meine Orientierung zur Außenwelt (in Bezug darauf, was ich realistisch mit dem Betreffenden tun könnte). Dem Schlaferlebnis fehlt nicht die Logik, aber es handelt sich um andere logische Gesetze, die jedoch in diesem Erlebniszustand völlig gültig sind.
Schlafen und Wachen sind die beiden Pole des menschlichen Daseins. Unser waches Leben ist mit der Aufgabe ausgefüllt zu handeln, im Schlaf sind wir von dieser Aufgabe befreit. Der Schlaf hat lediglich die Funktion der Selbsterfahrung. Wachen wir aus dem Schlaf auf, so begeben wir uns wieder in den Bereich tätigen Lebens. Wir sind dann völlig auf diesen Bereich eingestellt, in welchem sich auch unser Gedächtnis bewegt: Wir erinnern uns an das, was wir zurückrufen können, in raum-zeitlichen Begriffen. Die Schlafwelt ist verschwunden, und wir können uns an das, was wir darin erlebten – an unsere Träume – nur noch unter größten Schwierigkeiten erinnern. (Zum Problem der Gedächtnisfunktion in Beziehung zur Traumtätigkeit vgl. den höchst anregenden Aufsatz On Memory and Childhood Amnesia von E. G. Schachtel, 1947.) Diese Situation ist in vielen Märchen symbolisch dargestellt: In der Nacht bevölkern Gespenster und gute und böse Geister die Szene, aber wenn der Morgen dämmert, verschwinden sie, und von dem ganzen eindrucksvollen Geschehen ist nichts mehr übrig.
Aus diesen Erwägungen ergeben sich gewisse Schlussfolgerungen für das Wesen des Unbewussten:
Es ist weder Jungs mythisches Reich mit seinen aus der Gattungsgeschichte ererbten [IX-188] Erfahrungen, noch Freuds Sitz irrationaler libidinöser Kräfte. Wir müssen es vielmehr gemäß dem Grundsatz verstehen: „Was wir denken und fühlen, wird von dem beeinflusst, was wir tun.“
Das Bewusstsein ist die seelische Tätigkeit in dem Zustand unseres Daseins, in welchem wir uns handelnd mit der Außenwelt beschäftigen. Das Unbewusste ist das seelische Erleben im Zustand unseres Daseins, in welchem wir alle Verbindungen mit der Außenwelt abgebrochen haben, in dem wir nicht mehr bestrebt sind zu handeln und tätig zu sein, sondern in dem wir uns nur noch mit uns selbst beschäftigen. Das Unbewusste ist ein mit einer speziellen Form unseres Daseins – der Inaktivität – verbundenes Erleben, und seine charakteristischen Merkmale ergeben sich aus dem Wesen dieser Daseinsform. Die Eigenschaften des Bewusstseins sind dagegen bestimmt durch das Wesen des tätigen Handelns und durch die Überlebensfunktion des wachen Zustandes.
Das „Unbewusste“ ist nur in Bezug auf unseren „normalen“ Zustand des Tätigseins das Unbewusste. Wenn wir vom „Unbewussten“ reden, wollen wir in Wirklichkeit nur damit sagen, dass eine Erfahrung nicht in den geistig-seelischen Raum hineinpasst, der existiert, während wir tätig sind. Wir empfinden es dann als ein geisterhaftes, störendes Element, das nur schwer zu fassen ist und an das man sich nur schwer erinnern kann. Aber wenn wir schlafen, ist uns die Welt des Tages ebenso unbewusst, wie es die Welt der Nacht in unserem wachen Erleben ist. Gewöhnlich gebrauchen wir den Begriff des „Unbewussten“ nur vom Standpunkt unseres Tageserlebens aus; daher kommt darin nicht zum Ausdruck, dass sowohl das Bewusste als auch das Unbewusste nur verschiedene Seelenzustände sind, die sich auf unterschiedliche Zustände unseres Erlebens beziehen.
Man wird vermutlich dagegen einwenden, dass auch im wachen Zustand unser Denken und Fühlen nicht ganz den Einschränkungen von Zeit und Raum unterworfen ist und dass unser schöpferisches Vorstellungsvermögen es uns ermöglicht, über vergangene und zukünftige Dinge so nachzudenken, als ob sie gegenwärtig wären, und über weit entfernte Gegenstände so zu urteilen, als ob wir sie vor Augen hätten. Man wird auch einwenden, dass unser waches Fühlen nicht von der physischen Gegenwart des Objekts und auch nicht von seiner zeitlichen Koexistenz abhängt und dass aus diesem Grund das Fehlen des raum-zeitlichen Systems keine Besonderheit unseres Daseins im Schlaf im Gegensatz zum wachen Zustand ist, sondern dass es unser Denken und Fühlen im Gegensatz zu unserem tätigen Handeln kennzeichnet. Das ist mir ein willkommener Einwand, gibt er mir doch die Möglichkeit, einen wesentlichen Punkt meines Arguments klarzustellen.
Wir müssen nämlich zwischen den Inhalten unserer Denkprozesse und den beim Denken verwendeten logischen Kategorien unterscheiden. Während es zutrifft, dass die Inhalte unseres wachen Denkens nicht den Grenzen von Raum und Zeit unterworfen sind, sind die Kategorien des logischen Denkens raum-zeitlicher Natur. So kann ich beispielsweise an meinen Vater denken und feststellen, dass seine Einstellung in einer bestimmten Situation mit der meinen identisch ist. Diese Feststellung ist logisch richtig. Wenn ich andererseits behaupte: „Ich bin mein Vater“, dann ist diese Behauptung „unlogisch“, weil sie den Begriffen der physikalischen Welt nicht [IX-189] entspricht. Rein erlebnismäßig gesehen ist der Satz jedoch logisch, denn ich bringe darin mein Gefühl von Identität mit meinem Vater zum Ausdruck. Logische Denkprozesse im wachen Zustand sind Kategorien unterworfen, die in einer speziellen Daseinsform wurzeln – nämlich in der, in welcher wir zur Realität handelnd in Beziehung treten. In meinem schlafenden Dasein, das durch das Fehlen einer jeden auch nur potenziellen Handlung gekennzeichnet ist, kommen Kategorien zur Anwendung, die sich nur auf das Erlebnis meines Selbst beziehen. Das Gleiche gilt für das Fühlen. Wenn mein Gefühl im wachen Zustand einem Menschen gilt, den ich seit zwanzig Jahren nicht gesehen habe, so bleibe ich mir immer der Tatsache bewusst, dass der Betreffende nicht anwesend ist. Wenn ich dagegen von ihm träume, dann empfinde ich ihn so, als ob er gegenwärtig wäre. Wenn ich jedoch sage, „so, als ob er gegenwärtig wäre“, drücke ich mein Gefühl in Begriffen aus, die dem „wachen Leben“ entsprechen. Im schlafenden Dasein gibt es kein “als ob“; da ist der Betreffende gegenwärtig.
Ich habe auf den vorangegangenen Seiten den Versuch gemacht, die im Schlaf herrschenden Bedingungen zu beschreiben und aus dieser Beschreibung gewisse Schlüsse auf die Traumtätigkeit zu ziehen. Wir müssen jetzt noch einen Schritt weitergehen und ein spezifisches Element der dem Schlaf eigentümlichen Bedingungen untersuchen, das sich für das Verständnis der Traumprozesse als höchst bedeutsam herausstellen wird. Wir sagten, dass wir uns im Schlaf nicht damit beschäftigen, auf die äußere Realität Einfluss zu nehmen. Wir bemerken sie gar nicht und beeinflussen sie nicht, auch sind wir selbst den Einflüssen der Außenwelt nicht unterworfen. Hieraus folgt, dass es von der Beschaffenheit dieser äußeren Realität abhängt, welche Wirkung unsere Absonderung von ihr auf uns hat. Übt die Außenwelt einen im wesentlichen günstigen Einfluss auf uns aus, so dürfte das Fehlen dieses Einflusses während des Schlafes den Wert unserer Traumtätigkeit so weit herabsetzen, dass dieser Wert geringer ist als der unserer Seelentätigkeit während des Tages, wo diese günstigen Einflüsse der Außenwelt auf uns einwirken.
Aber stimmt es denn, dass der Einfluss der Realität auf uns vor allem günstig ist? Kann er nicht auch schädlich für uns sein, und können daher – wenn dieser Einfluss fehlt – nicht auch Eigenschaften in uns zum Vorschein kommen, die besser sind als die, die wir im wachen Zustand haben?
Wenn wir von der Realität außerhalb unserer selbst sprechen, so meinen wir damit nicht in erster Linie die Welt der Natur. An sich ist die Natur weder gut noch böse. Sie kann hilfreich oder gefährlich für uns sein, und wenn wir von ihr nichts wahrnehmen, so befreit uns das tatsächlich von der Aufgabe, sie zu meistern oder uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Allerdings macht uns das weder dümmer noch gescheiter, weder besser noch schlechter. Ganz anders steht es mit der von Menschen geschaffenen Welt um uns, mit der Kultur, in der wir leben. Ihre Wirkung auf uns ist recht zwiespältig, wenn wir auch zu der Annahme neigen, dass sie sich nur zu unserem Vorteil auswirkt.
Tatsächlich spricht ja geradezu überwältigend viel dafür, dass die Kultur einen segensreichen Einfluss auf uns ausübt. Es ist unsere Fähigkeit, Kultur zu schaffen, die uns von der Tierwelt unterscheidet. Der Unterschied im kulturellen Niveau ist es, der [IX-190] den Unterschied zwischen den höheren und den niederen Stufen menschlicher Entwicklung ausmacht. Das wichtigste Merkmal der Kultur, die Sprache, ist die Vorbedingung für jede menschliche Leistung. Man hat den Menschen mit Recht als das Symbole schaffende Tier bezeichnet, denn ohne unsere Fähigkeit zur Sprache könnten wir kaum als Menschen bezeichnet werden. Aber auch jede andere menschliche Funktion hängt von unserem Kontakt mit der Außenwelt ab. Wir lernen denken, indem wir andere beobachten und von ihnen unterrichtet werden. Wir entwickeln unsere emotionalen, intellektuellen und künstlerischen Fähigkeiten dadurch, dass wir mit dem angehäuften Wissen und den von der Gesellschaft geschaffenen künstlerischen Leistungen in Berührung kommen. Wir lernen zu lieben und für andere zu sorgen durch den Kontakt mit ihnen, und wir lernen unsere feindseligen Impulse und unseren Egoismus dadurch im Zaum zu halten, dass wir andere lieben oder zum mindesten fürchten.
Ist demnach die vom Menschen geschaffene Realität außerhalb unserer selbst nicht der wichtigste Faktor für die Entwicklung des Besten in uns, und ist daher nicht zu erwarten, dass wir – wenn wir mit der Außenwelt nicht in Kontakt stehen – zeitweise in einen primitiven, tierähnlichen, unvernünftigen Geisteszustand zurückfallen? Es spricht viel für eine solche Annahme, und viele – von Platon bis Freud –, die sich mit dem Traum beschäftigt haben, vertreten die Ansicht, dass eine derartige Regression das wesentliche Kennzeichen des Schlafzustandes und damit auch der Traumtätigkeit sei. Von diesem Standpunkt aus erwartet man von den Träumen, dass in ihnen die irrationalen, primitiven Strebungen in uns zum Ausdruck kommen, und die Tatsache, dass wir unsere Träume so leicht vergessen, wird weitgehend damit erklärt, dass wir uns jener irrationalen und verbrecherischen Impulse schämen, die wir zum Ausdruck bringen, wenn wir nicht unter der Kontrolle der Gesellschaft stehen. Diese Trauminterpretation ist sicher richtig, und wir werden sogleich darauf zurückkommen und einige Beispiele dafür anführen. Die Frage ist jedoch, ob es die ganze Wahrheit ist und ob nicht die negativen Elemente im Einfluss der Gesellschaft an dem Paradoxon schuld sind, dass wir in unseren Träumen nicht nur weniger vernünftig und anständig, sondern auch intelligenter, klüger und urteilsfähiger sind als im wachen Zustand.
Tatsächlich hat die Kultur nicht nur einen wohltätigen, sondern auch einen schädlichen Einfluss auf unsere intellektuellen und moralischen Funktionen. Die Menschen sind voneinander abhängig und brauchen einander. Aber die Geschichte der Menschheit wurde bis zum heutigen Tag von einer entscheidenden Tatsache beeinflusst, dass nämlich die materielle Produktion nicht ausreicht, um die berechtigten Bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen. Der Tisch war immer nur für ein paar von den vielen gedeckt, die sich zum Essen setzen wollten. Die Stärkeren suchten sich ihren Platz zu sichern, und das bedeutete, dass sie anderen ihren Platz wegnehmen mussten. Wenn sie ihre Mitmenschen so geliebt hätten, wie Buddha oder die Propheten oder Jesus das forderten, dann hätten sie ihr Brot mit ihnen geteilt, anstatt ohne sie Fleisch zu essen und Wein zu trinken. Aber da die Liebe die höchste und schwierigste Leistung der Menschheit ist, kann man den Menschen keinen Vorwurf daraus machen, dass die, welche sich an den gedeckten Tisch setzen und die guten Dinge des Lebens genießen konnten, mit den anderen nicht teilen wollten und daher versuchen [IX-191] mussten, über diejenigen, die ihre Privilegien bedrohten, Macht zu bekommen. Diese Macht war oft die Macht des Eroberers, die physische Macht, welche die Mehrheit zwang, sich mit ihrem Los abzufinden. Aber die physischen Machtmittel standen nicht immer zur Verfügung und reichten oft nicht aus. Man musste auch Macht über die Seelen der Menschen gewinnen, um sie davon abzuhalten, ihre Fäuste zu gebrauchen. Diese Macht über das Denken und Fühlen war unentbehrlich, wenn die wenigen sich ihre Privilegien erhalten wollten. Bei diesem Prozess erlitten die Wenigen jedoch einen ebensolchen seelischen Schaden wie die Vielen. Der Gefangenenwärter wird fast ebenso zum Gefangenen wie der Gefangene selbst. Die „Elite“, die diejenigen beherrscht, welche nicht „auserwählt“ sind, wird zu Gefangenen der eigenen restriktiven Tendenzen. So werden Geist und Seele der Herrschenden wie die der Beherrschten von ihrer wesentlichen humanen Aufgabe abgelenkt, menschlich zu fühlen und zu denken, sich der Kräfte der Vernunft und der Liebe, die dem Menschen innewohnen, zu bedienen und sie weiterzuentwickeln, da der Mensch ohne deren volle Entfaltung ein Krüppel bleibt.
Bei diesem Ablenkungs- und Entstellungsprozess wird der Charakter der Menschen verdorben. Ziele, die im Widerspruch zu den Interessen des wahren humanen Selbst stehen, treten in den Vordergrund. Die Liebeskraft erlahmt, was dazu führt, dass man Macht über andere zu gewinnen sucht. Die innere Sicherheit geht verloren, und man sucht einen Ausgleich, indem man leidenschaftlich nach Ruhm und Ansehen strebt. So verliert der Mensch sein Gefühl für Würde und Integrität und sieht sich gezwungen, sich in eine Ware zu verwandeln und seine Selbstachtung von seiner Verkäuflichkeit, seinem Erfolg abhängig zu machen. All das führt dazu, dass wir nicht nur lernen, was recht ist, sondern auch, was falsch ist; dass wir nicht nur hören, was gut ist, sondern ständig unter dem Einfluss von Ideen stehen, die dem Leben schaden.
Das gilt für einen primitiven Stamm, in dem strenge Gesetze und Gebräuche Macht über die Seelen ausüben, aber es gilt ebenso für unsere moderne Gesellschaft, die angeblich von jedem strengen Ritualismus frei ist. Die Beseitigung des Analphabetentums und die Ausbreitung der Massenmedien haben kulturellen Klischeevorstellungen einen ebenso großen Einfluss verschafft, wie dies in einer kleinen Stammeskultur mit ihren außerordentlich starken Restriktionen der Fall ist. Der heutige Mensch ist fast ständig irgendwelchem „Lärm“ ausgesetzt, dem Lärm von Radio und Fernsehen, von Schlagzeilen, Reklamen und Filmen, die uns meist nicht klüger machen, sondern im Gegenteil verdummen. Wir sind lügnerischen Rationalisierungen ausgeliefert, die sich als Wahrheit ausgeben, und schierem Unsinn, der sich als gesunder Menschenverstand oder als die höhere Weisheit der Spezialisten tarnt, heuchlerischem Gerede, intellektueller Trägheit und Unaufrichtigkeit, die je nachdem im Namen der Ehre die Stimme erheben oder sich als „Realismus“ ausgeben. Wir fühlen uns zwar dem Aberglauben früherer Generationen und der sogenannten primitiven Kulturen überlegen, aber man hämmert uns ständig genau die gleiche Art von abergläubischen Ansichten ein, die sich als letzte Entdeckungen der Wissenschaft aufspielen. Ist es da verwunderlich, dass das Wachsein nicht nur ein Segen, sondern auch ein Fluch ist? Ist es verwunderlich, dass wir im Schlaf, wenn wir mit uns allein sind, wenn wir in uns hineinblicken können, ohne dabei von dem Lärm und Unsinn gestört zu werden, die uns [IX-192] tagsüber umgeben, besser in der Lage sind, unsere wahrsten und wertvollsten Gefühle zu spüren und Gedanken zu denken?
So kommen wir denn zu folgendem Schluss: Der Zustand des Schlafes hat eine zweideutige Funktion; dadurch, dass wir mit unserer Kultur nicht in Berührung stehen, tritt das Schlechteste und zugleich das Beste in uns in Erscheinung. Daher können wir im Traum weniger gescheit, weniger weise und weniger anständig, aber auch besser und weiser sein als in unserem wachen Leben.
An diesem Punkt stellt sich uns das schwierige Problem: Woher wissen wir, ob ein Traum als Ausdruck des Besten oder des Schlechtesten in uns zu verstehen ist? Gibt es da ein Prinzip, das uns den Weg zeigen könnte?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir unsere allgemeiner gehaltene Diskussion beenden und weitere Einsichten dadurch zu gewinnen suchen, dass wir einige konkrete Traumbeispiele diskutieren.
Den folgenden Traum berichtete ein Mann, der tags zuvor einer „sehr bedeutenden Persönlichkeit“ begegnet war. Der Betreffende stand in dem Ruf, besonders weise und gütig zu sein. Unser Träumer hatte ihn aufgesucht, weil er von dem, was alle über diesen alten Mann berichteten, stark beeindruckt war. Nach etwa einer Stunde hatte er ihn wieder verlassen mit dem Gefühl, einen bedeutenden, gütigen Menschen kennengelernt zu haben.
Ich sehe Herrn X. (die sehr bedeutende Person), und sein Gesicht sieht ganz anders aus als gestern. Ich sehe einen grausamen Mund und ein hartes Gesicht. Er berichtet jemandem lachend, es sei ihm gelungen, eine arme Witwe um ihre letzten paar Groschen zu betrügen. Ich habe ein Gefühl des Abscheus.
Auf die Frage, was ihm zu diesem Traum einfalle, bemerkte der Träumer, er könne sich erinnern, dass er flüchtig ein Gefühl der Enttäuschung empfunden habe, als er das Zimmer des Herrn X. betreten und einen ersten Blick auf dessen Gesicht geworfen habe; dieses Gefühl sei jedoch wieder verschwunden, als X. ein freundliches, liebenswürdiges Gespräch mit ihm begonnen habe.
Wie ist dieser Traum zu verstehen? Vielleicht könnte der Träumer auf den Ruhm des Herrn X. neidisch sein, sodass er ihn deshalb nicht leiden kann? In diesem Fall wäre der Traum Ausdruck des irrationalen Hasses, der den Träumer erfüllt, ohne dass er sich dessen bewusst wäre. Aber im hier berichteten Fall lag die Sache anders. Nachdem unser Träumer durch seine Träume misstrauisch geworden war, beobachtete er Herrn X. aufmerksamer und kam in den folgenden Sitzungen dahinter, dass dieser Mann etwas Rücksichtsloses an sich hatte, das er in seinem Traum zum ersten Mal bemerkt hatte. Dieser Eindruck wurde ihm von einigen Personen bestätigt, die die Meinung der Mehrheit anzuzweifeln wagten, dass X. ein so gütiger Mensch sei. Der ungünstige Eindruck wurde auch durch einige Tatsachen im Leben von X. bestätigt, die zwar keineswegs so krass waren, wie die Geschichte im Traum, die aber immerhin vom gleichen Geist zeugten.
Wir sehen also, dass der Träumer den Charakter von X. im Schlaf viel treffender beurteilte als im Wachen. Der „Lärm“ der öffentlichen Meinung, die immer wieder betonte, X. sei ein wunderbarer Mensch, hinderte ihn daran, sich seines kritischen Gefühls X. gegenüber bewusst zu werden, als er diesen sah. Erst später, nachdem er den [IX-193] Traum gehabt hatte, fiel ihm ein, dass ihm für den Bruchteil einer Sekunde Misstrauen und Zweifel gekommen waren. Im Traum, wo er vor dem „Lärm“ geschützt und in der Lage war, mit sich und seinen Eindrücken und Gefühlen allein zu sein, konnte er sich ein Urteil bilden, das treffender war und der Wahrheit mehr entsprach als sein Eindruck im wachen Zustand.
Bei diesem wie auch bei jedem anderen Traum können wir nur dann entscheiden, ob irrationale Leidenschaft oder Vernunft darin zum Ausdruck kommt, wenn wir die Person des Träumers, seine Stimmung beim Einschlafen und alles berücksichtigen, was wir an realen Daten über die Situation zur Verfügung haben, von der er geträumt hat. In diesem Fall wird unsere Interpretation durch eine ganze Reihe von Daten bestätigt. Der Träumer konnte sich noch daran erinnern, dass X. anfangs einen unsympathischen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Er hegte keine feindseligen Gefühle gegen ihn und hatte auch keinen Anlass dazu. Tatsachen aus dem Leben von X. und spätere Beobachtungen bestätigten den Eindruck, den der Träumer im Schlaf von ihm hatte. Wären alle diese Faktoren nicht vorhanden gewesen, so hätten wir den Traum anders gedeutet. Wenn unser Träumer zum Beispiel dazu geneigt hätte, auf berühmte Leute neidisch zu sein, wenn er keine Beweise für die Richtigkeit des Traumurteils über X. hätte finden können und wenn ihm nicht eingefallen wäre, dass X. ihm unsympathisch vorkam, als er ihn zum ersten Mal sah, dann würden wir natürlich annehmen, dass in diesem Traum nicht seine Einsicht, sondern sein irrationaler Hass zum Ausdruck kam.
Einsicht ist mit Voraussage eng verwandt. Etwas voraussagen heißt soviel wie den zukünftigen Gang der Ereignisse aus der Richtung und Intensität der Kräfte zu schließen, die wir gegenwärtig am Werk sehen. Eine gründliche Kenntnis nicht des oberflächlichen Eindrucks, sondern der in der Tiefe wirkenden Kräfte ermöglicht Voraussagen, und eine ernstzunehmende Voraussage muss sich stets auf solches Wissen stützen. Kein Wunder, dass wir oft Entwicklungen und Ereignisse voraussagen, die später durch Tatsachen bestätigt werden. Wenn wir die Telepathie hier einmal außer acht lassen, so fallen viele Träume, in denen der Träumer zukünftige Ereignisse voraussieht, in die Kategorie rationaler Voraussagen der Art, wie wir sie soeben definiert haben. Einer der ältesten uns überlieferten Träume, die sich bewahrheiteten, war der Josefs (Gen 37, 5-11):
Einst hatte Josef einen Traum. Als er ihn seinen Brüdern erzählte, hassten sie ihn noch mehr. Er sagte zu ihnen: Hört, was ich geträumt habe! Wir banden Garben mitten auf dem Feld. Meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen. Eure Garben umringten sie und neigten sich tief vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm: Willst du etwa König über uns werden oder dich als Herr über uns aufspielen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und seines Geredes.
Er hatte noch einen anderen Traum. Er erzählte ihn seinen Brüdern und sagte: Ich träumte noch einmal: Die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich tief vor mir. Als er davon seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm: Was soll das, was du da geträumt hast? Sollen wir vielleicht, ich, deine Mutter und deine Brüder, kommen und uns vor dir zur Erde niederwerfen? Seine Brüder waren eifersüchtig, sein Vater aber vergaß die Sache nicht. [IX-194]
Dieser Bericht aus dem Alten Testament zeigt uns eine Situation, in der Träume vom „Laien“ noch unmittelbar verstanden wurden und wo man noch nicht die Hilfe eines professionellen Traumdeuters brauchte, um einen relativ einfachen Traum zu verstehen. (Dass man zum Verständnis eines schwierigeren Traumes einen Fachmann nötig hatte, zeigt die Geschichte von den Träumen des Pharaos, die sogar die Hof-Wahrsager nicht verstehen konnten, sodass man Josef herbeiholen musste.) Die Brüder verstehen sofort, dass der Traum Josefs Phantasievorstellung ausdrückt, dass er eines Tages über seinem Vater und seinen Brüdern stehen werde und dass sie sich in Ehrfurcht vor ihm werden beugen müssen. Zweifellos kommt in diesem Traum Josefs Ehrgeiz zum Ausdruck, ohne den er die hohe Stellung, die er einmal einnehmen sollte, vermutlich nicht erreicht hätte. Aber der Traum bewahrheitet sich. Er war nicht nur Ausdruck irrationalen Ehrgeizes, sondern gleichzeitig eine Voraussage von Ereignissen, die tatsächlich eintrafen. Wie konnte Josef eine solche Voraussage machen? Seine Lebensgeschichte im biblischen Bericht zeigt, dass er nicht nur ein ehrgeiziger, sondern auch ein ungewöhnlich begabter Mann war. Im Traum ist er sich seiner außergewöhnlichen Gaben deutlicher bewusst, als er das im wachen Leben sein konnte, wo er unter dem Eindruck stand, jünger und schwächer als alle seine Brüder zu sein. Der Traum ist eine Mischung aus seinem leidenschaftlichen Ehrgeiz und einer Einsicht in seine Gaben, ohne die er nicht hätte in Erfüllung gehen können.
Eine Voraussage anderer Art ist im folgenden Traum enthalten: A., der eine Zusammenkunft mit B. hatte, um über eine zukünftige Geschäftsverbindung zu verhandeln, hatte einen günstigen Eindruck von B. und war entschlossen, diesen als Teilhaber in sein Geschäft aufzunehmen. In der Nacht nach der Besprechung hatte er folgenden Traum:
Ich sehe B. in unserem gemeinsamen Büro sitzen. Er sieht die Bücher durch und verändert darin Eintragungen, um die Tatsache zu verschleiern, dass er große Geldsummen unterschlagen hat.
A. wacht auf, und da er gewohnt ist, Träumen eine gewisse Beachtung zu schenken, ist er bestürzt. Da er aber der Überzeugung ist, dass Träume stets Ausdruck irrationaler Wünsche sind, sagt er sich, in diesem Traum komme seine eigene Feindseligkeit gegen andere Menschen und sein Konkurrenzneid zum Ausdruck, und diese Feindseligkeit und dieser Argwohn hätten ihm die Vorstellung eingegeben, dass B. ein Dieb sei. Nachdem er den Traum auf diese Weise gedeutet hat, weist er seinen irrationalen Argwohn als unbegründet weit von sich. Als er dann aber die Geschäftsverbindung mit B. eingegangen war, kam es zu einer Reihe von Vorfällen, die seinen Argwohn aufs Neue weckten. Aber er rief sich seinen Traum und dessen Deutung ins Gedächtnis und war wiederum überzeugt, unter dem Einfluss irrationalen Misstrauens und feindseliger Gefühle zu stehen, und beschloss daher, jenen Vorfällen, die seinen Verdacht erregt hatten, keine weitere Beachtung zu schenken. Ein Jahr darauf entdeckte er jedoch, dass B. beträchtliche Summen veruntreut und dies durch falsche Eintragungen in die Bücher vertuscht hatte. Sein Traum hatte sich buchstäblich bewahrheitet.
Die Analyse der Assoziationen von A. zeigte, dass sein Traum einen Einblick in den Charakter von B. zum Ausdruck brachte, den A. bereits bei ihrer ersten Begegnung [IX-195] gewonnen hatte, der ihm aber in seinem wachen Denken nicht bewusst geworden war. Durch jene zahlreichen komplexen Beobachtungen, die wir in Bezug auf andere Menschen im Bruchteil einer Sekunde machen, ohne uns unserer eigenen Denkprozesse bewusst zu werden, hatte A. erkannt, dass B. nicht ehrlich war. Aber da er keinen „Beweis“ dafür hatte und das Verhalten von B. es für das bewusste Denken von A. schwermachte, an die Unehrlichkeit von B. zu glauben, hatte er den Gedanken daran völlig verdrängt, oder – besser gesagt – ihn im wachen Zustand gar nicht erst registriert. Im Traum war er sich dagegen seines Argwohns deutlich bewusst, und er hätte sich großen Ärger ersparen können, wenn er auf diese Mitteilung seines Selbst gehört hätte. Seine Überzeugung, dass Träume stets Ausdruck unserer irrationalen Phantasien und Wünsche seien, war schuld daran, dass er den Traum und sogar gewisse spätere tatsächliche Beobachtungen falsch auslegte.
Einen Traum, in dem der Träumer ein moralisches Urteil fällte, träumte ein Schriftsteller, dem man eine Stellung angeboten hatte, in der er weit mehr als bisher verdient hätte, wo er aber auch gezwungen gewesen wäre, Dinge zu schreiben, an die er nicht glaubte, und wo er somit seine persönliche Integrität verletzt hätte. Immerhin war das Angebot, was Verdienst und Ansehen betraf, so verlockend, dass er sich nicht sicher war, ob er es ablehnen konnte. Er hielt sich alle Rationalisierungen vor Augen, wie sie die meisten Menschen in solchen Fällen erwägen. Er sagte sich, vielleicht sehe er die Situation zu schwarz und werde am Ende gar keine so großen Zugeständnisse machen müssen. Außerdem würde – falls er wirklich nicht schreiben konnte, was er wollte – dieser Zustand nur ein paar Jahre dauern, dann würde er die Stelle wieder aufgeben und soviel Geld verdient haben, dass er fortan völlig unabhängig und frei an eine Arbeit gehen könne, die für ihn sinnvoll wäre. Er dachte auch an seine Freunde und an seine Familie und überlegte sich, was er alles für sie würde tun können. Manchmal kam es ihm sogar vor, als sei es geradezu seine moralische Pflicht, die Stelle anzunehmen, und als wäre es ein Zeichen einer zu sehr auf sich selbst bedachten, egoistischen Haltung, wenn er sie ablehne. Freilich befriedigte ihn keine dieser Rationalisierungen völlig; er war auch weiterhin im Zweifel und konnte sich nicht entschließen, das Angebot anzunehmen, bis er eines Nachts folgenden Traum hatte:
Ich saß in einem Wagen am Fuß eines hohen Berges, wo ein schmaler, überaus steiler Weg anfing, der zum Gipfel hinaufführte. Ich wusste nicht recht, ob ich hinauffahren sollte, da mir der Weg höchst gefährlich vorkam. Aber ein Mann, der neben meinem Wagen stand, sagte zu mir, ich solle nur hinauffahren und keine Angst haben. Ich hörte auf ihn und beschloss, seinem Rat zu folgen. Ich fuhr hinauf, und der Weg wurde immer gefährlicher. Ich konnte jedoch nicht anhalten, weil ich nirgends wenden konnte. Als ich den Gipfel fast erreicht hatte, setzte der Motor aus, die Bremsen versagten, der Wagen rollte den Berg hinab und stürzte in den Abgrund! Voller Entsetzen wachte ich auf.
Zum vollen Verständnis des Traumes ist noch eine Assoziation zu erwähnen. Der Träumer sagte, der Mann, der ihm zugeredet habe, den Berg hinaufzufahren, sei ein ehemaliger Freund gewesen, ein Maler, der „ausverkauft“ habe und ein Mode-Porträtist geworden sei. Damit habe er eine Menge Geld verdient, habe aber seine [IX-196] schöpferischen Fähigkeiten eingebüßt. Er wisse, dass dieser Freund trotz seines Erfolges ein unglücklicher Mensch sei, der darunter leide, dass er an sich selbst Verrat geübt habe. Es fällt nicht schwer, den ganzen Traum zu verstehen. Der steile Berg, den der Mann hinauffahren sollte, drückt symbolisch die erfolgreiche Laufbahn aus, für oder gegen die er sich entscheiden sollte. Im Traum weiß er, dass dieser Weg gefährlich ist. Er weiß, dass er – wenn er das Angebot annimmt – genau das tun wird, was sein ehemaliger Freund getan hat: das, weswegen er diesen verachtet und ihm die Freundschaft gekündigt hat. Er weiß im Traum, dass ein ähnlicher Entschluss ihn nur ins Verderben führen kann. Die Vernichtung bezieht sich im Traumbild auf sein körperliches Selbst, das sein intellektuelles und spirituelles Selbst symbolisiert, das Gefahr läuft, zugrunde gerichtet zu werden.
Der Träumer hat im Schlaf das moralische Problem deutlich gesehen und erkannt, dass er zwischen dem „Erfolg“ und seiner Integrität und seinem Glück wählen muss. Er hat erkannt, was sein Los sein würde, wenn er die falsche Entscheidung träfe. Im wachen Zustand konnte er die Alternative nicht so deutlich erkennen. Das laute Gerede hatte einen solchen Eindruck auf ihn gemacht, dass er sich überlegte, ob es nicht doch töricht sei, sich die Gelegenheit entgehen zu lassen, mehr Geld zu verdienen und mehr Macht und Prestige zu gewinnen. Er stand so sehr unter dem Einfluss all derer, die sagen, es sei kindisch und wirklichkeitsfremd, ein „Idealist“ zu sein, dass er sich in die vielen Rationalisierungen verstrickte, deren man sich zu bedienen pflegt, wenn man die Stimme des Gewissens zum Schweigen bringen will. Dieser spezielle Träumer war sich der Tatsache bewusst, dass wir in unseren Träumen oft mehr wissen als im wachen Zustand, und er wurde durch den Traum so aufgerüttelt, dass die Nebel, die ihm den Blick getrübt hatten, schwanden und er die Alternative jetzt deutlich erkennen konnte. Er entschied sich für seine Integrität und gegen die selbstzerstörerische Versuchung.
Nicht nur Einsichten in unsere Beziehung zu anderen Menschen oder in deren Einstellung zu uns, nicht nur Werturteile und Voraussagen kommen in unseren Träumen vor, auch unsere intellektuellen Leistungen sind gelegentlich denen im wachen Zustand überlegen. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn scharfes Nachdenken erfordert eine Konzentration, die uns im wachen Zustand oft versagt ist, während sie im Schlaf erreicht wird. Das bekannteste Beispiel eines derartigen Traumes ist der Traum Kekulés, des Entdeckers des Benzolrings. Dieser hatte schon geraume Zeit nach der chemischen Formel für Benzol gesucht, und eines Nachts sah er im Traum die richtige Formel vor sich. Glücklicherweise erinnerte er sich beim Erwachen noch daran. Es gibt zahlreiche Beispiele für Menschen, die sich über der Lösung eines mathematischen, technischen, philosophischen oder praktischen Problems den Kopf zerbrechen und die dann die Lösung eines Nachts im Traum vollkommen klar vor sich sehen.
Manchmal stellt man im Traum höchst komplizierte intellektuelle Erwägungen an. Der folgende Traum ist ein Beispiel hierfür, wenn er auch außerdem noch ein sehr persönliches Element enthält. Die Träumerin ist eine intelligente Frau. Sie träumte:
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959120432
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Juni)
- Schlagworte
- Mythen Märchen Psychoanalyse Sozialpsychologie Träume Traumdeutung Symbolsprache Ödipuskomplex Schöpfungsgeschichte