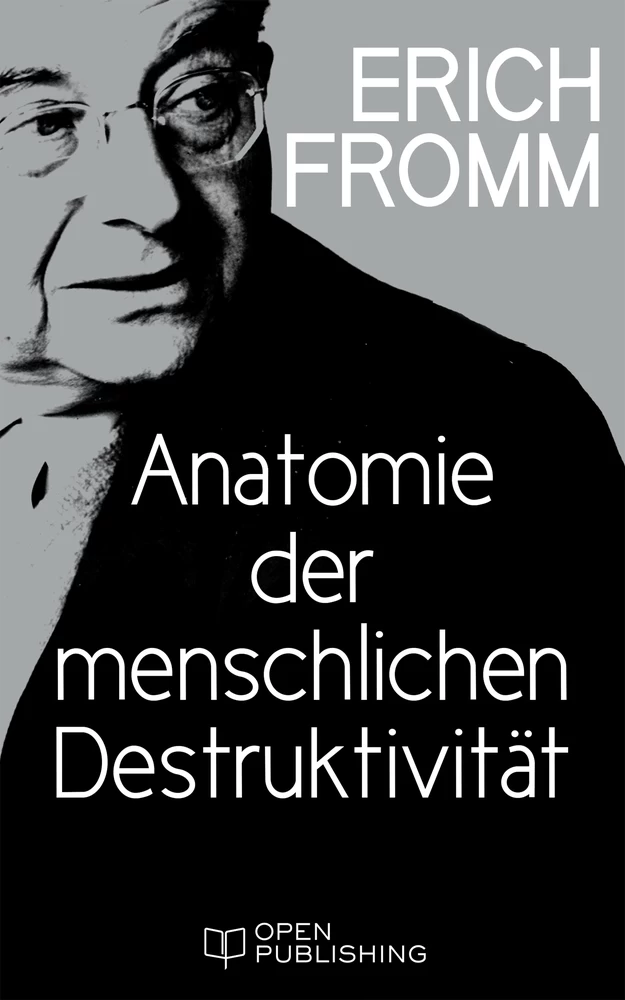Zusammenfassung
Tatsächlich versucht Fromm auf der einen Seite, anhand von zahlreichen wissenschaftlichen Erkenntnissen seinen humanistischen Glauben an den Menschen gegenüber allen Verteufelungen des Menschen durch einen angeborenen Destruktionstrieb zu verteidigen. Andererseits ist es ihm wichtig, bei der Diskussion um die menschliche Aggression auf eine Besonderheit hinzuweisen: nur beim Menschen gibt es eine charakterbedingte Grausamkeit und Nekrophilie, deren Entstehungs- und Wirkungsweise Fromm im einzelnen darlegt.
Das Buch analysiert nicht nur diese besonderen Arten der Destruktivität, sondern illustriert sie auch an einzelnen Menschen. So enthält das Buch ein Kapitel über Stalin, Himmler und Hitler, wobei ihm Hitler als Fallbeispiel für einen nekrophil-destruktiven Charakter dient. Darüber hinaus macht dieses Buch wie kein anderes deutlich, wie Fromm sich das Zusammenspiel von individuellen und sozialpsychologischen Faktoren bei der Genese des Charakters konkret vorstellt und wie er zu klinischen Urteilen kommt, ohne dabei auf die Freudsche Triebtheorie zurück zu greifen.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Anatomie der menschlichen Destruktivität
- Inhalt
- Vorwort
- Terminologie
- Einleitung: Die Instinkte und die menschlichen Leidenschaften
- Erster Teil Instinkt- und Trieblehren, Behaviorismus, Psychoanalyse
- 1. Vertreter der Instinkt- und Trieblehren
- Ältere Instinkt- und Triebforscher
- Neuere Instinkt- und Triebforscher: Sigmund Freud und Konrad Lorenz
- 2. Die Vertreter der Milieutheorie und die Behavioristen
- Die Milieutheorie der Aufklärung
- Der Behaviorismus
- B. F. Skinners Neobehaviorismus
- Behaviorismus und Aggression
- Über psychologische Experimente
- Die Frustrations-Aggressions-Theorie
- 3. Triebtheorien und Behaviorismus – ihre Unterschiede und Ähnlichkeiten
- Gemeinsamkeiten
- Neuere Auffassungen
- Der politische und gesellschaftliche Hintergrund beider Theorien
- 4. Der psychoanalytische Weg zum Verständnis der Aggression
- Zweiter Teil Befunde, die gegen die Thesen der Instinkt- und Triebforscher sprechen
- 5. Neurophysiologie
- Die Beziehung zwischen Psychologie und Neurophysiologie
- Das Gehirn als Grundlage für aggressives Verhalten
- Die Defensivfunktion der Aggression
- Das Verhalten von Raubtieren und die Aggression
- 6. Das Verhalten der Tiere
- Die Aggression in der Gefangenschaft
- Die Aggression in der freien Natur
- Territorialismus und Dominanz
- Die Aggressivität anderer Säugetiere
- 7. Paläontologie
- Ist der Mensch eine Art?
- Ist der Mensch ein Raubtier?
- 8. Anthropologie
- „Der Mensch als Jäger“ – der anthropologische Adam?
- Waren die primitiven Jäger eine Wohlstandsgesellschaft?
- Die Kriegführung der Primitiven
- Die neolithische Revolution
- Prähistorische Gesellschaften und die „menschliche Natur“
- Die städtische Revolution
- Die Aggressivität in primitiven Kulturen
- Analyse von dreißig primitiven Stämmen
- Hinweise auf Destruktivität und Grausamkeit
- Dritter Teil Die verschiedenen Arten der Aggression und Destruktivität und ihre jeweiligen Voraussetzungen
- 9. Die gutartige Aggression
- Vorbemerkungen
- Die Pseudoaggression
- Die defensive Aggression
- 10. Die bösartige Aggression: Prämissen
- Vorbemerkungen
- Die Natur des Menschen
- Die existenziellen Bedürfnisse des Menschen und die verschiedenen, in seinem Charakter verwurzelten Leidenschaften
- Die Voraussetzungen für die Entwicklung der charakterbedingten Leidenschaften
- 11. Die bösartige Aggression: Grausamkeit und Destruktivität
- Scheinbare Destruktivität
- Spontane Formen
- Der destruktive Charakter: Sadismus
- 12. Die bösartige Aggression: Die Nekrophilie
- Der traditionelle Begriff
- Der nekrophile Charakter
- Nekrophilie und die Vergötterung der Technik
- Hypothese über den Inzest und den Ödipuskomplex
- Die Beziehung von Freuds Lebens- und Todestrieb zur Biophilie und Nekrophilie
- Hinweise zur Diagnose „Nekrophilie“
- 13. Bösartige Aggression: Adolf Hitler – ein klinischer Fall von Nekrophilie
- Vorbemerkungen
- Hitlers Eltern und frühe Kindheit
- Bemerkungen zur Methode
- Hitlers Destruktivität
- Die Verdrängung der Destruktivität
- Andere Aspekte von Hitlers Persönlichkeit
- Epilog: Über die Zwiespältigkeit der Hoffnung
- Hinweise zur Übersetzung
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Vorwort
Diese Untersuchung ist der erste Band einer umfassenden Arbeit über die psychoanalytische Theorie.[1] Ich habe mit der Untersuchung der Aggression und Destruktivität nicht nur deshalb angefangen, weil sie zu den grundlegenden theoretischen Problemen der Psychoanalyse gehört, sondern weil die Welle der Destruktivität, die die Welt überschwemmt, diese Untersuchung auch auf praktischem Gebiet höchst bedeutungsvoll erscheinen lässt.[2]
Als ich mit der Niederschrift dieses Buches vor über sechs Jahren anfing, habe ich die Schwierigkeiten, auf die ich stoßen würde, weit unterschätzt. Es stellte sich bald heraus, dass ich die menschliche Destruktivität nicht adäquat behandeln konnte, wenn ich innerhalb der Grenzen meines eigentlichen Fachgebietes, der Psychoanalyse, blieb. Obwohl diese Untersuchung in erster Linie eine psychoanalytische sein soll, brauchte ich doch auch gewisse Kenntnisse auf anderen Gebieten, besonders auf dem der Neurophysiologie, der Tierpsychologie, der Paläontologie und der Anthropologie, um nicht in einem zu engen und daher verzerrenden Bezugsrahmen arbeiten zu müssen. Zumindest musste ich meine eigenen Schlussfolgerungen mit den wichtigsten Daten aus anderen Wissensgebieten vergleichen, um sicherzugehen, dass meine Hypothesen nicht im Widerspruch zu ihnen standen, und um feststellen zu können, ob diese – wie ich hoffte – meine Hypothesen bestätigten.
Da bis dahin keine Arbeit existierte, die über die Ergebnisse der Aggressionsforschung auf all diesen Gebieten berichtete und Zusammenhänge herstellte oder sie auch nur auf einem Spezialgebiet zusammenfassend behandelte, musste ich selbst diesen Versuch unternehmen. Ich gedachte auch meinen Lesern einen Dienst zu erweisen, wenn ich ihnen die Möglichkeit bot, mit mir zusammen das Problem der Destruktivität von einem globalen Standpunkt anstatt vom Standpunkt einer einzigen Disziplin aus zu betrachten. Ein solcher Versuch hat natürlich seine Gefahren. Es ist klar, dass ich mir nicht auf all diesen Gebieten die nötige Kompetenz erwerben konnte, am wenigsten auf dem der Neurologie, für das ich nur geringe Kenntnisse mitbrachte. Ein gewisses Maß an Wissen auf diesem Gebiet konnte ich mir aneignen, nicht nur durch eigene Studien, sondern auch durch die [VII-XIV] freundliche Unterstützung einiger Neurologen, die mir nützliche Hinweise gaben, meine vielen Fragen beantworteten und von denen einige den betreffenden Teil des Manuskripts durchgesehen haben![3] Es ist kaum nötig hinzuzufügen, dass, besonders auf dem Gebiet der Paläontologie und Anthropologie, häufig keine Einigkeit unter den Spezialisten besteht. Ich habe mich, nach angemessenem Studium aller Meinungen, auf diejenigen gestützt, die entweder von den meisten Autoren anerkannt sind oder die mich durch ihre Logik am meisten überzeugten, und endlich diejenigen, die am wenigsten von den herrschenden Vorurteilen beeinflusst zu sein scheinen. Die Kontroversen ausführlich darzustellen und zu belegen, hätte den Rahmen dieses Buches gesprengt; aber ich habe versucht, soweit als möglich widersprechende Ansichten zu zitieren und mich mit ihnen kritisch auseinanderzusetzen. Wenn Spezialisten feststellen sollten, dass ich ihnen auf ihrem Fachgebiet nichts Neues zu bieten habe, so werden sie vielleicht doch die Gelegenheit begrüßen, anhand der Daten aus anderen Forschungsgebieten über einen Gegenstand von so zentralem Interesse besser informiert zu werden.
Ein unlösbares Problem sind die Wiederholungen und Überschneidungen mit meinen früheren Arbeiten. Ich arbeite an den Problemen der Analyse des Einzelnen und der Gesellschaft nun schon seit über 40 Jahren[4] und habe mich immer wieder auf neue Gebiete konzentriert, während ich gleichzeitig meine Einsichten in ältere Forschungsgebiete vertiefte und erweiterte. Es ist mir unmöglich, über die menschliche Destruktivität zu schreiben, ohne auf Gedanken zurückzugreifen, die ich schon früher geäußert habe, die aber für das Verständnis der neuen Auffassungen, die in diesem Buch entwickelt werden, unentbehrlich sind. Ich habe versucht, Wiederholungen nach Möglichkeit auszuschalten, indem ich auf die ausführlichere Behandlung in früheren Veröffentlichungen verwies; doch waren solche Wiederholungen trotzdem nicht ganz zu vermeiden. Ein besonderes Problem stellt in dieser Hinsicht mein Buch Die Seele des Menschen (1964a) dar, in dem einige meiner neuen Ergebnisse über Nekrophilie und Biophilie bereits im Kern enthalten sind. Ich habe im vorliegenden Buch die Darstellung dieser Ergebnisse sowohl auf theoretischem Gebiet als auch hinsichtlich der klinischen Beispiele stark erweitert. Auf gewisse Unterschiede zwischen den hier und in früheren Veröffentlichungen vertretenen Ansichten bin ich nicht weiter eingegangen, da eine solche Diskussion zuviel Raum beansprucht hätte und für die meisten Leser nicht interessant genug sein dürfte. Es bleibt mir nur noch die angenehme Aufgabe, all denen zu danken, die mir geholfen haben, dieses Buch zu schreiben, vor allem Dr. Jerome Brams, dem ich besonders verpflichtet bin, da er mir bei der theoretischen Klarstellung der Probleme des Behaviorismus und bei der Suche nach relevanter Literatur unermüdlich half.
Dr. Juan de Dios Hernández danke ich für seine Hilfe, die meine neurophysiologischen Studien erleichterte. In stundenlangen Diskussionen klärte er viele Probleme, informierte mich über die umfangreiche Literatur und hat die Teile meines Manuskripts, die sich mit den Problemen der Neurophysiologie befassen, kommentiert.
Bei folgenden Neurologen möchte ich mich bedanken, die mir durch zum Teil ausgedehnte persönliche Unterhaltungen und Briefe halfen: bei dem verstorbenen Dr. Raul Hernández Peón, bei Dr. Robert B. Livingston, Dr. Robert G. Heath, Dr. Heinz von Foerster und Dr. Theodore Melnechuk, der die neurophysiologischen Teile meines Manuskripts ebenfalls durchgelesen hat. Bei Dr. Francis O. Schmitt möchte ich mich dafür [VII-XV] bedanken, dass er eine Konferenz mit den Mitgliedern des Neurosciences Research Program des Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) für mich arrangierte, auf der die Mitglieder die Fragen diskutierten, die ich an sie richtete. Ich danke Albert Speer, der mündlich und schriftlich viel zur Bereicherung meines Bildes von Hitler beitrug. Auch Dr. Robert M. W. Kempner bin ich für Informationen verbunden, die er sich im Verlauf seiner Tätigkeit als einer der amerikanischen Ankläger bei den Nürnberger Prozessen erwarb.
Ich möchte ferner Dr. David Schecter, Dr. Michael Maccoby und Gertrud Hunziker-Fromm dafür danken, dass sie das Manuskript lasen, ebenso für ihre wertvolle Kritik und ihre konstruktiven Vorschläge, Dr. Ivan Illich und Dr. Ramon Xirau für ihre hilfreichen Anregungen auf philosophischem Gebiet, Dr. W. A. Mason für seine Bemerkungen auf dem Gebiet der Tierpsychologie, Dr. Helmuth de Terra für seine hilfreichen Kommentare zu den Problemen der Paläontologie, Max Hunziker für seine wertvollen Anregungen bezüglich des Surrealismus und Heinz Brandt für seine wichtigen Informationen und Hinweise über die Praktiken des Naziterrors. Auch Dr. Kalinkowitz bin ich für sein aktives und ermutigendes Interesse an meiner Arbeit verbunden. Ferner bedanke ich mich bei Dr. Illich und Miss Valentina Boresman für ihre freundliche Unterstützung bei der Benutzung der bibliographischen Einrichtungen des Center for Intercultural Documentation in Cuernavaca, Mexiko. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch Mrs. Beatrice H. Mayer meinen warmen Dank aussprechen. Sie hat über 20 Jahre lang die vielen Versionen meiner verschiedenen Manuskripte einschließlich des gegenwärtigen immer wieder neu getippt und hat sie außerdem mit großem Einfühlungsvermögen, Verständnis und einer höchst gewissenhaften Behandlung der sprachlichen Formulierungen mit vielen eigenen wertvollen Anregungen redigiert.
Während der Monate, die ich im Ausland verbrachte, hat Mrs. Joan Hughes sich auf höchst kompetente und konstruktive Weise meines Manuskriptes angenommen, wofür ich ihr meinen Dank aussprechen möchte.
Auch Mr. Joseph Cunneen von Holt, Rinehart & Winston möchte ich für seine vorzügliche und gewissenhafte Arbeit als Lektor und seine konstruktiven Vorschläge danken. Ich danke außerdem der verantwortlichen Lektorin, Mrs. Lorraine Hill, und den Herstellungsleitern, Mr. Wilson R. Gathings und Miss Cathie Fallin, für die geschickte und sorgfältige Koordination der Manuskripte in ihren verschiedenen Stadien. Schließlich bin ich noch Marion Odomirok für ihre gewissenhafte und kompetente Redaktionsarbeit zu großem Dank verpflichtet.
Diese Forschungsarbeit wurde zum Teil unterstützt vom Public Health Service Grant No. MH 13144-01, MH 13144-02 des National Institute of Mental Health. Ich möchte mich auch für die Unterstützung durch die Albert and Mary Lasker Foundation bedanken, die mir die Einstellung eines Assistenten ermöglichte.
New York, Mai 1973
E. F.
Terminologie
Der vieldeutige Gebrauch des Wortes „Aggression“ hat in der umfangreichen Literatur zu diesem Thema große Verwirrung hervorgerufen. Man wandte diesen Ausdruck auf das Verhalten eines Menschen an, der sein Leben gegen einen Angriff verteidigt, auf einen Räuber, der sein Opfer tötet, um zu Geld zu kommen, auf einen Sadisten, der einen Gefangenen foltert. Ja, die Verwirrung geht noch weiter: Man benutzte diesen Begriff für das sexuelle Verhalten des männlichen Geschlechtspartners, für die vorwärtsdrängenden Impulse des Bergsteigers oder Kaufmanns und für den Bauern, der seinen Acker pflügt. Vielleicht ist diese Verwirrung auf den Einfluss des behavioristischen Denkens in der Psychologie und Psychiatrie zurückzuführen. Wenn man sämtliche „schädigenden“ Akte als Aggression bezeichnet, das heißt alle Akte, die sich schädigend oder zerstörend auf ein lebloses Objekt, auf eine Pflanze, ein Tier oder einen Menschen auswirken – dann ist natürlich die Art des hinter dem schädigenden Akt stehenden Impulses völlig irrelevant. Wenn Akte, die auf Zerstörung gerichtet sind, Akte, die beschützen sollen, und Akte, deren Absicht konstruktiv ist, mit ein und demselben Wort bezeichnet werden, kann man freilich alle Hoffnung aufgeben, ihre „Ursache“ zu verstehen; sie haben keine gemeinsame Ursache, da es sich um völlig verschiedenartige Phänomene handelt, und man befindet sich in einer theoretisch hoffnungslosen Position, wenn man versucht, hinter die Ursache der „Aggression“ zu kommen.[5]
Nehmen wir zum Beispiel Lorenz; er verstand ursprünglich unter Aggression einen biologisch notwendigen[6], im Laufe der Evolution entwickelten Impuls, der im Dienste des Überlebens des Einzelwesens und der Art steht. Aber da er den Begriff „Aggression“ auch auf Blutdurst und Grausamkeit anwandte, folgt daraus, dass diese irrationalen Leidenschaften ebenfalls angeboren sind. Da angenommen wird, dass die Ursache der Kriege die [VII-XVIII] Lust am Töten ist, so ist die weitere Konsequenz, dass die Kriege durch eine der menschlichen Natur angeborene destruktive Neigung verursacht werden. Das Wort „Aggression“ dient dabei als bequeme Brücke, die die biologisch notwendige Aggression (die nicht böse ist) mit der zweifellos bösen menschlichen Destruktivität verbindet. Im Grunde läuft diese „Argumentation“ auf folgende Schlussfolgerung hinaus:
Biologisch notwendige Aggression = angeboren
Destruktivität und Grausamkeit = Aggression
Ergo: Destruktivität und Grausamkeit = angeboren, q. e. d.[7]
Ich habe in diesem Buch den Begriff „Aggression“ für reaktive und defensive Aggression benutzt, die ich zusammenfassend als „gutartige Aggression“ bezeichne. Die spezifisch menschliche Leidenschaft zu zerstören und absolute Kontrolle über ein Lebewesen zu haben (die „bösartige Aggression“) dagegen bezeichne ich als „Destruktivität“ und „Grausamkeit“. An Stellen, an denen ich es für nötig hielt, in einem bestimmten Kontext den Begriff „Aggression“ in einem anderen Sinn als dem der reaktiven und Verteidigungs-Aggression zu verwenden, habe ich dies zur Vermeidung von Missverständnissen ausdrücklich angegeben.[8]
Ich habe ganz allgemein, wenn vom Menschen die Rede ist, nicht „er und sie“, sondern „er“ gesagt, da mir dies weniger umständlich scheint. Ich spreche zwar dem einzelnen Wort große Bedeutung zu, doch meine ich andererseits, dass man keinen Fetisch daraus machen und sich auch nicht mehr für das Wort als für die dahinter stehende Idee interessieren sollte. Dass ich nicht aus Zuneigung zum patriarchalischen Prinzip so formuliere, sollte aus dem Inhalt dieses Buches zweifelsfrei hervorgehen.
Im Interesse einer sorgfältigen Dokumentation sind bei Zitaten grundsätzlich der Name des Autors und das Erscheinungsjahr angegeben. Hierdurch soll der Leser in die Lage versetzt werden, weitere Informationen in der Bibliographie zu finden. Daher beziehen sich die angegebenen Daten auch nicht in allen Fällen auf die Erstveröffentlichung eines Werkes, wie zum Beispiel bei dem Spinoza-Zitat (1927).
Die sich ablösenden Generationen werden immer schlechter.
Es wird die Zeit kommen, in der sie so böse geworden sind,
dass sie die Macht anbeten;
Macht wird dann Recht für sie sein, und die Ehrfurcht
vor dem Guten wird aufhören.
Zuletzt, wenn niemand sich mehr über Untaten empört
oder angesichts der Unglücklichen Scham empfindet,
wird Zeus auch sie vernichten.
Und doch könnte selbst dann noch etwas dagegen getan werden,
wenn sich nur das einfache Volk erheben
und die Tyrannen stürzen würde, die es unterdrücken.
Griechischer Mythos über das Eiserne Zeitalter
Wenn ich mir die Geschichte ansehe, bin ich Pessimist,
aber wenn ich mir die Vorgeschichte ansehe, bin ich Optimist.
J. C. Smuts
Einerseits ist der Mensch mit vielen Tierarten insofern verwandt,
als er mit seinen eigenen Artgenossen kämpft.
Andererseits jedoch ist er unter den Tausenden von Arten,
die Kämpfe ausfechten, der einzige, bei dem diese Kämpfe
zerstörend wirken.
Die menschliche Spezies ist als einzige eine Spezies von Massenmördern,
und der Mensch ist das einzige Wesen,
das seiner eigenen Gesellschaft nicht angepasst ist.
N. Tinbergen
Einleitung:
Die Instinkte und die menschlichen Leidenschaften
Die ständig zunehmende Gewalttätigkeit und Destruktivität auf der ganzen Welt lenkte die Aufmerksamkeit der Fachwelt wie der breiten Öffentlichkeit auf die theoretische Erforschung des Wesens und der Ursachen der Aggression. Ein solches Interesse ist nicht erstaunlich; erstaunlich ist nur, dass es so neuen Datums ist, besonders da ein so überragender Forscher wie Freud nach der Revision seiner früheren Theorie, in deren Mittelpunkt der Sexualtrieb stand, seit den Zwanzigern eine neue Theorie aufgestellt hatte, in welcher der leidenschaftliche Drang zu zerstören („Todestrieb“) als ebenso mächtig angesehen wurde wie die Leidenschaft zu lieben („Lebenstrieb“, „Sexualität“). Die Öffentlichkeit jedoch sah auch weiterhin in der Freudschen Schule die Richtung, welche die Libido als die zentrale Leidenschaft des Menschen darstellt, die nur vom Selbsterhaltungstrieb in Schranken gehalten wird.
Diese Situation änderte sich erst Mitte der sechziger Jahre. Einer der Gründe für diesen Wandel dürfte darin zu suchen sein, dass das Ausmaß der Gewalt und der Angst vor dem Krieg in aller Welt eine gewisse Schwelle überschritten hatte. Aber auch die Veröffentlichung einiger Bücher, die sich mit der menschlichen Aggression befassen, hat dazu beigetragen, besonders Das sogenannte Böse von Konrad Lorenz (1963). Lorenz, ein prominenter Gelehrter auf dem Gebiet der tierischen Verhaltensforschung[9], besonders im Bereich des Verhaltens von Fischen und Vögeln, beschloss, sich auf ein Gebiet vorzuwagen, auf dem er wenig Erfahrung und Kompetenz besaß, auf das des menschlichen Verhaltens. Obwohl die meisten Psychologen und Neurologen es ablehnten, wurde Das sogenannte [VII-002] Böse ein Bestseller und hinterließ bei einem großen Teil des gebildeten Publikums einen tiefen Eindruck. Viele sahen in den Ansichten von Lorenz die endgültige Lösung des Problems.
Der große Erfolg der Ideen von Lorenz war nicht zuletzt durch frühere Veröffentlichungen eines Autors ganz anderer Art vorbereitet worden, Robert Ardrey (African Genesis, 1961, deutscher Titel: Adam kam aus Afrika, 1967; und The Territorial Imperative, 1966, deutscher Titel: Adam und sein Revier, 1968). Ardrey, ein begabter Bühnenautor, aber kein Wissenschaftler, verflocht eine Fülle von Daten über die Anfänge des Menschen zu einem beredten, aber höchst tendenziösen Plädoyer für die angeborene Aggressivität des Menschen. Auf dieses Buch folgten Bücher anderer Tier-Verhaltensforscher, wie zum Beispiel The Naked Ape, 1967, deutscher Titel: Der nackte Affe, 1968, von Desmond Morris und Liebe und Hass, 1970, von dem Lorenz-Schüler Irenäus Eibl-Eibesfeld.
Alle diese Werke enthalten im Grunde die gleiche These: Das aggressive Verhalten des Menschen, wie es sich in Krieg, Verbrechen, persönlichen Streitigkeiten und in allen Arten destruktiven und sadistischen Verhaltens manifestiert, entspringt einem phylogenetisch programmierten, angeborenen Instinkt, der sich zu entladen sucht und auf den geeigneten Anlass wartet, sich Ausdruck zu verschaffen.
Vielleicht hatte Lorenz mit seinem Neo-Instinktivismus nicht deshalb soviel Erfolg, weil seine Argumente so stichhaltig sind, sondern weil die Leute so empfänglich für sie sind. Was könnte für Menschen, die sich fürchten und die sich unfähig fühlen, den zur Zerstörung führenden Lauf der Dinge zu ändern, willkommener sein als eine Theorie, die uns versichert, dass die Gewalt aus unserer tierischen Natur kommt, einem unzähmbaren Trieb zur Aggression entspringt und dass wir – wie Lorenz behauptet – nichts Besseres tun können, als das Evolutionsgesetz zu verstehen, auf das die Macht dieses Triebes zurückzuführen ist. Diese Theorie von einer angeborenen Aggressivität wird leicht zur Ideologie, die uns hilft, die Angst vor dem zu beschwichtigen, was zu geschehen droht, und das Gefühl der Machtlosigkeit zu rationalisieren.
Es gibt noch andere Gründe, dieser simplifizierenden Lösung einer instinktivistischen Theorie den Vorzug zu geben vor einer Untersuchung der Ursachen der Destruktivität. Für eine solche Untersuchung müssten wir die grundlegenden Prämissen gängiger Ideologie in Frage stellen. Wir kämen nicht umhin, die Irrationalität unseres gesellschaftlichen Systems zu analysieren und Tabus zu verletzen, die sich hinter hochheiligen Begriffen wie „Verteidigung“, „Ehre“ und „Patriotismus“ verbergen. Nur eine in die Tiefe gehende Analyse unseres gesellschaftlichen Systems kann die Ursachen für die Zunahme der Destruktivität erschließen und Mittel und Wege zeigen, sie zu reduzieren. Die instinktivistische Theorie erbietet sich, uns die schwere Aufgabe einer solchen Analyse zu ersparen. Sie besagt, dass wir – selbst wenn wir alle zugrunde gehen müssen – dies wenigstens in der Überzeugung tun können, dass unsere „Natur“ uns dieses Schicksal aufgezwungen hat, und dass wir verstehen, wieso alles kommen musste wie es kam.
Bei der derzeitigen Ausrichtung des psychologischen Denkens erwartet man von einer Kritik an Lorenz’ Theorie von der menschlichen Aggression, dass sie sich in den Behaviorismus einfügt, die andere Theorie, die in der Psychologie eine dominierende Stellung einnimmt. Im Gegensatz zum Instinktivismus interessiert sich die behavioristische Theorie nicht für die subjektiven Kräfte, die den Menschen dazu treiben, sich in einer bestimmten [VII-003] Weise zu verhalten; sie befasst sich nicht mit dem, was er fühlt, sondern nur mit der Art, wie er sich verhält, und mit der sozialen Konditionierung, die sein Verhalten formt.
Erst in den zwanziger Jahren vollzog sich die radikale Umorientierung der Psychologie vom Fühlen auf das Verhalten, wobei die Emotionen und Leidenschaften in der Folgezeit von vielen Psychologen als – wenigstens vom wissenschaftlichen Standpunkt aus – irrelevante Daten aus ihrem Blickfeld verbannt wurden. Gegenstand der vorherrschenden Richtung innerhalb der Psychologie wurde das Verhalten und nicht der sich verhaltende Mensch: Die „Wissenschaft von der Psyche“ wurde in die Wissenschaft von der Manipulation tierischen und menschlichen Verhaltens umgewandelt. Diese Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt im Neo-Behaviorismus Skinners, der heute die auf den Universitäten der Vereinigten Staaten am weitesten anerkannte psychologische Theorie ist.
Der Grund für diesen Umschwung innerhalb der Psychologie ist leicht zu finden. Wer sich mit der Erforschung des Menschen befasst, steht mehr als jeder andere Wissenschaftler unter dem Einfluss der gesellschaftlichen Atmosphäre. Das kommt daher, dass nicht nur – wie in den Naturwissenschaften – seine Denkweise, seine Interessen und die von ihm gestellten Fragen sämtlich auch gesellschaftlich determiniert sind, sondern in seinem Fall auch der Forschungsgegenstand selbst, der Mensch. Immer wenn ein Psychologe vom Menschen spricht, sind die Menschen seiner Umgebung sein Modell – vor allem aber ist er es selbst. In der heutigen Industriegesellschaft sind die Menschen zerebral orientiert, sie fühlen wenig; Emotionen sind für sie unnützer Ballast – sowohl die Emotionen der Psychologen als auch die ihrer Forschungsobjekte. Die behavioristische Theorie scheint das Richtige für sie zu sein.
Die derzeitige Alternative zwischen Instinktivismus und Behaviorismus ist dem theoretischen Fortschritt nicht förderlich. Beide Positionen sind „monoexplanatorisch“, sie gründen sich auf dogmatisch vorgefasste Meinungen, und von den Forschern wird verlangt, ihre Befunde entweder der einen oder der anderen Theorie einzupassen. Aber stehen wir wirklich vor der Alternative, entweder die instinktivistische oder die behavioristische Theorie akzeptieren zu müssen? Sind wir gezwungen, zwischen Lorenz und Skinner zu wählen? Gibt es keine anderen Möglichkeiten? In diesem Buch wird die Meinung vertreten, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt, und es wird untersucht, worin sie besteht.
Wir müssen beim Menschen zwei völlig verschiedene Arten der Aggression unterscheiden. Die erste Art, die er mit allen Tieren gemein hat, ist ein phylogenetisch programmierter Impuls anzugreifen (oder zu fliehen), sobald lebenswichtige Interessen bedroht sind. Diese defensive, „gutartige“ Aggression dient dem Überleben des Individuums und der Art; sie ist biologisch angepasst und erlischt, sobald die Bedrohung nicht mehr vorhanden ist. Die andere Art, die „bösartige“ Aggression, das heißt die Destruktivität und Grausamkeit, ist spezifisch für den Menschen und fehlt praktisch bei den meisten Säugetieren; sie ist nicht phylogenetisch programmiert und nicht biologisch angepasst; sie dient keinem Zweck, und ihre Befriedigung ist lustvoll. Der größte Teil der früheren Diskussion über dieses Thema war dadurch beeinträchtigt, dass versäumt wurde, zwischen diesen beiden Arten von Aggression zu unterscheiden, die verschiedener Herkunft sind und verschiedene Merkmale haben.
Die defensive Aggression gehört tatsächlich zur menschlichen Natur, wenn es sich dabei [VII-004] auch nicht um einen „angeborenen“[10] Instinkt handelt, als welchen man sie zu klassifizieren pflegte. Soweit Lorenz von Aggression als Verteidigung spricht, hat er recht mit seiner Annahme, dass es sich um einen aggressiven Instinkt handelt (wenngleich die Theorie von der Spontaneität des Triebs und seiner Eigenschaft, sich selbst aufzuladen, unhaltbar ist). Aber Lorenz geht weiter. Mit Hilfe einer Reihe scharfsinniger Konstruktionen betrachtet er jede menschliche Aggression, einschließlich des Drangs zu töten und zu quälen, als Auswirkung einer biologisch vorgegebenen Aggression, die sich auf Grund einer Reihe verschiedener Faktoren aus einer nützlichen in eine destruktive Kraft verwandelt hat. Es sprechen jedoch so viele empirische Daten gegen diese Hypothese, dass sie praktisch unhaltbar wird. Das Studium von Tieren zeigt, dass die Säugetiere – und besonders die Primaten – zwar ein gutes Maß defensiver Aggression besitzen, aber keine Mörder und Folterer sind. Die Paläontologie, die Anthropologie und die Geschichte liefern zahlreiche Beweise gegen die instinktivistische These: 1.) menschliche Gruppen unterscheiden sich in Bezug auf den Grad ihrer Destruktivität grundlegend voneinander, ein Tatbestand, den man kaum mit der Annahme erklären kann, dass Destruktivität und Grausamkeit angeboren sind; 2.) verschiedene Grade von Destruktivität können mit jeweils anderen psychischen Faktoren und mit Unterschieden in der jeweiligen Gesellschaftsstruktur in Korrelation gebracht werden, und 3.) wächst der Grad der Destruktivität mit der fortschreitenden Entwicklung der Zivilisation und nicht umgekehrt. Tatsächlich passt das Bild von der angeborenen Destruktivität viel besser zur Geschichte als zur Vorgeschichte. Wäre der Mensch nur mit der biologisch adaptiven Aggression ausgestattet, die er mit seinen tierischen Vorfahren gemein hat, so wäre er ein relativ friedliches Wesen; wenn es unter den Schimpansen Psychologen gäbe, würden diese in der Aggression kaum ein beunruhigendes Problem sehen, über das sie Bücher schreiben sollten.
Der Mensch unterscheidet sich jedoch vom Tier dadurch, dass er ein Mörder ist. Er ist der einzige Primat, der seine Artgenossen ohne biologischen oder ökonomischen Grund tötet und quält und der dabei Befriedigung empfindet. Es ist diese biologisch nicht angepasste und nicht phylogenetisch programmierte „bösartige“ Aggression, die das wirkliche Problem und die Gefahr für das Fortleben der Spezies Mensch ist, und das hauptsächliche Ziel dieses Buches ist es, das Wesen und die Bedingungen dieser destruktiven Aggression zu analysieren.
Die Unterscheidung zwischen gutartig-defensiver und bösartig-destruktiver Aggression verlangt nach einer weiteren, grundsätzlicheren Unterscheidung, nämlich der zwischen Instinkt[11] und Charakter oder – genauer gesagt – zwischen den in physiologischen Bedürfnissen verwurzelten (organischen) Trieben und jenen spezifisch menschlichen Leidenschaften, die in seinem Charakter verwurzelt sind („charakterbedingte oder menschliche Leidenschaften“).[12] Die Unterscheidung zwischen Instinkt und Charakter wird im Weiteren ausführlich behandelt. Ich werde zu zeigen versuchen, dass der Charakter die „zweite Natur“ des Menschen ist, der Ersatz für seine nur schwach entwickelten Instinkte; dass die menschlichen Leidenschaften Antworten auf „existenzielle Bedürfnisse“ sind, die [VII-005] ihrerseits in den spezifischen Bedingungen der menschlichen Existenz begründet sind. Kurz, dass Instinkte Antworten auf die physiologischen Bedürfnisse des Menschen sind, dass aber seine im Charakter verwurzelten Leidenschaften (wie der Drang nach Liebe, Zärtlichkeit, Freiheit, Zerstörungslust, Sadismus, Masochismus, die Gier nach Macht und Besitz) Antworten auf seine existenziellen Bedürfnisse und spezifisch menschlich sind. Während die existenziellen Bedürfnisse die gleichen für alle Menschen sind, unterscheiden sich Individuen und Gruppen in Bezug auf die in ihnen jeweils vorherrschenden Leidenschaften. Um ein Beispiel zu geben: Der Mensch kann von der Liebe oder von der Leidenschaft getrieben werden, zu zerstören; in beiden Fällen befriedigt er eines seiner existenziellen Bedürfnisse: das Bedürfnis, etwas zu „bewirken“, jemand zu bewegen. Ob die beherrschende Leidenschaft eines Menschen Liebe oder Zerstörungsdrang ist, hängt weitgehend von den sozialen Umständen ab; diese Umstände wirken jedoch auf die biologisch vorgegebene existenzielle Situation des Menschen und auf die daraus entstehenden Bedürfnisse ein und nicht, wie die Vertreter der Milieutheorie behaupten, auf eine unbegrenzt formbare undifferenzierte Psyche.
Wenn wir jedoch erkennen wollen, welches die Bedingungen der menschlichen Existenz sind, erheben sich weitere Fragen: Was ist das Wesen des Menschen? Wodurch ist der Mensch Mensch? Es braucht kaum gesagt zu werden, dass der gegenwärtige Trend in den Sozialwissenschaften für die Diskussion solcher Probleme nicht sehr günstig ist. Man hält sie weithin für Themen, die Philosophie und Religion angehen; das positivistische Denken behandelt sie als rein subjektive Spekulationen ohne jeden Anspruch auf objektive Gültigkeit. Da es nicht zweckmäßig wäre, an dieser Stelle die komplexe Argumentation vorwegzunehmen, die auf Fakten beruht, die ich später anführe, will ich mich auf wenige Hinweise beschränken. Der Standpunkt, von dem aus ich diese Probleme hier erörtere, ist ein soziobiologischer. Die Grundvoraussetzung ist, dass, da die Spezies Homo sapiens anatomisch, neurologisch und physiologisch definiert werden kann, wir auch in der Lage sein sollten,[13] den Menschen psychisch als Gattungswesen zu definieren. In dem Versuch, das Wesen des Menschen zu bestimmen, beziehen wir uns nicht auf eine Abstraktion, zu der man auf dem Wege metaphysischer Spekulationen gelangt, wie etwa die Heideggers und Sartres. Wir beziehen uns vielmehr auf die realen Bedingungen der Existenz, wie sie dem Menschen als solchem eigen ist, so dass das Wesen jedes Individuums identisch ist mit der Existenz der Gattung. Wir gelangen zu diesem Konzept durch die empirische Analyse der menschlichen anatomischen und neurophysiologischen Struktur und ihrer seelischen Entsprechungen. Wir ersetzen so Freuds physiologisches Erklärungsprinzip der menschlichen Leidenschaften durch ein sozialbiologisch-evolutionäres, historisches Prinzip.
Von dieser theoretischen Grundlage aus wird es möglich, die verschiedenen Formen der charakterbedingten bösartigen Aggression eingehend zu diskutieren, insbesondere die des Sadismus – des leidenschaftlichen Dranges nach unbeschränkter Macht über ein anderes empfindendes Wesen – und die der Nekrophilie – des Dranges, Leben zu zerstören, und des Hingezogenseins zu allem, was tot, verfault und rein mechanistisch ist. Das Verständnis dieser Charakterstrukturen wird, wie ich hoffe, erleichtert werden durch die Charakteranalyse einiger für ihren Sadismus und ihre Destruktivität bekannten Gestalten der jüngsten Vergangenheit: Stalin, Himmler und Hitler.
Damit wäre der Aufbau der vorliegenden Untersuchung skizziert, und es scheint sinnvoll, [VII-006] kurz auf einige Prämissen und Schlussfolgerungen hinzuweisen, die der Leser in den folgenden Kapiteln finden wird: 1.) Wir wollen uns nicht mit Verhalten an sich, also losgelöst vom sich verhaltenden Menschen befassen; unser Gegenstand werden die menschlichen Triebe sein, gleichgültig, ob sie sich in unmittelbar beobachtbarem Verhalten äußern oder nicht. Dies bedeutet im Hinblick auf das Phänomen der Aggression, dass wir Ursprung und Intensität der aggressiven Impulse, und nicht aggressives Verhalten unabhängig von seiner Motivation untersuchen werden. 2.) Diese Impulse können bewusst sein, aber in der Mehrzahl der Fälle sind sie unbewusst. 3.) Sie sind meist in eine relativ stabile Charakterstruktur integriert. 4.) Im weiteren Sinn basiert diese Untersuchung auf der psychoanalytischen Theorie. Daraus folgt, dass wir uns der psychoanalytischen Methode bedienen werden, die die unbewusste innere Realität durch die Deutung der beobachtbaren und oft scheinbar unbedeutenden Daten aufdeckt. Der Ausdruck „Psychoanalyse“ wird hier jedoch nicht im Sinn der klassischen Freudschen Theorie gebraucht, sondern im Sinn einer bestimmten Weiterentwicklung. Auf wesentliche Aspekte dieser Weiterentwicklung werde ich später eingehen; hier sei nur gesagt, dass es nicht eine auf der Libido-Theorie basierende Psychoanalyse ist, weshalb sie ohne die instinktivistischen Vorstellungen auskommt, die nach allgemeiner Ansicht gerade das Wesen der Freudschen Theorie ausmachen.
Die Gleichsetzung der Freudschen Theorie mit dem Instinktivismus ist ohnehin äußerst fragwürdig. Freud war in Wirklichkeit der erste moderne Psychologe, der – im Gegensatz zum damals herrschenden Trend – das Reich der menschlichen Leidenschaften erforschte – Liebe, Hass, Ehrgeiz, Habgier, Eifersucht und Neid; Leidenschaften, mit denen sich bis dahin nur Dramatiker und Romanciers befasst hatten, wurden dank Freud zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung.[14] Das erklärt vielleicht, weshalb sein Werk bei Künstlern eine viel wärmere und verständnisvollere Aufnahme fand als bei Psychiatern und Psychologen – wenigstens bis hin zu der Zeit, in der man sich seiner Methode bediente, um dem wachsenden Bedürfnis nach psychotherapeutischer Behandlung gerecht zu werden. Die Künstler hatten das Gefühl, dass hier zum ersten Mal ein Wissenschaftler auftauchte, der sich mit ihrem ureigensten Thema, der menschlichen „Seele“ in ihren geheimsten und subtilsten Äußerungen befasste. Im Surrealismus zeigte sich der Einfluss Freuds auf das künstlerische Denken am deutlichsten. Im Gegensatz zu älteren Kunstformen tat der Surrealismus die „Realität“ als irrelevant ab und kümmerte sich nicht um Verhaltensweisen – was einzig zählte, war die subjektive Erfahrung; es war daher nur logisch, dass Freuds Traumdeutung zu einem der wichtigsten Entwicklungsfaktoren für diese Bewegung wurde.
Freud blieb in der Formulierung seiner neuen Einsichten zwangsläufig der Begriffs- und Ausdruckswelt seiner Zeit verhaftet. Da er sich nie vom Materialismus seiner Lehrer löste, musste er nach einer Möglichkeit suchen, wie er die menschlichen Leidenschaften als Triebäußerungen tarnen konnte. Dies gelang ihm glänzend mit einer theoretischen tour de force; er erweiterte den Begriff der Sexualität (Libido) derart, dass alle menschlichen [VII-007] Leidenschaften (außer dem Selbsterhaltungstrieb) als Erscheinungsformen eines einzigen Triebes verstanden werden konnten. Liebe, Hass, Habgier, Eitelkeit, Ehrgeiz, Geiz, Eifersucht, Grausamkeit und Zärtlichkeit – sie alle wurden in die Zwangsjacke dieses Schemas gepresst und theoretisch als Sublimierungen – oder Reaktionsbildungen – der verschiedenen Formen narzisstischer, oraler, analer und genitaler Libido behandelt.
In der zweiten Periode seines Wirkens versuchte Freud jedoch dieses Schema zu durchbrechen und stellte eine neue Theorie auf, die einen entscheidenden Fortschritt für das Verständnis der Destruktivität bedeutet. Er erkannte, dass das Leben nicht von zwei egoistischen Trieben, dem des Hungers und dem der Sexualität, beherrscht wird, sondern von zwei Leidenschaften – Liebe und Destruktivität –, die beide nicht im gleichen Sinn wie Hunger und Sexualität dem physiologischen Überleben dienen. Da er jedoch nach wie vor in seinen theoretischen Voraussetzungen befangen war, bezeichnete er sie als „Lebenstrieb“ und als „Todestrieb“; er verlieh damit der menschlichen Destruktivität die Bedeutung, eine der beiden fundamentalen Leidenschaften des Menschen zu sein.
Die vorliegende Untersuchung befreit Leidenschaften wie das Streben nach Liebe und nach Freiheit, den Drang zu zerstören, zu quälen, zu beherrschen und zu unterwerfen aus ihrer Zwangsehe mit den Instinkten. Die Instinkte sind eine rein natürliche Kategorie, während die im Charakter verwurzelten Leidenschaften eine soziobiologische, historische Kategorie sind.[15] Obwohl sie nicht dem physischen Überleben dienen, sind sie genauso stark – und oft sogar stärker – als die Triebe. Sie bilden die Grundlage für das Interesse des Menschen am Leben, für seine Fähigkeit zu Begeisterung und freudiger Erregung; sie sind der Stoff, aus dem nicht nur seine Träume, sondern auch Kunst, Religion, Mythos und Drama geschaffen werden – kurz alles, was das Leben lebenswert macht.
Der Mensch kann nicht als bloßer „Gegenstand“ leben, als Würfel, der aus einem Becher rollt; er nimmt ernstlich Schaden, wenn man ihn auf das Niveau eines Fütterungs- und Fortpflanzungsautomaten reduziert, selbst wenn er dabei jede Sicherheit erhält, die er braucht. Der Mensch strebt nach Spannung und Erregung; wenn er auf höherer Ebene keine Befriedigung findet, schafft er sich selbst das Drama der Zerstörung. Das heutige Denkklima begünstigt das Axiom, ein Motiv könne nur dann intensiv sein, wenn es einem organischen Bedürfnis dient – dass also nur Instinkte eine intensive Motivationskraft besitzen. Gibt man diesen mechanistischen, reduktionistischen Standpunkt auf und geht von einer ganzheitlichen Prämisse aus, so beginnt man zu verstehen, dass die Leidenschaften[16] des Menschen im Zusammenhang mit ihrer Funktion für den Lebensprozess des ganzen Organismus gesehen werden müssen. Ihre Intensität beruht nicht auf spezifischen physiologischen Bedürfnissen, sondern auf dem Bedürfnis des Gesamtorganismus, weiterzuleben und körperlich wie geistig zu wachsen.
Diese Leidenschaften werden nicht erst mächtig in uns, nachdem unsere physiologischen Bedürfnisse befriedigt sind. Sie wurzeln im Grund menschlicher Existenz und sind keineswegs nur eine Art Luxus, den wir uns gestatten können, nachdem unsere normalen, „niedrigeren“ Bedürfnisse befriedigt sind. Menschen haben Selbstmord begangen, weil sie [VII-008] ihren leidenschaftlichen Drang nach Liebe, Macht, Ruhm oder Rache nicht befriedigen konnten. Fälle von Selbstmord wegen mangelnder sexueller Befriedigung kommen praktisch nicht vor. Diese nicht triebbedingten Leidenschaften erregen den Menschen, feuern ihn an, machen ihm das Leben lebenswert, wie von Holbach, der Philosoph der französischen Aufklärung, einmal gesagt hat: „Un homme sans passions et désirs cesserait d’etre homme.“ („Ein Mensch ohne Leidenschaften und Wünsche würde aufhören, Mensch zu sein.“) (P. H. D. von Holbach, 1822). Sie sind eben deshalb so intensiv, weil der Mensch ohne sie kein Mensch wäre.[17]
Die menschlichen Leidenschaften verwandeln den Menschen aus einem bloßen Gegenstand in einen Helden, in ein Wesen, das gewaltigen Hindernissen zum Trotz seinem Leben einen Sinn zu geben versucht. Er will sein eigener Schöpfer sein, sein Nicht-fertig-Sein umwandeln in ein Sein, das ein Ziel und einen Sinn hat und es ihm ermöglicht, einen optimalen Grad von Integration zu erreichen. Die Leidenschaften des Menschen sind keine banalen psychologischen Komplexe, die aus Kindheitstraumata hinreichend zu erklären sind. Man begreift sie nur, wenn man über den Bereich der reduktionistischen Psychologie hinausgeht und sie als das erkennt, was sie sind: der Versuch des Menschen, seinem Leben einen Sinn zu geben und das Äußerste an Intensität und Kraft zu erleben, was unter den gegebenen Verhältnissen möglich ist (oder was er für möglich hält). Sie sind seine Religion, sein Kult, sein Ritual, die er (sogar vor sich selbst) verbergen muss, soweit seine Gruppe sie missbilligt. Durch Bestechung und Erpressung (das heißt durch eine geschickte Konditionierung) kann er freilich dazu gebracht werden, seine „Religion“ aufzugeben und sich zu dem allgemeinen Kult des Nicht-Selbst, des Roboters zu bekehren. Aber diese psychische Behandlung beraubt ihn des Besten, was er besitzt: ein Mensch zu sein und nicht ein Ding.
In Wahrheit sind alle menschlichen Leidenschaften, die „guten“ wie die „schlechten“, nur als Versuch des Menschen zu verstehen, die banale Existenz der reinen Fristung des Lebens zu transzendieren. Wandel der Persönlichkeit ist nur dann möglich, wenn es ihm gelingt, sich zu einer neuen Art, dem Leben Sinn zu geben zu „bekehren“, indem er seine lebensfördernden Leidenschaften mobilisiert, und auf diese Weise eine stärkere Vitalität und Integration erfährt, als er sie zuvor besaß. Solange dies nicht geschieht, kann er zwar gezähmt, aber nicht geheilt werden. Aber obwohl die lebensfördernden Leidenschaften zu einem erhöhten Kraftgefühl, zu größerer Lebensfreude und einer stärkeren Integration und Vitalität führen als Destruktivität und Grausamkeit, sind diese doch ebenso eine Antwort auf das Problem der menschlichen Existenz wie jene. Auch der sadistischste und destruktivste Mensch ist ein Mensch, so menschlich wie der Heilige. Man kann ihn als [VII-009] verkrüppelten und kranken Menschen bezeichnen, der keine bessere Antwort auf die Herausforderung finden konnte, als Mensch geboren zu sein, und man hätte recht damit; man kann ihn auch als einen Menschen bezeichnen, der auf der Suche nach seinem Heil den falschen Weg eingeschlagen hat.[18]
Diese Erwägungen sollen jedoch keineswegs besagen, dass Destruktivität und Grausamkeit keine Laster wären; sie besagen nur, dass das Laster menschlich ist. Sie wirken sich in der Tat zerstörerisch auf das Leben, auf Körper und Geist aus, und dies nicht nur für das Opfer, sondern auch für den destruktiv Handelnden selbst. Sie stellen ein Paradoxon dar: In ihnen kommt zum Ausdruck, dass das Leben im Bestreben, sich einen Sinn zu geben, sich gegen sich selbst kehrt. Sie sind die einzige echte Perversion. Sie zu verstehen, heißt nicht, sie zu verzeihen. Doch solange wir sie nicht verstehen, haben wir nicht die Möglichkeit zu beurteilen, wie sie einzudämmen sind und welche Faktoren die Tendenz haben, sie zu verstärken.
Ein solches Verständnis ist in unserer heutigen Zeit besonders wichtig, in der das Gefühl für Destruktivität und Grausamkeit zusehends schwindet und die Nekrophilie, das Sichangezogenfühlen von allem, was tot, verfault, leblos und rein mechanisch ist, auf allen Ebenen unserer kybernetischen Industriegesellschaft wächst. Literarischen Niederschlag fand der Geist der Nekrophilie zum ersten Mal in F. T. Marinettis Futuristischem Manifest von 1909. Die gleiche Tendenz kann man in weiten Bereichen der Kunst und Literatur der letzten Jahrzehnte feststellen, in denen eine besondere Faszination durch alles, was verrottet, unlebendig, destruktiv und mechanistisch ist, zum Ausdruck kommt. Der Wahlspruch der Falangisten „Lang lebe der Tod“ droht zum geheimen Prinzip einer Gesellschaft zu werden, in der der Sieg der Maschine über die Natur den Inbegriff des Fortschritts auszumachen scheint und in der der lebendige Mensch zum Anhängsel der Maschine wird.
Die vorliegende Untersuchung will das Wesen dieser nekrophilen Leidenschaft und die sozialen Bedingungen sichtbar machen, die ihr Vorschub leisten. Die Schlussfolgerung ist, dass Abhilfe in einem umfassenden Sinn nur durch radikale Veränderungen unserer gesellschaftlichen und unserer politischen Struktur möglich ist, Veränderungen, die dem Menschen seine herrschende Rolle in der Gesellschaft wiedergeben. Der Ruf nach „Gesetz und Ordnung“ (anstatt nach Leben und Struktur) und nach einer strengeren Bestrafung von Verbrechern, wie auch die Gewaltbesessenheit und Zerstörungswut gewisser „Revolutionäre“, sind nur weitere Beispiele für den starken Hang zur Nekrophilie in der heutigen Welt. Wir müssen die Bedingungen dafür schaffen, dass die Entwicklung des Menschen, jenes unvollendeten Wesens – wie es einzig in der Natur vorhanden ist – zum obersten Ziel aller gesellschaftlichen Bestrebungen gemacht wird. Echte Freiheit und Unabhängigkeit und das Ende aller Formen ausbeuterischer Herrschaft könnten die Liebe zum Leben wirksam werden lassen, jene Kraft, die allein die Liebe zum Tod besiegen kann.
Erster Teil
Instinkt- und Trieblehren, Behaviorismus, Psychoanalyse
1. Vertreter der Instinkt- und Trieblehren
Ältere Instinkt- und Triebforscher
Ich verzichte darauf, dem Leser eine Geschichte der Instinkt- und Triebtheorien zu geben[19], da er sie in zahlreichen Lehrbüchern nachlesen kann.[20] Die Anfänge dieser Geschichte liegen weit zurück im philosophischen Denken, doch geht unser modernes Denken auf das Werk von Charles Darwin zurück. Die gesamte Instinkt- und Triebforschung nach Darwin gründet auf dessen Evolutionstheorie.
William James (1896), William McDougall (1913; 1932) und andere stellten lange Listen auf, auf denen von jedem einzelnen Instinkt und Trieb angenommen wurde, dass er entsprechende Verhaltensweisen motiviere. So unterscheidet James einen Nachahmungstrieb, einen Kampf-, einen Mitgefühls-, Jagd-, Angst-, Erwerbs-, Kleptomanietrieb, einen Trieb der Schöpferkraft, einen Spiel-, Neugier-, Geselligkeits-, Verheimlichungs-, einen Sauberkeits-, Bescheidenheits-, Liebes- und Eifersuchtstrieb – eine merkwürdige Mischung von allgemein menschlichen Eigenschaften und spezifisch sozial konditionierten Charakterzügen (J. J. McDermott, Hg., 1967). Obwohl uns derartige Trieblisten heute etwas naiv vorkommen, sind die Arbeiten dieser Instinkt- und Triebforscher doch höchst differenziert und reich an theoretischen Konstruktionen, und sie beeindrucken uns noch immer durch das hohe Niveau ihres theoretischen Denkens; sie sind keineswegs einfach überholt. So war sich zum Beispiel James durchaus darüber im klaren, dass sogar schon bei der ersten Instinkthandlung ein Lernelement beteiligt sein könnte, und McDougall übersah nicht den formenden Einfluss unterschiedlicher Erfahrungen und kultureller Hintergründe. Seine Trieblehre bildet eine Brücke zu Freuds Theorie. Wie Fletcher betont hat, setzte McDougall Trieb nicht gleich mit einer „mechanischen Motorik“ und einer starr fixierten motorischen Reaktion. Für ihn war ein Trieb im Grunde eine „Neigung“ zu etwas, ein „Verlangen“ nach etwas, und dieser affektiv-konnative Kern eines jeden Triebes „scheint [VII-014] relativ unabhängig vom kognitiven und vom motorischen Teil der gesamten Trieb-Disposition funktionieren zu können“ (W. McDougall, 1932).
Bevor wir uns den beiden bekanntesten modernen Vertretern der Instinkt- und Triebforschung, Sigmund Freud und Konrad Lorenz, zuwenden, wollen wir den Blick auf ein Charakteristikum richten, das sie beide mit den älteren Instinkt- und Triebforschern gemeinsam haben: die mechanistisch-hydraulische Konzeption des Triebmodells. McDougall stellte sich vor, dass die Energie von „Schleusentoren“ zurückgehalten würde und unter bestimmten Bedingungen „überwallt“ (W. McDougall, 1913). Später bediente er sich einer Analogie, in der er jeden Trieb mit einer „Kammer“ verglich, „ in welcher ständig Gas frei wird“ (W. McDougall, 1923). Auch Freud folgte in seiner Libidotheorie einem hydraulischen Schema. Die Libido nimmt zu → die Spannung steigt → die Unlust nimmt zu; der Sexualakt vermindert die Spannung und die Unlust, bis die Spannung wieder zu steigen beginnt. Ähnlich dachte auch Lorenz bei reaktionsspezifischer Energie an „ein Gas“, das „dauernd in einen Behälter gepumpt“ wird, oder an eine Flüssigkeit in einem Behälter, die durch ein am Boden sitzendes, federbelastetes Ventil abgelassen werden kann (K. Lorenz, 1937, S. 270). R. A. Hinde wies darauf hin, dass diese und andere Instinkt- und Triebmodelle trotz einiger Unterschiede „die Idee einer Substanz gemeinsam haben, die die Fähigkeit besitzt, Verhaltensweisen, die in einem Gefäß zurückgehalten werden und später in die Aktion eingehen, mit Energie zu laden“ (R. A. Hinde, 1960, S. 473).
Neuere Instinkt- und Triebforscher: Sigmund Freud und Konrad Lorenz
Freuds Aggressionsbegriff
Der große Fortschritt Freuds gegenüber den älteren Triebforschern und besonders McDougall gegenüber bestand darin, dass er alle „Triebe“ in zwei Kategorien zusammenfasste – den Sexualtrieb und den Selbsterhaltungstrieb.[21] Daher kann man Freuds Theorie als die letzte Stufe in der Geschichte der Entwicklung der Triebtheorie ansehen. Ich werde darauf zurückkommen, dass gerade diese vereinheitlichende Zusammenfassung der Triebe in einen einzigen (mit Ausnahme des Ich-Triebs) gleichzeitig der erste Schritt zur Überwindung der älteren Trieblehren war, wenngleich Freud selbst sich dessen nicht bewusst war. Im Folgenden möchte ich mich nur mit Freuds Auffassung von der Aggression befassen, da seine Libidotheorie vielen Lesern bekannt sein dürfte und sie sich in anderen Werken über sie informieren können, am besten in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (S. Freud, 1916-17; 1933a).
Freud hatte dem Phänomen der Aggression relativ wenig Beachtung geschenkt, solange er die Sexualität (Libido) und den Selbsterhaltungstrieb für die beiden Kräfte gehalten hatte, die den Menschen beherrschten. Seit den zwanziger Jahren änderte sich dieses Bild jedoch völlig. In Das Ich und das Es (1923b) und in seinen späteren Schriften stellte er eine neue [VII-015] Dichotomie auf: die des Lebenstriebs beziehungsweise der Lebenstriebe (Eros) und des Todestriebs beziehungsweise der Todestriebe. Freud beschrieb die neue theoretische Phase folgendermaßen: „Ausgehend von Spekulationen über den Anfang des Lebens und von biologischen Parallelen zog ich den Schluss, es müsse außer dem Trieb, die lebende Substanz zu erhalten und zu immer größeren Einheiten zusammenzufassen, einen anderen, ihm gegensätzlichen, geben, der diese Einheiten aufzulösen und in den uranfänglichen anorganischen Zustand zurückzuführen strebe. Also außer dem Eros einen Todestrieb“ (S. Freud, 1930a, S. 477 f.).
Der Todestrieb richtet sich gegen den Organismus selbst und ist daher ein selbstzerstörerischer Trieb, oder er ist nach außen gerichtet und tendiert in diesem Fall eher dazu, andere zu zerstören als sich selbst. Verbindet sich Sexualität mit dem Todestrieb, so verwandelt er sich in harmlosere Impulse, wie sie im Sadismus oder im Masochismus zum Ausdruck kommen. Obwohl Freud wiederholt darauf hinwies, dass die Macht des Todestriebes reduziert werden könne (S. Freud, 1927c), blieb seine grundsätzliche Auffassung doch: Der Mensch wird beherrscht von einem Impuls, entweder sich selbst oder andere zu zerstören, und er kann dieser tragischen Alternative kaum entrinnen. Aus dieser Annahme des Todestriebes folgt, dass die Aggression ihrem Wesen nach keine Reaktion auf Reize ist, sondern ein ständig fließender Impuls, der in der Konstitution des menschlichen Organismus wurzelt.
Während sich die Psychoanalytiker in allen anderen Punkten an Freud halten, haben sich die meisten von ihnen geweigert, die Theorie des Todestriebes zu übernehmen; vielleicht deshalb, weil diese Theorie über den alten mechanistischen Bezugsrahmen hinausgeht und ein biologisches Denken verlangt, wie es den meisten unannehmbar war, da für sie „ biologisch“ mit der Physiologie der Triebe identisch war. Trotzdem haben sie Freuds neue Auffassung nicht ganz verworfen. Sie schlossen einen Kompromiss, indem sie die Existenz eines „Zerstörungstriebes“ als Gegenpol zum Sexualtrieb anerkannten. Dies machte es ihnen möglich, Freuds neuerliche Betonung der Aggression zu akzeptieren, ohne sich einer völlig neuen Art des Denkens zu unterwerfen.
Freud hatte einen wichtigen Schritt vorwärts getan, indem er von einer rein physiologisch-mechanistischen Auffassung zu einer biologischen überging, die den Organismus als Ganzes nimmt und die biologischen Ursprünge von Liebe und Hass analysiert. Seine Theorie weist jedoch schwere Mängel auf. Sie gründet sich auf recht abstrakte Spekulationen und hat kaum einen überzeugenden empirischen Beweis aufzuweisen. Hinzu kommt, dass Freud zwar einen brillanten Versuch unternahm, menschliche Impulse mit seiner neuen Theorie zu erklären, dass seine Hypothese jedoch auf tierische Verhaltensweisen nicht anwendbar ist. Für ihn ist der Todestrieb eine biologische Kraft, die in allen lebenden Organismen wirkt: Dies würde bedeuten, dass auch die Tiere ihren Todestrieb entweder gegen sich selbst oder gegen andere Tiere zum Ausdruck bringen müssten. Folglich müsste man mehr Krankheiten oder einen häufigeren frühen Tod bei nach außen hin weniger aggressiven Tieren finden und umgekehrt; aber natürlich gibt es keine Tatsachen, die diese Annahme unterstützen.
Dass Aggression und Destruktivität keine biologischen Gegebenheiten und keine spontan strömenden Impulse sind, werde ich im nächsten Kapitel darlegen. Hier sei nur gesagt, dass Freud die Analyse des Phänomens Aggression undurchsichtig gemacht hat, da er, wie [VII-016] es üblich war, diesen Ausdruck auf die verschiedensten Arten von Aggression anwandte, um auf diese Weise alle leichter aus einem Instinkt heraus erklären zu können. Da er ganz sicher nicht zum Behaviorismus neigte, dürfen wir annehmen, dass der Grund hierfür seine Neigung war, zu einer dualistischen Auffassung zu gelangen, in der zwei Grundkräfte einander gegenüberstehen. Bei dieser Dichotomie handelte es sich zunächst um die zwischen Selbsterhaltungstrieb und Libido und später um die zwischen Lebens- und Todestrieb. Freud bezahlte die Eleganz dieser Auffassung damit, dass er jede Leidenschaft einem der beiden Pole zuordnen musste und dass er auf diese Weise zusammenbrachte, was in Wirklichkeit nichts miteinander zu tun hatte.
Die Aggressionstheorie von Konrad Lorenz
Während Freuds Aggressionstheorie einflussreich war und es auch heute noch ist, war sie andererseits vielschichtig und schwierig und wurde nie in dem Sinn populär, dass sie von einem breiten Publikum gelesen und von diesem mit besonderem Interesse aufgenommen worden wäre. Im Gegensatz dazu wurde das Buch von Konrad Lorenz Das sogenannte Böse (K. Lorenz, 1963) schon kurz nach seiner Veröffentlichung zu einem der meistgelesenen Bücher auf dem Gebiet der Sozialpsychologie.
Die Gründe für diese Popularität liegen auf der Hand. Vor allem liest sich Das sogenannte Böse ähnlich wie Lorenz’ frühere reizende Geschichtensammlung Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen (1949) ungeheuer leicht, ganz im Gegensatz zu Freuds schwerfälligen Abhandlungen über den Todestrieb, übrigens auch im Gegensatz zu Lorenz’ eigenen Abhandlungen und Büchern, die er für die Fachwelt schrieb. Außerdem spricht er damit, wie bereits in der Einleitung erwähnt, heute viele Menschen an, die lieber glauben, dass unser Hang zur Gewalt und zur atomaren Auseinandersetzung auf biologische Faktoren zurückzuführen ist, die sich unserer Kontrolle entziehen, als dass sie die Augen aufmachen und erkennen, dass die von uns selbst verursachten sozialen, politischen und ökonomischen Umstände daran schuld sind.
Für Lorenz[22] ist die menschliche Aggressivität genau wie für Freud ein Trieb, der von einer ständig fließenden Energiequelle gespeist wird und nicht notwendigerweise das Resultat einer Reaktion auf äußere Reize ist. Lorenz vertritt den Standpunkt, dass die für einen triebhaften Akt spezifische Energie sich ständig in den Nervenzentren ansammelt, die auf dieses Verhaltensmuster bezogen sind, und dass mit einer Explosion zu rechnen ist, sobald sich genug Energie gestaut hat, dies auch dann, wenn kein Reiz vorhanden ist. Allerdings finden Tier und Mensch im allgemeinen Reize, welche die aufgestaute Trieb-Energie freisetzen; sie brauchen nicht passiv abzuwarten, bis der geeignete Reiz auftaucht. Sie suchen nach Reizen und erzeugen sie sogar selbst. Im Anschluss an W. Craig [VII-017] bezeichnet Lorenz dies als „Appetenz-Verhalten“. Der Mensch, so sagt er, gründet politische Parteien, um sich Stimuli zur Ableitung angestauter Energie zu verschaffen, aber die politischen Parteien sind nicht die Ursache der Aggression. In Fällen jedoch, in denen kein äußerer Reiz gefunden oder hervorgebracht werden kann, ist die Energie des gestauten Aggressionstriebes so groß, dass es gleichsam zu einer Explosion kommt und dass der Trieb sich in vacuo auswirkt. „Der Grenzfall der aus Mangel an äußeren Bedingungen sinnlosen Instinkthandlung, die objektlos ablaufende Leerlaufreaktion, beweist durch die wahrhaft photographische Gleichheit der ausgeführten Bewegungen mit denen des normalen, den biologischen Sinn der Handlung erfüllenden Ablaufes, dass die Bewegungskoordinationen der Instinkthandlung bis in kleinste Einzelheiten ererbtermaßen festgelegt sind“ (K. Lorenz, 1937, S. 274).[23]
Demnach ist Aggression für Lorenz primär keine Reaktion auf äußere Reize, sondern eine „eingebaute“ innere Erregung, die nach Abfuhr verlangt und sich äußert ohne Rücksicht darauf, ob der äußere Reiz geeignet ist oder nicht. „Die Spontaneität des Instinktes ist es, die ihn so gefährlich macht“ (K. Lorenz, 1963, S. 73 f.; Hervorhebungen E. F.). Man hat das Aggressionsmodell von Lorenz ebenso wie das Libidomodell von Freud zu Recht ein hydraulisches Modell genannt in Analogie zu dem Druck, der von gestautem Wasser oder Dampf in einem geschlossenen Behälter ausgeübt wird. (Vgl. K. Lorenz, 1937, S. 270.)
Dieser hydraulische Aggressionsbegriff ist sozusagen der eine Pfeiler, auf dem Lorenz’ Theorie ruht; er bezieht sich auf den Mechanismus, durch den Aggression entsteht. Der andere Pfeiler ist der Gedanke, dass Aggression im Dienste des Lebens steht, dass sie dem Überleben des Individuums und der Art dient. Allgemein gesagt, nimmt Lorenz an, dass die intraspezifische Aggression (Aggression gegen Angehörige der gleichen Art) die Funktion hat, dem Überleben der Art zu dienen. Lorenz stellt die Theorie auf, dass die Aggression diese Funktion erfüllt, indem sie die einzelnen Vertreter einer Spezies über den zur Verfügung stehenden Lebensraum verteilt, indem sie die Selektion des „besseren Männchens“ bewirkt, was hinsichtlich der Verteidigung des Weibchens von Bedeutung ist, und indem sie eine soziale Rangordnung errichtet (K. Lorenz, 1964). Die Aggression kann diese arterhaltende Funktion umso besser erfüllen, als im Evolutionsprozess sich die tödliche Aggression in eine Verhaltensform verwandelte, die aus symbolischen und rituellen Drohungen besteht, welche die gleiche Funktion erfüllen, ohne der Art zu schaden.
Aber Lorenz argumentiert weiter, dass der bei den Tieren der Arterhaltung dienende Trieb beim Menschen „ins Groteske und Unzweckmäßige übersteigert“ und „aus dem Gleise geraten“ ist. Die Aggression verwandelte sich aus einem hilfreichen, dem Überleben dienenden Trieb in eine Bedrohung.
Es hat den Anschein, dass Lorenz selbst mit diesen Erklärungen der menschlichen Aggressionen nicht ganz zufrieden war und dass er das Bedürfnis hatte, noch eine weitere hinzuzufügen, die jedoch aus dem Bereich der Ethologie hinausführt. Er schreibt:
Vor allem aber ist es mehr als wahrscheinlich, dass das verderbliche Maß an Aggressionstrieb, das uns Menschen heute noch als böses Erbe in den Knochen sitzt, durch [VII-018] einen Vorgang der intraspezifischen Selektion verursacht wurde, der durch mehrere Jahrzehntausende, nämlich durch die ganze Frühsteinzeit[24], auf unsere Ahnen eingewirkt hat. Als die Menschen eben gerade so weit waren, dass sie kraft ihrer Bewaffnung, Bekleidung und ihrer sozialen Organisation die von außen drohenden Gefahren des Verhungerns, Erfrierens und Gefressenwerdens von Großraubtieren einigermaßen gebannt hatten, so dass diese nicht mehr die wesentlichen selektierenden Faktoren darstellten, muss eine böse intraspezifische Selektion eingesetzt haben. Der nunmehr Auslese treibende Faktor war der Krieg, den die feindlichen benachbarten Menschenhorden gegeneinander führten. Er muss eine extreme Herauszüchtung aller sogenannten „kriegerischen Tugenden“ bewirkt haben, die leider noch heute vielen Menschen als wirklich erstrebenswerte Ideale erscheinen (K. Lorenz, 1963, S. 67).
Diese Vorstellung von ständigem Krieg zwischen den „wilden“ Jägern und Sammlern seit dem vollen Auftauchen des „modernen Menschen“ um 40 000 oder 50 000 v. Chr. ist ein weitverbreitetes Klischee, das Lorenz übernimmt, ohne auf die Forschung Bezug zu nehmen, die zeigt, dass es keine Grundlagen hat.[25] Lorenz’ Annahme von 40 000 Jahren organisierter Kriegführung ist nichts weiter als das alte Klischee Hobbes’ vom Krieg als dem natürlichen Zustand des Menschen, das hier als Argument dient, mit dem die angeborene menschliche Aggressivität bewiesen werden soll. Die logische Folgerung aus Lorenz’ Annahme ist, dass der Mensch aggressiv ist, weil er aggressiv war, und dass er aggressiv war, weil er aggressiv ist.
Selbst wenn Lorenz mit seiner These von der ständigen Kriegführung in der Jungsteinzeit recht hätte, bleiben seine genetischen Schlussfolgerungen fragwürdig. Wenn ein bestimmter Wesenszug einen selektiven Vorteil besitzen soll, muss dieser sich auf die vermehrte Erzeugung fruchtbarer Nachkommen des Trägers dieses Wesenszuges gründen. Angesichts der Tatsache jedoch, dass aggressive Individuen in Kriegen eher umkommen, ist es zweifelhaft, ob man ein häufiges Vorkommen dieses Wesenszuges tatsächlich auf Selektion zurückführen kann. In Wirklichkeit sollte die Häufigkeit dieses Erbfaktors eher abnehmen, wenn man die höheren Verluste als negative Selektion auffasst.[26] Tatsächlich war die Bevölkerungsdichte in jener Zeit äußerst gering, und viele der Stämme nach dem vollen Auftauchen des Homo sapiens hatten es kaum nötig, zu konkurrieren und um Nahrung und Lebensraum miteinander zu kämpfen.
Lorenz verband in seiner Theorie zwei Elemente miteinander. Das erste lautet, dass Tiere wie Menschen eine angeborene Aggression besitzen, welche dem Überleben des Individuums und der Art dient. Wie ich noch zeigen werde, geht aus neurophysiologischen Erkenntnissen hervor, dass diese defensive Aggression eine Reaktion auf eine Bedrohung der vitalen Interessen des betreffenden Lebewesens ist und dass sie nicht spontan und ständig strömt. Das andere Element, der hydraulische Charakter der gestauten Aggression, dient Lorenz zur Erklärung der mörderischen und grausamen Impulse des Menschen; doch bringt er nur wenige Beweise, die diese Annahme stützen. Sowohl die dem Leben dienende als auch die destruktive Aggression werden unter einer Kategorie subsumiert, und das einzige, was beide verbindet, ist das Wort „Aggression“. Im Gegensatz zu [VII-019] Lorenz hat Tinbergen das Problem in voller Klarheit dargelegt: „Einerseits ist der Mensch mit vielen Tierarten darin verwandt, dass er gegen seine eigenen Artgenossen kämpft. Andererseits ist er unter Tausenden von Arten, die kämpfen, die einzige, bei der das Kämpfen destruktiv ist. (...) Der Mensch ist als einzige Spezies eine Spezies von Massenmördern, die einzige, die der eigenen Gesellschaft nicht angepasst ist. Warum ist das so?“ (N. Tinbergen, 1968, S. 1412).
Freud und Lorenz: Ähnlichkeiten und Unterschiede
Die Beziehung zwischen den Theorien von Lorenz und Freud ist recht kompliziert. Gemeinsam ist ihnen die hydraulische Konzeption der Aggression, auch wenn sie den Ursprung dieses Triebes unterschiedlich erklären. In anderer Hinsicht jedoch scheinen ihre Auffassungen diametral entgegengesetzt. Freud stellte die Hypothese des Destruktionstriebes auf, eine Annahme, die Lorenz aus biologischen Gründen für unhaltbar erklärt. Sein Aggressionstrieb dient dem Leben, Freuds Todestrieb ist der Diener des Todes.
Freilich verliert dieser Unterschied seine Bedeutung größtenteils dadurch, dass Lorenz von den Veränderungen der ursprünglich defensiven und lebenserhaltenden Aggression spricht. Mit Hilfe komplizierter und oft fragwürdiger Konstruktionen soll die Annahme gestützt werden, dass sich die defensive Aggression beim Menschen in einen ständig strömenden und sich selbst verstärkenden Trieb umwandelt, der Umstände herbeizuführen sucht, welche die Entladung der Aggression erleichtern, oder dass es sogar zu einer Explosion kommt, wenn keine Reize gefunden oder geschaffen werden können. Hieraus folgt, dass selbst in einer Gesellschaft, die vom sozioökonomischen Standpunkt aus so organisiert wäre, dass keine geeigneten Reize für eine heftigere Aggression vorkämen, der Druck des Instinkts selbst so stark würde, dass die Mitglieder dieser Gesellschaft gezwungen wären, diese zu verändern, oder dass es – wenn sie sich hierzu nicht bereit fänden – auch ohne jeden Anreiz zu einer Aggressionsexplosion kommen würde. Daher ist auch die Schlussfolgerung, zu der Lorenz kommt, dass der Mensch von einem angeborenen Zerstörungsdrang getrieben ist, in ihren praktischen Konsequenzen die gleiche wie die Freuds. Freud stellt jedoch den Zerstörungstrieb dem ebenso starken Trieb des Eros (Lebens-, Sexualtrieb) gegenüber, während für Lorenz die Liebe ein Produkt aggressiver Instinkte ist.
Freud und Lorenz stimmen darin überein, dass es ungesund ist, wenn die Aggression sich nicht in Aktion umsetzen kann. Freud hatte in der früheren Periode seines Schaffens das Postulat aufgestellt, dass Verdrängung der Sexualität zu seelischer Erkrankung führen kann; später wandte er denselben Grundsatz auf den Todestrieb an und lehrte, dass die Verdrängung nach außen gerichteter Aggression ungesund sei. Lorenz stellt fest, dass „der heutige Zivilisierte überhaupt unter ungenügendem Abreagieren aggressiver Triebhandlungen leidet“ (K. Lorenz, 1963, S. 363). Beide gelangen auf verschiedenen Wegen zu einem Bild des Menschen, bei dem aggressiv-destruktive Energie ständig entsteht und auf die Dauer nur sehr schwer, wenn überhaupt, unter Kontrolle zu halten ist. Das sogenannte Böse in den Tieren wird zu einem wirklich Bösen im Menschen, obgleich nach Lorenz seine Wurzeln nicht böse sind. [VII-020]
„Beweis“ durch Analogie
Diese Ähnlichkeiten zwischen den entsprechenden Aggressionstheorien von Freud und Lorenz sollten jedoch nicht über ihren Hauptunterschied hinwegtäuschen. Freud studierte die Menschen. Er war ein scharfsinniger Beobachter ihres faktischen Verhaltens und der unterschiedlichen Manifestationen ihres Unbewussten. Seine Theorie vom Todestrieb mag falsch oder unvollständig oder auch nicht genügend bewiesen sein, aber Freud erarbeitete sie sich im Prozess ständiger Beobachtung des Menschen. Lorenz dagegen ist ein Beobachter von Tieren, besonders von niederen Tieren, und auf diesem Gebiet zweifellos kompetent. Aber sein Wissen über den Menschen geht nicht über das eines Durchschnittsbürgers hinaus. Er hat es weder durch systematische Beobachtungen noch durch eine zureichende Kenntnis der einschlägigen Literatur ausgebaut.[27] Er nimmt naiverweise an, dass Beobachtungen an sich selbst oder an Bekannten auf alle Menschen anwendbar seien. Seine hauptsächliche Methode ist jedoch nicht einmal die Selbstbeobachtung, sondern Analogieschlüsse vom Verhalten gewisser Tiere auf das Verhalten von Menschen. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus beweisen solche Analogien nichts; sie sind suggestiv und gefallen den Leuten, die Tiere gern haben. Hand in Hand damit geht eine hochgradige Anthropomorphisierung, in der Lorenz schwelgt. Gerade weil diese Analogien die angenehme Illusion wecken, dass man „versteht“, was das Tier „fühlt“, werden sie sehr populär. Wer möchte nicht gern mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen reden?
Lorenz gründet seine Theorien über die hydraulische Natur der Aggression auf Experimente mit Tieren – hauptsächlich Fischen und Vögeln in der Gefangenschaft. Die Frage, um die es hier geht, lautet: Wirkt derselbe aggressive Trieb – den Lorenz bei bestimmten Fischen und Vögeln beobachtete – und der, falls ihm nicht eine andere Richtung gegeben wird, zum Töten führt – auch im Menschen?
Da Lorenz diese Hypothese in Bezug auf den Menschen und die nicht-menschlichen Primaten nicht direkt beweisen kann, bringt er eine Anzahl von Argumenten vor, die seine Behauptung untermauern sollen. Er tut dies hauptsächlich auf dem Wege der Analogie; er entdeckt Ähnlichkeiten zwischen menschlichem Verhalten und dem Verhalten der von ihm studierten Tiere und schließt daraus, dass beide Verhaltensweisen die gleiche Ursache haben. Diese Methode ist von vielen Psychologen kritisiert worden. N. Tinbergen, Lorenz’ namhafter Kollege, hat die Gefahren erkannt, „welche in dem Verfahren liegen, physiologische Erscheinungen auf einer niedrigeren Evolutionsebene, auf einem niedrigeren Niveau der neuronalen Organisation und bei einfacheren Verhaltensformen als Analogien zu benutzen, um damit physiologische Theorien über Verhaltensmechanismen auf höheren und komplexeren Ebenen zu stützen“.
Ich möchte mit ein paar Beispielen den „Analogiebeweis“ von Lorenz illustrieren.[28] Lorenz berichtet über seine Beobachtung bei Buntbarschen (Cichliden) und Brasilianischen [VII-021] Perlmutterfischen, dass ein Fisch sein Weibchen dann nicht angreift, wenn er seinen gesunden Zorn an einem gleichgeschlechtlichen Nachbarn abreagieren kann („umorientierte Aggression“)[29]. Sein Kommentar dazu lautet:
Analoges kann man am Menschen beobachten. In der guten alten Zeit, da die Donaumonarchie noch bestand und es noch Dienstmädchen gab, habe ich an meiner verwitweten Tante folgendes beobachtet. Sie hatte ein Dienstmädchen nie länger als etwa acht bis zehn Monate. Von der neu eingestellten Hausgehilfin war sie regelmäßig aufs Höchste entzückt, lobte sie in allen Tönen als eine sogenannte Perle und schwor, jetzt endlich die Richtige gefunden zu haben. Im Laufe der nächsten Monate kühlte ihr Urteil ab, sie fand erst kleine Mängel, dann Tadelnswertes und gegen das Ende der erwähnten Periode ausgesprochen hassenswerte Eigenschaften an dem armen Mädchen, das dann schließlich, regelmäßig unter ganz großem Krach, fristlos entlassen wurde. Nach dieser Entladung war die alte Dame bereit, in dem nächsten Dienstmädchen wieder einen wahren Engel zu erblicken.
Ich bin weit davon entfernt, mich über meine längst verstorbene und im übrigen sehr liebe Tante überheblich lustig zu machen. Ich habe an ernsten und aller nur denkbaren Selbstbeherrschung fähigen Männern, und selbstverständlich auch an mir selbst, genau die gleichen Vorgänge beobachten können oder – besser gesagt – müssen, und zwar in Kriegsgefangenschaft. Die sogenannte Polarkrankheit, auch Expeditionskoller genannt, befällt bevorzugt kleine Gruppen von Männern, wenn diese in den durch obige Namen angedeuteten Situationen ganz aufeinander angewiesen und damit verhindert sind, sich mit fremden, nicht zum Freundeskreis gehörigen Personen auseinanderzusetzen. Aus dem Gesagten wird bereits verständlich sein, dass der Stau der Aggression umso gefährlicher wird, je besser die Mitglieder der betreffenden Gruppe einander kennen, verstehen und lieben. In solcher Lage unterliegen, wie ich aus eigener Erfahrung versichern kann, alle Reize, die Aggression und innerartliches Kampfverhalten auslösen, einer extremen Erniedrigung ihrer Schwellenwerte. Subjektiv drückt sich dies darin aus, dass man auf kleine Ausdrucksbewegungen seiner besten Freunde, darauf, wie sich einer räuspert oder sich schneuzt, mit Reaktionen anspricht, die adäquat wären, wenn einem ein besoffener Rohling eine Ohrfeige hingehauen hätte (K. Lorenz, 1963, S. 87-89).
Lorenz scheint nicht auf den Gedanken zu kommen, dass die persönlichen Erfahrungen seiner Tante, seiner Kriegsgefangenen-Kameraden und seine eigenen Erlebnisse nicht notwendigerweise etwas über die Allgemeingültigkeit derartiger Reaktionen aussagen. Auch scheint er bei der Erklärung des Verhaltens seiner Tante nicht zu bedenken, dass man anstelle der hydraulischen Interpretationsmöglichkeit, die besagt, ihr aggressives Potenzial steige alle acht bis zehn Monate so hoch, dass es zu einer Entladung kommt, eine komplexere psychologische Deutung benötigen könnte.
Vom psychoanalytischen Standpunkt aus würde man annehmen, dass die Tante eine sehr narzisstische Person war, die dazu neigte, andere Menschen auszunutzen. Sie verlangte von ihrem Dienstmädchen, dass es ihr ganz und gar „ergeben“ war, keine eigenen Interessen hatte und freudig die Rolle einer Kreatur annahm, die ihr Glück darin sah, ihr dienen [VII-022] zu dürfen. Bei jedem neuen Dienstmädchen bildete sie sich ein, dieses werde nun ganz bestimmt ihre Erwartungen erfüllen. Nach kurzen „Flitterwochen“, während denen ihre Phantasie noch stark genug war, um sie blind dafür zu machen, dass dieses Dienstmädchen doch wieder nicht „die Richtige“ war – und vielleicht auch mit deswegen, weil das Mädchen zu Anfang sich besonders anstrengte, es ihrer Dienstherrin recht zu machen –, wachte die Tante auf und erkannte, dass das Dienstmädchen nicht bereit war, die ihm zugedachte Rolle zu spielen. Ein derartiger Prozess des Aufwachens dauert natürlich einige Zeit, bis er abgeschlossen ist. Dann aber empfindet die Tante eine intensive Enttäuschung und Wut, wie es bei jedem narzisstisch-ausbeuterischen Menschen im Falle einer Frustration zu beobachten ist. Da sie sich nicht klarmacht, dass die Ursache für ihren Zorn ihre unmöglichen Ansprüche sind, rationalisiert sie ihre Enttäuschung, indem sie ihrem Dienstmädchen die Schuld gibt. Da sie auf die Erfüllung ihrer Wünsche nicht verzichten kann, wirft sie das Mädchen hinaus und hofft, dass die Neue „die Richtige“ sein wird. Der gleiche Mechanismus wiederholt sich, bis sie stirbt oder kein Dienstmädchen mehr finden kann. Eine derartige Entwicklung findet man keineswegs nur im Verhältnis von Arbeitgebern zu Dienstboten. Oft verlaufen Ehekonflikte genauso. Da es jedoch einfacher ist, ein Dienstmädchen hinauszuwerfen als sich scheiden zu lassen, kommt es in der Ehe oft zu einem lebenslänglichen Kampf, bei dem jeder Partner den anderen für Kränkungen zu strafen versucht, die sich immer mehr anhäufen. Es geht hier um das Problem eines spezifisch menschlichen Charakters, nämlich des narzisstisch-ausbeuterischen Charakters, und nicht um das einer gestauten Triebenergie.
In seinem Kapitel über „Der Moral analoge Verhaltensweisen“ stellt Lorenz die folgende Behauptung auf: „Dennoch kann auch derjenige, der diese Zusammenhänge wirklich durchschaut, sich einer immer wiederkehrenden neuen Bewunderung nicht entschlagen, wenn er physiologische Mechanismen am Werke sieht, die Tieren ein selbstloses, auf das Wohl der Gemeinschaft abzielendes Verhalten aufzwingen, wie es uns Menschen durch das moralische Gesetz in uns befohlen wird“ (K. Lorenz, 1963, S. 164 f.).
Wie erkennt man aber „selbstloses“ Verhalten bei Tieren? Was Lorenz beschreibt, ist ein instinktiv determiniertes Verhaltensmuster. Der Ausdruck „selbstlos“ ist der Humanpsychologie entnommen, und er bezieht sich auf die Tatsache, dass ein menschliches Wesen sich selbst (korrekter würde man sagen: sein Ich) bei seinem Wunsch, anderen zu helfen, vergessen kann. Aber hat eine Graugans oder ein Fisch oder ein Hund ein Selbst (oder ein Ich), das sie vergessen können? Hängt Selbstbewusstsein nicht von der Tatsache menschlichen Selbstbewusstseins und der neurophysiologischen Struktur ab, auf der dieses beruht? Diese Frage stellt man sich auch noch bei vielen anderen Ausdrücken, deren Lorenz sich bedient, um tierische Verhaltensweisen zu beschreiben, wie zum Beispiel „Grausamkeit“, „Trauer“, „Verlegenheit“.
Zu den wichtigsten und interessantesten ethologischen Daten von Lorenz gehört das „Band“, das sich zwischen Tieren (sein Hauptbeispiel sind Graugänse) als Reaktion auf Drohungen bildet, die sich von außen gegen die Gruppe richten. Aber die Analogien, die er zur Erklärung menschlicher Verhaltensweisen anwendet, sind gelegentlich verblüffend: „Die diskriminative Aggression gegen Fremde und das Band zwischen den Mitgliedern einer Gruppe steigern sich gegenseitig. Der Gegensatz von ‘wir’ und ‘sie’ kann stark kontrastierende Einheiten aneinander binden. Angesichts des heutigen China scheinen [VII-023] sich die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion gelegentlich als ‘wir’ zu empfinden. Das gleiche Phänomen, das übrigens auch gewisse Kennzeichen des Kampfes aufweist, kann man bei der Zeremonie des Triumph-Geschnatters der Graugänse beobachten“ (K. Lorenz, 1966, S. 189[30]). Ist die amerikanisch-sowjetische Haltung durch Instinktmuster determiniert, die wir von der Graugans ererbt haben? Geht es dem Verfasser um eine amüsante Formulierung, oder möchte er uns tatsächlich glauben machen, dass zwischen dem Verhalten der Gans und dem der amerikanischen und sowjetischen politischen Führer eine Beziehung besteht?
Lorenz geht mit seinen Analogien zwischen tierischem Verhalten (oder seiner Interpretation dieses Verhaltens) und seinen naiven Vorstellungen vom menschlichen Verhalten sogar noch weiter, wie aus seinen Äußerungen über menschliche Liebe und menschlichen Hass hervorgeht: „Ein persönliches Band, eine individuelle Freundschaft finden wir nur bei Tieren mit hoch entwickelter intraspezifischer Aggression, ja, dieses Band ist umso fester, je aggressiver die betreffende Tierart ist“ (K. Lorenz, 1963, S. 326). So weit, so gut; nehmen wir einmal an, dass Lorenz das richtig beobachtet hat. Aber an diesem Punkt springt er über in den Bereich der Humanpsychologie. Nachdem er festgestellt hat, dass die intraspezifische Aggression Millionen Jahre älter sei als die persönliche Freundschaft und Liebe, schließt er daraus: „Es gibt (...) keine Liebe ohne Aggression“ (K. Lorenz, 1963, S. 327; Hervorhebung E. F.). Diese verallgemeinernde Feststellung für die – soweit es sich um die menschliche Liebe handelt – keinerlei Tatsachen sprechen und der ganz im Gegenteil höchst augenfällige Tatsachen widersprechen, wird durch eine weitere Behauptung ergänzt, die sich nicht auf die intraspezifische Aggression, sondern auf den „hässlichen kleinen Bruder der großen Liebe“, den „Hass“, beziehen: „Anders als gewöhnliche Aggression, richtet er sich gegen ein Individuum, ganz wie die Liebe es tut, und wahrscheinlich hat er deren Vorhandensein zur Voraussetzung: Man kann wohl nur dort richtig hassen, wo man geliebt hat und es, wenn man das auch ableugnen möchte, immer noch tut“ (K. Lorenz, 1963, S. 328, Hervorhebung E. F.). Dass die Liebe sich gelegentlich in Hass verwandelt, ist schon oft gesagt worden, wenn es auch korrekter wäre, zu sagen, dass nicht die Liebe diese Wandlung erfährt, sondern der verletzte Narzissmus des Liebenden, das heißt, dass die Nicht-Liebe den Hass verursacht. Zu behaupten, man hasse nur, wo man geliebt habe, verwandelt dagegen das Element von Wahrheit, das in der Behauptung enthalten ist, in eine reine Absurdität. Hasst der Unterdrückte den Unterdrücker, hasst die Mutter des ermordeten Kindes dessen Mörder, hasst der Gefolterte seinen Folterer, weil sie ihn einmal geliebt haben oder ihn noch immer lieben? Ein weiterer Analogieschluss bezieht sich auf das Phänomen der „kämpferischen Begeisterung“. Es handelt sich dabei um „eine spezialisierte Form der gemeinschaftlichen Aggression, die sich deutlich von den primitiven Formen der weniger bedeutenden individuellen Aggression unterscheidet, mit ihr jedoch funktionell verwandt ist“ (K. Lorenz, 1966, S. 268). Es ist ein „heiliger Brauch“, der seine Motivationskraft phylogenetisch entwickelten Verhaltensmustern verdankt. Lorenz versichert, dass „nicht der geringste Zweifel bestehen kann, dass die kämpferische Begeisterung des Menschen sich aus einer gemeinschaftlichen Verteidigungsreaktion unserer vormenschlichen Ahnen entwickelt hat“ (K. Lorenz, 1966, S. 270). Es handelt sich um die von allen geteilte Begeisterung der Gruppe, die sich gegen einen gemeinsamen Feind verteidigt. [VII-024]
Jeder einigermaßen gefühlsstarke Mann kennt das subjektive Erleben, das mit der in Rede stehenden Reaktion einhergeht. Es besteht in erster Linie in der als Begeisterung bekannten Gefühlsqualität, dabei läuft einem ein „heiliger“ Schauer über den Rücken und, wie man bei genauer Beobachtung feststellt, auch über die Außenseite der Arme. Man fühlt sich aus allen Bindungen der alltäglichen Welt heraus- und emporgehoben, man ist bereit, alles liegen und stehen zu lassen, um dem Rufe der heiligen Pflicht zu gehorchen. Alle Hindernisse, die ihrer Erfüllung im Wege stehen, verlieren an Bedeutung und Wichtigkeit, die instinktiven Hemmungen, Artgenossen zu schädigen und zu töten, verlieren leider viel von ihrer Macht. Vernunftmäßige Erwägungen, alle Kritik sowohl wie die Gegengründe, die gegen das von der mitreißenden Begeisterung diktierte Verhalten sprechen, werden dadurch zum Schweigen gebracht, dass eine merkwürdige Umwertung aller Werte sie nicht nur haltlos, sondern geradezu niedrig und entehrend erscheinen lässt. Kurz, wie ein ukrainisches Sprichwort so wunderschön sagt: „Wenn die Fahne fliegt, ist der Verstand in der Trompete!“ (K. Lorenz, 1963, S. 385 f.)
Lorenz drückt „die begründete Hoffnung“ aus, „dass unser moralisches Verantwortungsgefühl den ursprünglichen Trieb unter Kontrolle bekommen kann, doch beruht unsere einzige Hoffnung, dass dies jemals geschehen wird, auf der demütigen Erkenntnis der Tatsache, dass die kämpferische Begeisterung eine instinktive Reaktion mit einem phylogenetisch determinierten Auslösemechanismus ist und dass der einzige Punkt, an dem eine intelligente und verantwortungsbewusste Erkenntnis sich diese Kontrolle verschaffen kann, in der Konditionierung der Reaktion auf ein Objekt liegt, das sich, wenn man es einer gründlichen kategorischen Prüfung unterzieht, als echter Wert erweist“ (K. Lorenz, 1966, S. 271).
Lorenz’ Beschreibung des normalen menschlichen Verhaltens ist verblüffend. Natürlich kommt es vor, dass „Menschen sich völlig im Recht fühlen, selbst wenn sie Gräueltaten begehen“ – oder, um es adäquater in der psychologischen Terminologie auszudrücken, viele begehen gerne Gräueltaten, ohne alle moralischen Hemmungen und ohne das geringste Schuldgefühl dabei zu empfinden. Aber es ist wissenschaftlich nicht zu vertreten, dass man, ohne auch nur den Versuch zu machen, Beweise dafür beizubringen, die Behauptung aufstellt, es handele sich dabei um eine universale menschliche Reaktion oder es liege in der „menschlichen Natur“, im Krieg Gräueltaten zu begehen und diese Behauptung mit einem angeblichen Trieb oder Instinkt zu begründen, der aus einer fragwürdigen Analogie mit Fischen und Vögeln hergeleitet wird.
Tatsache ist, dass Individuen und Gruppen sich ganz erheblich in ihrer Neigung unterscheiden, Gräueltaten zu begehen, wenn sie gegen eine andere Gruppe aufgehetzt sind. Im Ersten Weltkrieg musste die britische Propaganda die Geschichten von deutschen Soldaten, die belgische Babys aufgespießt haben sollen, erfinden, weil zu wenig wirkliche Gräueltaten vorgefallen waren, die den Hass gegen den Feind hätten nähren können. Entsprechend berichteten die Deutschen nur von wenigen Gräueltaten ihrer Feinde aus dem einfachen Grunde, weil nur so wenige sich ereignet hatten. Selbst während des Zweiten Weltkrieges blieben trotz der zunehmenden Brutalisierung der Menschheit die Gräueltaten im allgemeinen auf spezielle Nazi-Formationen beschränkt. Im allgemeinen begingen die regulären Truppen auf beiden Seiten keine Kriegsverbrechen in einem Maß, wie man es nach der Beschreibung von Lorenz vermuten sollte. Was er als Gräueltaten beschreibt, ist das Verhalten von sadistischen oder blutrünstigen Charaktertypen. Seine [VII-025] „kämpferische Begeisterung“ ist nichts anderes als eine nationalistische und emotional etwas primitive Reaktion. Zu behaupten, die Bereitschaft, Gräueltaten zu begehen, sobald die Fahne weht, sei ein instinktiv bedingter Teil der menschlichen Natur, wäre die klassische Verteidigung gegen die Beschuldigung, die Prinzipien der Genfer Konvention verletzt zu haben. Wenn ich auch sicher bin, dass Lorenz nicht die Absicht hat, Gräueltaten zu verteidigen, so läuft sein Argument doch praktisch auf eine solche Verteidigung hinaus. Seine Methode verhindert ein Verständnis der Charaktersysteme, in denen diese Gräueltaten wurzeln, und der individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen, die ihre Entwicklung verursachen.
Lorenz geht aber noch weiter, wenn er behauptet, dass ohne diese kämpferische Begeisterung (diesen „echt autonomen Instinkt des Menschen“) „weder Kunst noch Wissenschaft noch überhaupt irgendwelche großen Bestrebungen der Menschheit zustande gekommen wären“ (K. Lorenz, 1963, S. 388). Wie ist dies möglich, wenn es die erste Bedingung für die Manifestation dieses Instinktes ist, dass „eine soziale Gruppierung, mit der der Einzelne sich identifiziert, durch eine Gefahr von außen bedroht zu sein scheint“ (K. Lorenz, 1966, S. 272)? Gibt es irgendeinen Beleg dafür, dass Kunst und Wissenschaft nur dann blühen, wenn eine Bedrohung von außen existiert?
Lorenz erklärt die Liebe zum Nächsten, die darin zum Ausdruck kommt, dass man bereit ist, sein Leben für ihn aufs Spiel zu setzen, als „etwas Selbstverständliches, wenn es sich um unseren besten Freund handelt und er auch unser Leben mehrmals gerettet hat; dann tut man es, ohne darüber nachzudenken“ (K. Lorenz, 1966, S. 252). Beispiele für ein solches „anständiges Verhalten“ in kritischen Situationen sind leicht zu finden, „vorausgesetzt, sie kamen in der paläolithischen Periode oft genug vor, so dass sich phylogenetisch angepasste soziale Normen entwickeln konnten, die es erlaubten, mit der Situation fertig zu werden“ (K. Lorenz, 1966, S. 251 f.).
Eine solche Auffassung von der Liebe zum Nächsten ist eine Mischung aus Instinktivismus und Utilitarismus. Man rettet den Freund, weil er das eigene Leben schon mehrmals gerettet hat; wie, wenn er es nur einmal oder überhaupt noch nie getan hätte? Außerdem tut man es nur, weil es sich schon im Paläolithikum oft genug ereignet hat!
Schlussfolgerungen über den Krieg
Am Schluss seiner Analyse des Aggressionsinstinkts beim Menschen befindet sich Lorenz in einer Position, die der Freuds in seinem Brief an Einstein zum Thema Warum Krieg? (S. Freud, 1933b) ähnlich ist. Niemand ist glücklich darüber, wenn er zu Schlussfolgerungen gelangt, die offenbar darauf hinweisen, dass der Krieg nicht ausgerottet werden kann, weil er das Resultat eines Instinktes ist. Während Freud sich jedoch in einem sehr weiten Sinn als „Pazifist“ bezeichnen konnte, würde Lorenz kaum in diese Kategorie hineinpassen, wenn er sich auch klar darüber ist, dass ein Atomkrieg eine Katastrophe von nie dagewesenem Ausmaß sein würde. Er sucht nach Mitteln, die der Gesellschaft helfen könnten, die tragischen Auswirkungen des Aggressionsinstinktes zu vermeiden; tatsächlich ist er im nuklearen Zeitalter beinahe gezwungen, nach Möglichkeiten zu suchen, den Frieden zu erhalten, wenn er seine Theorie von der angeborenen Destruktivität des Menschen [VII-026] annehmbar machen will. Einige seiner Vorschläge ähneln denen Freuds, doch besteht ein beträchtlicher Unterschied. Freud macht seine Vorschläge mit Skepsis und Bescheidenheit, während Lorenz erklärt: „Im Gegensatz zu Faust bilde ich mir ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Mir scheint diese Meinung nicht überheblich (...)“ (K. Lorenz, 1963, S. 393).
Es wäre in der Tat nicht überheblich, wenn Lorenz wirklich etwas Wichtiges zu lehren hätte. Nur gehen seine Behauptungen leider kaum über abgenutzte Klischees hinaus, über „einfache Anweisungen“ gegen die Gefahr, dass „die Gesellschaft durch das falsche Funktionieren der sozialen Verhaltensmuster völlig desintegriert wird“.
- „Die erste und selbstverständliche Vorschrift ist (...): ‘Erkenne dich selbst!’“, worunter er „die Forderung nach Vertiefung unserer Einsicht in die Ursachenketten unseres eigenen Verhaltens“ – das heißt in die Gesetze der Evolution – versteht (K. Lorenz, 1963, S. 374). Ein Element dieser Einsicht, das von Lorenz besonders hervorgehoben wird, ist „die objektivphysiologische Erforschung der Möglichkeit, die Aggression in ihrer ursprünglichen Form an Ersatzobjekten abzureagieren“ (K. Lorenz, 1963, S, 394).
- „Die zweite ist die Untersuchung der sogenannten Sublimierung mit den Methoden der Psychoanalyse“ (K. Lorenz, 1963, S. 394).
- „(...) persönliche Bekanntschaft zwischen Menschen verschiedener Nationen und Parteien“ (K. Lorenz, 1963, S. 399).
- Die vierte und vielleicht wichtigste Maßnahme, „die sofort ergriffen werden könnte und müsste, (...) ist die einsichtige und kritische Beherrschung“ der im vorangehenden Kapitel besprochenen Begeisterung, das heißt, man müsste „der jüngeren Generation helfen, (...) echte Ziele zu finden, denen zu dienen sich in der modernen Welt lohnt“ (K. Lorenz, 1963, S. 401).
Wir wollen uns dieses Programm Punkt für Punkt näher ansehen.
Lorenz wendet die klassische Forderung „Erkenne dich selbst“ falsch an – und zwar nicht nur im Hinblick auf ihre griechische Bedeutung, sondern auch im Hinblick darauf, was Freud darunter versteht, der seine ganze Wissenschaft und die gesamte psychoanalytische Therapie auf die Selbsterkenntnis aufbaut. Für Freud bedeutet Selbsterkenntnis, dass der Mensch sich dessen bewusst wird, was unbewusst ist; es ist dies ein äußerst schwieriger Prozess, weil man dabei auf den Widerstand stößt, der sich einer Bewusstmachung des Unbewussten entgegenstellt. Selbsterkenntnis im Sinne von Freud ist nicht nur ein intellektueller Prozess, sondern gleichzeitig ein affektiver, wie er dies bereits für Spinoza war. Es ist nicht nur eine intellektuelle Erkenntnis, sondern auch eine Erkenntnis des Herzens. Sich selbst zu erkennen, bedeutet, sich eine größere intellektuelle und affektive Einsicht in bis dahin verborgene Teile der Psyche zu erwerben. Es ist ein Prozess, der bei einem Kranken, der von seinen Symptomen geheilt werden möchte, Jahre in Anspruch nehmen und ein ganzes Leben lang andauern kann, wenn jemand ernsthaft er selbst werden möchte. Er wirkt sich in einer Verstärkung der Energie aus, da diese jetzt von der Aufgabe befreit wird, Verdrängungen aufrechtzuerhalten; daher wird der Mensch umso wacher und freier, je mehr er mit seiner inneren Realität in Kontakt kommt. Was Lorenz dagegen unter „erkenne dich selbst“ versteht, ist etwas ganz anderes; es ist das theoretische Wissen um die Tatsachen der Evolution und speziell um den instinktiven Charakter der Aggression. Eine Analogie zu der Lorenz’schen Vorstellung von Selbsterkenntnis wäre [VII-027] etwa die theoretische Kenntnis von Freuds Theorie des Todestriebes. Nach den Argumenten von Lorenz zu urteilen, könnte sich die Psychoanalyse als Therapie praktisch auf die Lektüre der gesammelten Werke von Freud beschränken. Dabei fällt einem unwillkürlich der Ausspruch von Marx ein, dass das Wissen um die Gravitationsgesetze einen nicht vorm Ertrinken rettet, wenn man ins Wasser fällt, ohne schwimmen zu können. „Ärztliche Verordnungen zu lesen, macht niemand gesund“, sagt ein chinesischer Weiser.
Lorenz geht auf seine zweite Vorschrift, die Sublimierung, nicht näher ein. Was seinen dritten Vorschlag betrifft, die „Förderung von persönlichen Bekanntschaften zwischen Menschen verschiedener Nationen und Parteien“, so räumt Lorenz ein, dass es offensichtlich auf der Hand liege – selbst Fluggesellschaften machen für ihre internationalen Reisen damit Reklame, dass sie der Sache des Friedens dienten. Leider stimmt die Vorstellung nicht, nach der die persönliche Bekanntheit die Funktion hat, Aggression zu verringern. Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele. Die Engländer und die Deutschen kannten sich vor 1914 recht gut, und doch waren sie, als der Krieg ausbrach, von wildem gegenseitigem Hass erfüllt. Es gibt einen noch überzeugenderen Beweis. Bekanntlich löst kein Krieg zwischen verschiedenen Völkern so viel Hass und Grausamkeit aus wie ein Bürgerkrieg, in dem sich die beiden kriegführenden Parteien besonders gut kennen. Wird der Hass unter Familienmitgliedern etwa dadurch geringer, dass sie sich gut kennen?
Es ist nicht zu erwarten, dass „Bekanntschaft“ und „Freundschaft“ die Aggression mindert, weil es sich dabei nur um oberflächliches Wissen über einen anderen Menschen handelt, um die Kenntnis eines „Objektes“, das ich von außen betrachte. Es ist dies etwas völlig anderes als das in die Tiefe dringende, empathische Erkennen, bei dem ich das, was der andere erlebt, dadurch verstehe, dass ich Erfahrungen in mir mobilisiere, die – wenn sie auch nicht die gleichen sind – diesen doch ähneln. Ein Erkennen dieser Art erfordert, dass die meisten Verdrängungen in uns selbst so viel an Intensität verlieren, dass wir dem Bewusstwerden neuer Aspekte unseres Unbewussten nur noch geringen Widerstand entgegensetzen. Wird ein solches, nicht rein verstandesmäßig beurteilendes Verstehen erreicht, kann dies die Aggressivität herabsetzen oder ganz beseitigen; es hängt davon ab, bis zu welchem Grade der Betreffende seine eigene Unsicherheit, seine Gier und seinen Narzissmus überwunden hat, und nicht davon, wie viele Informationen er über andere besitzt.[31] Die letzte der vier Maßnahmen, die Lorenz vorschlägt, ist die „Neu-Orientierung der kämpferischen Begeisterung“. Zu seinen speziellen Empfehlungen gehört der Sport. [VII-028] Tatsache ist jedoch, dass der Kampfsport gerade sehr viel Aggression hervorruft. Wie intensiv diese Aggression ist, zeigte sich kürzlich, als der Gefühlsüberschwang bei einem internationalen Fußballspiel in Lateinamerika einen kleinen Krieg entfachte.
Wenn es keinen Beweis dafür gibt, dass Sport die Aggression herabsetzt, sollte man jedoch gleichzeitig darauf hinweisen, dass es auch keinen Beweis dafür gibt, dass Sport durch Aggression motiviert wird. Was oft beim Sport Aggression hervorruft, ist der Wettkampfcharakter der Veranstaltung, der in einem sozialen Wettbewerbsklima kultiviert und durch eine allgemeine Kommerzialisierung noch gesteigert wird, wo es nicht in erster Linie um den Stolz auf die Leistung, sondern um Geld und Publicity geht. Viele einsichtige Beobachter der unglückseligen Olympischen Spiele in München 1972 haben erkannt, dass sie nicht den guten Willen und den Frieden, sondern konkurrierende Aggressivität und Nationalstolz gesteigert haben.[32]
Es lohnt sich, einige weitere Äußerungen von Lorenz über Krieg und Frieden zu zitieren, da sie gute Beispiele für seine zwiespältige Haltung auf diesem Gebiet sind. Er sagt: „Angenommen, ich liebte mein Vaterland (was ich tue) und ich fühlte eine ungehemmte Feindseligkeit gegen ein anderes Land (was ich ganz gewiss nicht tue), so könnte ich trotzdem nicht von ganzem Herzen seine Vernichtung wünschen, wenn ich mir klarmachte, dass Menschen darin leben, die wie ich selbst begeistert auf dem Gebiet der induktiven Naturwissenschaft arbeiten, oder die Charles Darwin verehren und die Richtigkeit seiner Entdeckungen begeistert propagieren, oder noch andere, die meine Bewunderung für Michelangelos Kunst teilen oder meine Begeisterung für Goethes Faust oder für die Schönheit eines Korallenriffs oder für die Erhaltung des Lebens in der freien Natur oder für noch ein paar andere, weniger bedeutsame Dinge, die ich benennen könnte. Ich würde es ganz unmöglich finden, uneingeschränkt einen Feind zu hassen, wenn er nur eine meiner Identifikationen mit kulturellen und moralischen Werten teilte“ (K. Lorenz, 1966, S. 292; Hervorhebungen E. F.).
Lorenz schränkt seine Feststellung, er sei dagegen, dass man ein ganzes Land zerstöre, mit den Worten „von ganzem Herzen“ ein und außerdem dadurch, dass er den Hass als „uneingeschränkt“ qualifiziert. Aber was ist ein „halbherziger“ Wunsch nach Zerstörung oder ein „eingeschränkter“ Hass? Wichtiger noch ist, dass die Bedingung, unter der er die Zerstörung eines anderen Landes ablehnt, die ist, dass andere Menschen darin leben, die seine Vorlieben und seine Begeisterung für bestimmte Dinge teilen (unter denen, die Darwin verehren, scheinen nur jene qualifiziert zu sein, die auch seine Entdeckungen begeistert propagieren): Dass es sich um menschliche Wesen handelt, genügt nicht. Mit anderen Worten: Die totale Vernichtung eines Feindes ist nur dann nicht wünschenswert, wenn und weil er Lorenz’ eigener Kultur nahesteht und – spezieller – seinen eigenen Interessen und Wertbegriffen.
Am Charakter dieser Feststellungen ändert sich nichts, wenn Lorenz eine „humanistische Erziehung“ fordert – das heißt eine Erziehung, die ein Optimum an gemeinsamen Idealen bietet, mit denen sich der Einzelne identifizieren kann. Es war dies die auf den deutschen [VII-029] Gymnasien vor dem Ersten Weltkrieg übliche Art der Erziehung,[33] doch waren wohl die meisten Lehrer an diesen „humanistischen Gymnasien“ gerade durch ihre nationalistische und militaristische Haltung charakterisiert. Nur ein sehr andersartiger und radikaler Humanismus, einer, in dessen Zentrum das Leben, die menschliche Würde und das Wachstum des Individuums stehen, kann sich gegen den Krieg auswirken.
Die Vergötzung der Evolution
Man kann die Einstellung von Lorenz nicht völlig verstehen, wenn man sich nicht seine quasi-religiöse Haltung dem Darwinismus gegenüber klarmacht. Seine diesbezügliche Haltung ist keine Seltenheit und verdient daher eine genauere Untersuchung als wichtiges sozio-psychologisches Phänomen unserer gegenwärtigen Kultur. Das tiefe Bedürfnis des Menschen, sich in der Welt nicht einsam und verlassen zu fühlen, ist früher durch die Vorstellung gestillt worden, dass da ein Gott ist, der diese Welt geschaffen hat und sich um jede einzelne Kreatur kümmert. Als die Evolutionstheorie das Bild von Gott als dem obersten Schöpfer zerstörte, ging auch das Vertrauen in Gott als dem allmächtigen Vater des Menschen verloren, wenn auch viele den Glauben an Gott mit der Annahme der darwinistischen Theorie vereinbaren konnten. Bei vielen jedoch, für die Gott entthront war, blieb das Bedürfnis nach einer gottähnlichen Figur bestehen. Einige von ihnen verkündeten einen neuen Gott, die Evolution, und verehrten Darwin als seinen Propheten. Für Lorenz und viele andere wurde die Evolutionsidee zum Kern eines ganzen Systems ihrer Orientierung und Hingabe. Darwin hatte die letzte Wahrheit über den Ursprung des Menschen enthüllt; alle menschlichen Phänomene, die man mit ökonomischen, religiösen, ethischen oder politischen Erwägungen angehen und erklären konnte, waren vom Standpunkt der Evolution aus zu verstehen. Die quasi-religiöse Haltung dem Darwinismus gegenüber zeigt sich auch in dem Ausdruck „die großen Konstrukteure“, mit dem Lorenz die Selektion und die Mutation bezeichnet (Vgl. K. Lorenz, 1963, S. 20). Er spricht von den Methoden und Zielen dieser „großen Konstrukteure“ ganz ähnlich, wie ein Christ von den Werken Gottes spricht. Er gebraucht das Wort sogar im Singular und spricht vom „großen Konstrukteur“, womit er der Analogie zu Gott noch näher kommt. Nirgends dürfte dieser Götzendienst im Denken von Lorenz deutlicher zum Ausdruck kommen als im letzten Abschnitt seines Buches Das sogenannte Böse:
Als in der Stammesgeschichte mancher Wesen die Aggression gehemmt werden musste, um das friedliche Zusammenwirken zweier oder mehrerer Individuen zu ermöglichen, entstand das Band der persönlichen Liebe und Freundschaft, auf dem auch unsere menschliche Gesellschaftsordnung aufgebaut ist. Die heute neu auftretende Lebenslage der Menschheit macht unbestreitbar einen Hemmungsmechanismus nötig, der tätliche Aggressionen nicht nur gegen unsere persönlichen Freunde, sondern gegen alle Menschen verhindert. Daraus leitet sich die selbstverständliche, ja geradezu der Natur abgelauschte Forderung ab, alle unsere Menschenbrüder, ohne Ansehen der Person, zu lieben. Die Forderung ist nicht neu, unsere Vernunft vermag ihre Notwendigkeit, unser Gefühl ihre hehre Schönheit voll zu erfassen, aber dennoch vermögen wir sie, so wie wir beschaffen sind, nicht zu erfüllen. Das volle und warme Gefühl von Liebe und Freundschaft können wir nur für Einzelmenschen empfinden, daran kann der beste [VII-030] und stärkste Wille nichts ändern! Doch die großen Konstrukteure können es. Ich glaube, dass sie es tun werden, denn ich glaube an die Macht der menschlichen Vernunft, ich glaube an die Macht der Selektion und ich glaube, dass die Vernunft vernünftige Selektion treibt. Ich glaube, dass dies unseren Nachkommen in einer nicht allzu fernen Zukunft die Fähigkeit verleihen wird, jene größte und schönste Forderung wahren Menschentums zu erfüllen (K. Lorenz, 1963, S. 412 f.; Hervorhebungen E. F.).
Die großen Konstrukteure werden den Endsieg davontragen, wo Gott und die Menschen versagt haben. Das Gebot der brüderlichen Liebe wird unwirksam bleiben müssen, wenn nicht die großen Konstrukteure es zu neuem Leben erwecken. Die Erklärung endet mit einem echten Glaubensbekenntnis: Ich glaube, ich glaube, ich glaube ...
Der soziale und moralische Darwinismus[34], wie ihn Lorenz predigt, ist ein romantisches, nationalistisches Heidentum, das ein echtes Verständnis der biologischen, psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren, die für die menschliche Aggression verantwortlich sind, zu verdunkeln neigt. Hierin liegt der fundamentale Unterschied zwischen Lorenz und Freud, ungeachtet der Ähnlichkeiten in ihren Ansichten über Aggression. Freud war einer der letzten Vertreter der philosophischen Anschauungen der Aufklärung. Er glaubte aufrichtig an die Vernunft als die einzige Kraft, über die der Mensch verfügt und die allein ihn vor geistiger Verwirrung und Verfall retten kann. Er stellte die echte Forderung nach Selbsterkenntnis durch Aufdeckung der unbewussten Regungen des Menschen. Er überwand den Verlust Gottes, indem er sich der Vernunft zuwandte – und er war sich dabei seiner Schwäche schmerzlich bewusst. Aber er wandte sich nicht neuen Göttern zu.
2. Die Vertreter der Milieutheorie und die Behavioristen
Die Milieutheorie der Aufklärung
Eine diametral entgegengesetzte Einstellung zu der der Instinkt- und Triebforscher nehmen die Vertreter der Milieutheorie ein. Nach ihnen wird das menschliche Verhalten einzig und allein durch den Einfluss der Umwelt geformt, das heißt durch soziale und kulturelle Faktoren im Gegensatz zu den „angeborenen“. Dies trifft hauptsächlich auf die Aggression zu, eines der Haupthindernisse für den menschlichen Fortschritt.
In ihrer radikalsten Form wurde diese Auffassung bereits von den Philosophen der Aufklärung vertreten. Man stand auf dem Standpunkt, dass der Mensch „gut“ und vernünftig geboren werde. Wenn er böse Neigungen entwickelte, so war dies auf schlechte Einrichtungen, schlechte Erziehung und schlechte Beispiele zurückzuführen. Manche waren der Ansicht, dass es zwischen den Geschlechtern keine psychischen[35] Unterschiede gebe (I’âme n’a pas de sex, und meinten, die tatsächlich bestehenden Unterschiede seien – von den anatomischen abgesehen – ausschließlich auf Erziehung und soziale Umstände zurückzuführen. Im Gegensatz zum Behaviorismus jedoch interessierten sich diese Philosophen nicht für die Methoden des „human engineering“ und die Manipulation des Menschen, sondern für soziale und politische Veränderungen. Sie glaubten, die „gute Gesellschaft“ werde auch den guten Menschen erzeugen oder es ermöglichen, dass sein natürliches Gutsein zum Vorschein komme.
Der Behaviorismus
Der Behaviorismus wurde von J. B. Watson (1914) begründet. Er basiert auf der Prämisse, dass „der Gegenstand der Humanpsychologie das menschliche Verhalten“ ist. Wie der logische Positivismus klammerte er alle „subjektiven“ Faktoren, die nicht unmittelbar zu beobachten waren, wie „Empfindung, Wahrnehmung, Vorstellung, Begehren, ja sogar das Denken und Fühlen, insofern sie subjektiv bestimmt sind“, aus (J. B. Watson, 1958; dt.: 1930/1968, S. 35 f.). [VII-032]
Von den etwas naiven Formulierungen Watsons bis zu den brillanten neobehavioristischen von Skinner hat der Behaviorismus eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Doch handelt es sich dabei mehr um eine elegantere Formulierung der ursprünglichen These als um ihre Vertiefung oder um wirklich originelle Gedanken.
B. F. Skinners Neobehaviorismus
Skinners Neobehaviorismus[36] gründet sich auf dasselbe Prinzip wie Watsons Konzeptionen: Die Psychologie als Wissenschaft muss und darf sich nicht mit Gefühlen oder Impulsen oder irgendwelchen anderen subjektiven Vorkommnissen befassen[37]; er lehnt jeden Versuch ab, von der „Natur“ des Menschen zu sprechen oder ein Modell des Menschen zu konstruieren oder auch die verschiedenen Leidenschaften zu analysieren, die das menschliche Verhalten motivieren. Wollte man menschliches Verhalten als von Absichten, Zwecken und Zielen getrieben sehen, so wäre dies eine vorwissenschaftliche und nutzlose Art der Betrachtung. Die Psychologie hat sich mit der Untersuchung zu beschäftigen, welche „reinforcements“ (Verstärker) menschliches Verhalten formen und wie diese am wirksamsten anzuwenden sind. Skinners „Psychologie“ ist die Wissenschaft der Manipulation des Verhaltens; ihr Ziel ist, die richtigen „reinforcements“ herauszufinden, um ein erwünschtes Verhalten hervorzurufen.
Anstelle der einfachen Konditionierung im Pawlow’schen Modell spricht Skinner von der „operanten“ Konditionierung. Kurz gesagt bedeutet dies, dass ein unkonditioniertes Verhalten, sofern es vom Standpunkt des Experimentators wünschenswert ist, belohnt wird, das heißt Lustgefühle hervorruft. (Skinner hält „reinforcement“ durch Belohnung für weit wirksamer als durch Bestrafung.) Das Ergebnis ist, dass der Betreffende schließlich sich auch weiterhin in der gewünschten Weise verhalten wird. Zum Beispiel mag [VII-033] Johnny Spinat nicht besonders; er isst ihn trotzdem, die Mutter belohnt ihn dafür, indem sie ihn lobt, ihm einen freundlichen Blick schenkt oder ein Extrastück Kuchen gibt, je nachdem, was bei Johnny die größte nachhaltige Wirkung hat – das heißt, seine Mutter übt positives „reinforcement“ aus. Johnny wird schließlich so weit kommen, dass er Spinat gern isst, und dies besonders dann, wenn „reinforcement“ wirksam, weil planmäßig, angewandt wird. Skinner und andere haben die Techniken für diese operante Konditionierung in Hunderten von Experimenten entwickelt. Skinner hat nachgewiesen, dass durch die richtige Anwendung positiven „reinforcements“ das Verhalten von Tieren und Menschen in einem erstaunlichen Grad verändert werden kann, und dies selbst im Gegensatz zu dem, was einige etwas vage als „angeborene“ Neigungen bezeichnen.
Dies aufgezeigt zu haben, ist zweifellos das große Verdienst von Skinners experimenteller Arbeit. Es stützt auch die Ansichten derer, die glauben, dass die soziale Struktur (oder „Kultur“, wie sich die meisten amerikanischen Anthropologen ausdrücken) den Menschen formt, wenn auch nicht unbedingt durch operante Konditionierung. Wichtig ist es, hinzuzufügen, dass Skinner eine genetische Veranlagung nicht ausschließt. Um seine Position korrekt anzugeben, sollte man sagen, dass das Verhalten – abgesehen von der genetischen Veranlagung – völlig durch „reinforcements“ bestimmt wird.
„Reinforcement“ kann auf zweierlei Weise erfolgen: Entweder erfolgt es nach Skinner im normalen Kulturprozess. Oder es kann geplant werden und so zu einem „Kulturplan“ führen (B. F. Skinner, 1961; 1971).
Ziele und Werte
Skinners Experimente befassen sich nicht mit den Zielen der Konditionierung. Versuchstier oder die menschliche Versuchsperson werden konditioniert, dass sie sich auf bestimmte Weise verhalten. Wozu sie konditioniert werden, hängt von der Entscheidung des Versuchsleiters ab, der die Ziele für die Konditionierung festlegt. Im allgemeinen interessiert sich der Versuchsleiter bei diesen Laboratoriumssituationen nicht dafür, wozu er das Versuchstier beziehungsweise die Versuchsperson konditioniert, sondern vielmehr für die Tatsache, dass er sie für das von ihm gewählte Ziel konditionieren kann, und dafür, wie er dies am besten erreicht. Wenn wir uns jedoch vom Laboratorium den wirklichen Lebensbedingungen im individuellen oder gesellschaftlichen Leben zuwenden, erheben sich ernste Schwierigkeiten. In diesem Fall lauten die ausschlaggebenden Fragen: Wozu werden die Menschen konditioniert, und wer setzt diese Ziele fest?
Man hat den Eindruck, dass Skinner, wenn er von Kultur spricht, immer noch sein Laboratorium im Sinn hat, in dem der Psychologe, der ohne Werturteile verfährt, dies deshalb ohne Schwierigkeiten tun kann, weil das Ziel der Konditionierung kaum von Belang ist. Wenigstens dürfte das eine Erklärung dafür sein, dass Skinner mit dem Problem von Zielen und Werten nicht zu Rande kommt. So schreibt er zum Beispiel: „Wir bewundern Menschen, die sich auf originelle oder außergewöhnliche Weise verhalten, nicht deshalb, weil ein solches Verhalten an und für sich bewundernswert ist, sondern weil wir nicht wissen, wie wir ein originelles oder außergewöhnliches Verhalten auf andere Weise ermutigen könnten“ (C. R. Rogers und B. F. Skinner, 1956). Das ist nichts weiter als ein [VII-034] Denken im Kreis: Wir bewundern die Originalität, weil wir sie nur dadurch konditionieren können, dass wir sie bewundern.
Aber warum wollen wir sie überhaupt konditionieren, wenn sie an und für sich kein wünschenswertes Ziel ist? Skinner stellt sich diese Frage nicht, obgleich sie mit einem geringen Maß an soziologischer Analyse zu beantworten wäre. Der in den verschiedenen Klassen und Berufsgruppen einer bestimmten Gesellschaft wünschenswerte Grad an Originalität und Kreativität ist verschieden. Die Wissenschaftler und die Führungskräfte in der Industrie zum Beispiel brauchen in einer technologisch-bürokratischen Gesellschaft wie der unseren diese Eigenschaften in hohem Maß. Für Fabrikarbeiter dagegen wäre eine so hochgradige Kreativität ein Luxus – oder eine Gefahr für das reibungslose Funktionieren des Gesamtsystems.
Ich glaube nicht, dass diese Analyse das Problem der Originalität und Kreativität erschöpfend beantwortet. Psychologisch spricht viel dafür, dass das Streben nach Kreativität und Originalität im Menschen tiefverwurzelte Impulse sind, und auch auf neurophysiologischem Gebiet gibt es Anzeichen, die für die Annahme sprechen, dass das Streben nach Kreativität und Originalität in das System des Gehirns „eingebaut“ ist (R. B. Livingston, 1967). Ich möchte lediglich betonen, dass Skinner mit seiner Position deshalb an einem toten Punkt ankommt, weil er derartigen Spekulationen oder den Spekulationen der psychoanalytischen Soziologie keine Beachtung schenkt und daher glaubt, Fragen seien nicht zu beantworten, nur weil sie vom Behaviorismus nicht zu beantworten sind.
Auch folgendes Beispiel zeugt von Skinners verschwommenem Denken über Werte:
Die meisten Menschen würden der Behauptung zustimmen, dass in der Entscheidung, wie eine Atombombe herzustellen ist, kein Werturteil enthalten ist, sie würden dagegen der Behauptung widersprechen, dass die Entscheidung, eine solche zu bauen, kein Werturteil enthält. Der signifikanteste Unterschied dürfte hierbei darin liegen, dass die wissenschaftlichen Praktiken, die den Konstrukteur der Bombe leiten, klar vor Augen liegen, während dies bei dem Konstrukteur der Kultur, welche die Bombe baut, nicht der Fall ist. Wir können den Erfolg oder Misserfolg einer kulturellen Erfindung nicht mit derselben Genauigkeit voraussagen, wie wir das bei einer physikalischen Erfindung können. Deshalb heißt es, dass wir im zweiten Fall unsere Zuflucht zu Werturteilen nehmen. Wozu wir aber unsere Zuflucht nehmen, sind Vermutungen. Nur in diesem Sinne greifen Werturteile den Faden auf, wo die Wissenschaft ihn fallen lässt. Wenn wir die kleinen sozialen Interaktionen und möglicherweise auch ganze Kulturen erst einmal mit dem gleichen Maß an Sicherheit vorplanen können, wie wir es der physikalischen Technologie gegenüber besitzen, wird sich die Frage nach dem Wert gar nicht mehr stellen (B. F. Skinner, 1961, S. 545).
Skinners Hauptthese ist: Tatsache sei, dass weder bei dem technischen Problem der Konstruktion der Bombe noch bei der Entscheidung, sie zu bauen, ein Werturteil vorliegt. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die Motive für die Konstruktion der Bombe nicht „klar“ sind. Vielleicht sind sie für Professor Skinner nicht klar, aber für viele Historiker sind sie klar. Tatsächlich hat es mehr als einen Grund für die Entscheidung gegeben, die Atombombe (und ebenso die Wasserstoffbombe) zu bauen: Die Angst, dass Hitler die Bombe bauen würde; vielleicht auch der Wunsch, gegenüber der Sowjetunion bei späteren Konflikten über eine überlegene Waffe zu verfügen (dies gilt besonders für die Wasserstoffbombe); ferner die innere Logik eines Systems, das gezwungen ist, [VII-035] seine Rüstung ständig zu verstärken, um sich gegen konkurrierende Systeme behaupten zu können.
Ganz abgesehen von diesen militärischen, strategischen und politischen Gründen gibt es aber, glaube ich, noch einen anderen, nicht weniger wichtigen Grund. Ich meine die Maxime, die zu den axiomähnlichen Normen der kybernetischen Gesellschaft gehört: „Etwas muss getan werden, weil es technisch möglich ist.“ Wenn die Möglichkeit besteht, Kernwaffen herzustellen, dann müssen sie gebaut werden, selbst wenn sie uns alle vernichten könnten. Wenn es möglich ist, zum Mond oder zu den Planeten zu reisen, dann muss dies geschehen, selbst auf Kosten der vielen auf unserer Erde unerfüllten Bedürfnisse. Dieses Prinzip bedeutet die Negation aller humanistischen Werte, aber es repräsentiert trotzdem einen Wert, vielleicht sogar die höchste Norm der „technotronen“ Gesellschaft.[38]
Skinner macht sich nicht die Mühe zu untersuchen, aus welchen Gründen man die Bombe gebaut hat, und er verlangt von uns, dass wir abwarten, bis der Behaviorismus in seiner weiteren Entwicklung das Geheimnis lösen wird. In seinen Ansichten über die gesellschaftlichen Prozesse zeigt er dieselbe Unfähigkeit, die verborgenen, nicht verbalisierten Motive zu verstehen, wie dies auch bei seiner Behandlung der psychischen Prozesse zu beobachten ist. Da das meiste, was die Leute über ihre Motive im politischen wie in ihrem persönlichen Leben sagen, notorisch fiktiv ist, wird das Verständnis für die sozialen und psychischen Prozesse blockiert, wenn man sich allein auf das verlässt, was sprachlich geäußert wird. In anderen Fällen schmuggelt Skinner Wertbegriffe ein, ohne dass er es offenbar selber merkt. So schreibt er beispielsweise in der gleichen Abhandlung: „Ich bin sicher, dass niemand neue Herr-Knecht-Beziehungen entwickeln oder den Willen des Volkes mit neuen Methoden despotischen Machthabern unterwerfen möchte. Dies sind Kontrollmuster, die in eine Welt ohne Wissenschaft passen“ (Skinner, B. F., und C. R. Rogers, 1956, S. 1060). In welcher Epoche lebt Professor Skinner eigentlich? Gibt es keine Systeme, die effektiv den Willen des Volkes Diktatoren beugen möchten? Und sind diese Systeme tatsächlich nur in Kulturen „ohne Wissenschaft“ zu finden? Skinner glaubt offenbar noch immer an die veraltete Ideologie vom „Fortschritt“: Das Mittelalter war eine „finstere“ Zeit, weil es damals keine Wissenschaft gab, während die Wissenschaft notwendigerweise zur [VII-036] Freiheit des Menschen führen muss. Tatsache ist, dass kein politischer Führer und keine Regierung mehr ausdrücklich die Absicht zugeben werden, den Willen des Volkes zu beugen; man bedient sich da neuer Worte, die das Gegenteil der alten auszudrücken scheinen. Kein Diktator bezeichnet sich selbst als Diktator, und jedes System nimmt für sich in Anspruch, den Willen des Volkes zum Ausdruck zu bringen. Andererseits sind in den Ländern der „freien Welt“ die „anonyme Autorität“ und die Manipulation an die Stelle der offenen Autorität in Erziehung, Arbeit und Politik getreten.
Skinners Werturteile kommen auch in folgender Feststellung zum Ausdruck: „Wenn wir unseres demokratischen Erbes wert sind, werden wir natürlich bereit sein, uns jeder tyrannischen Benutzung der Wissenschaft zu unmittelbaren oder egoistischen Zwecken zu widersetzen. Aber wenn wir die Errungenschaften und Ziele der Demokratie hoch werten, dürfen wir uns nicht weigern, die Wissenschaft dazu zu verwenden, Kulturmodelle zu entwerfen und aufzubauen, selbst dann nicht, wenn wir uns dabei in gewissem Sinn in der Position von Kontrolleuren befinden“ (Skinner, B. F., und C. R. Rogers, 1956, S. 1065; Hervorhebungen E. F.).
Was liegt diesem Wertbegriff in der neobehavioristischen Theorie zugrunde? Was hat es mit den Kontrolleuren auf sich?
Skinners Antwort lautet, dass „alle Menschen kontrollieren und alle Menschen kontrolliert werden“ (Skinner, B. F., und C. R. Rogers, 1956, S. 1060). Dies klingt recht beruhigend für einen Menschen mit demokratischer Gesinnung, aber es handelt sich um eine vage und ziemlich bedeutungslose Formulierung, wie sich bald herausstellt:
Wenn wir feststellen, wie der Herr den Sklaven oder der Arbeitgeber den Arbeiter kontrolliert, übersehen wir meist die reziproken Wirkungen, und dadurch, dass wir die Aktion nur in einer Richtung beurteilen, gelangen wir dazu, Kontrolle als Ausbeutung oder wenigstens als die Erringung eines einseitigen Vorteils anzusehen; aber die Kontrolle wird in Wirklichkeit gegenseitig ausgeübt. Der Sklave kontrolliert den Herrn ebenso vollständig wie der Herr den Sklaven (im Original nicht kursiv) in dem Sinn, dass die Bestrafungsmethoden, die der Herr anwendet, durch das Verhalten des Sklaven, der sich ihnen unterwirft, ausgewählt wurden. Dies bedeutet nicht, dass der Begriff der Ausbeutung ohne Bedeutung ist oder dass wir nicht mit Recht fragen, cui bono? Wenn wir dies jedoch tun, gehen wir über die Feststellung der sozialen Episode selbst hinaus (im Original nicht kursiv) und erwägen die Wirkungen auf lange Sicht, die, klar ersichtlich, mit Werturteilen verbunden sind. Eine ähnliche Erwägung drängt sich auf bei der Analyse aller Verhaltensweisen, die eine kulturelle Praxis verändern (B. F. Skinner. 1961, S. 541).
Ich finde diese Behauptung empörend; wir sollen glauben, dass die Beziehung zwischen Herr und Sklave eine reziproke ist, und dies, obwohl die Idee der Ausbeutung nicht „ohne Bedeutung“ ist. Für Skinner ist die Ausbeutung nicht Teil der sozialen Episode selbst; nur die Kontrollmethoden sind es. Dies ist die Ansicht eines Mannes, der das soziale Leben so ansieht, als ob es sich um eine Episode in seinem Laboratorium handelte, wo es dem Experimentator allein auf seine Methode und nicht auf die „Episoden“ selbst ankommt, da es ja in dieser künstlichen Welt völlig irrelevant ist, ob die Ratte friedlich oder aggressiv ist. Und als ob das noch nicht genügte, stellt Skinner weiter fest, dass der Begriff der Ausbeutung durch den Herrn „klar ersichtlich“ mit Werturteilen verbunden ist. Glaubt Skinner, dass Ausbeutung oder schließlich auch Raub, Folter und Mord keine „Tatsachen“ sind, weil sie klar ersichtlich mit Wertbegriffen verbunden sind? Dies würde bedeuten, dass alle [VII-037] sozialen und psychologischen Phänomene, wenn sie auch nach ihrem Wert beurteilt werden können, damit aufhören, Tatsachen zu sein, die wissenschaftlich zu untersuchen sind.[39]
Man kann sich Skinners Behauptung, Sklave und Sklavenhalter stünden in einer reziproken Beziehung, nur damit erklären, dass er das Wort „Kontrolle“ in einem zwiespältigen Sinn verwendet. In dem Sinn, wie es im wirklichen Leben verwendet wird, kann kein Zweifel darüber bestehen, dass der Sklavenhalter den Sklaven kontrolliert und dass bei dieser Kontrolle von „reziprok“ nicht die Rede sein kann, außer in dem Sinn, dass der Sklave unter Umständen über ein Minimum an Gegenkontrolle verfügt – zum Beispiel durch die Drohung mit Rebellion. Aber das meint Skinner nicht. Er meint Kontrolle im höchst abstrakten Sinn des Laboratoriumexperiments, das nichts mit dem wirklichen Leben zu tun hat. Er wiederholt tatsächlich in vollem Ernst, was oft als Witz erzählt wird: Die Geschichte von der Ratte, die einer anderen Ratte erzählt, wie gut sie ihren Experimentator konditioniert habe: Immer, wenn sie einen bestimmten Hebel niederdrücke, müsse der Mann sie füttern.
Da der Neobehaviorismus über keine Theorie des Menschen verfügt, kann er nur das Verhalten sehen und nicht die sich verhaltende Person. Ob jemand mich anlächelt, weil er seine Feindseligkeit verbergen möchte, oder ob eine Verkäuferin lächelt, weil man ihr das Lächeln (in den besseren Geschäften) beigebracht hat, oder ob ein Freund mir zulächelt, weil er sich freut, mich wiederzusehen, all das bedeutet für den Neobehaviorismus keinen Unterschied, denn „ein Lächeln ist ein Lächeln“. Dass es für Professor Skinner als Person keinen Unterschied macht, ist nur schwer zu glauben, außer er wäre ein so entfremdeter Mensch, dass die Realität wirklicher Menschen für ihn bedeutungslos geworden wäre. Wenn ihm aber der Unterschied etwas ausmacht, wie kann dann eine Theorie, die keine Notiz davon nimmt, Gültigkeit haben?
Der Neobehaviorismus kann auch nicht erklären, wieso nicht wenige Personen, die darauf konditioniert sind, Verfolger und Folterer zu sein, geisteskrank werden, obwohl die „positiven reinforcements“ weiterlaufen. Warum hindert positives „reinforcement“ viele andere nicht daran, aus der Kraft ihrer Vernunft, ihres Gewissens oder ihrer Liebe heraus aufzubegehren, wenn die gesamte Konditionierung in entgegengesetzter Richtung wirkt? Und warum sind viele der am meisten angepassten Menschen, die Star-Zeugen für den Erfolg der Konditionierung sein sollten, oft tief unglücklich, und warum leiden sie unter seelischen Störungen oder Neurosen? Es muss Impulse im Menschen geben, die der Macht der Konditionierung Grenzen setzen; vom Standpunkt der Wissenschaft aus dürfte es genauso wichtig sein, das Versagen der Konditionierung zu untersuchen wie ihren Erfolg. Natürlich ist der Mensch auf nahezu jede gewünschte Weise zu konditionieren, aber eben nur „nahezu“. Er reagiert auf diese Konditionierung, die mit grundlegenden menschlichen Erfordernissen in Konflikt steht, auf verschiedene und feststellbare Weise. Er kann dazu konditioniert werden, ein Sklave zu sein, aber er wird mit Aggression darauf reagieren oder eine Einbuße seiner Vitalität erleiden; oder er kann konditioniert [VII-038] werden, sich als Teil einer Maschine zu fühlen, und er wird darauf mit Überdruss, Aggression und Unglücklichsein reagieren.
Im Grunde ist Skinner ein naiver Rationalist, der die menschlichen Leidenschaften unbeachtet lässt. Im Gegensatz zu Freud lässt er sich von der Macht der Leidenschaften nicht beeindrucken, sondern glaubt, der Mensch verhalte sich stets so, wie es sein Eigennutz verlange. Tatsächlich besteht das gesamte Prinzip des Neobehaviorismus darin, dass der Eigennutz als so mächtig angesehen wird, dass das Verhalten eines Menschen völlig dadurch zu determinieren ist, dass man an diesen Eigennutz appelliert – und dies hauptsächlich in der Form, dass die Umgebung den Betreffenden dafür belohnt, dass er sich im gewünschten Sinn verhält. Letzten Endes gründet sich der Neobehaviorismus auf die Quintessenz des bürgerlichen Axioms vom Primat des Egoismus und Eigennutzes gegenüber allen anderen menschlichen Leidenschaften.
Die Gründe für Skinners Popularität
Skinners außergewöhnliche Popularität lässt sich damit erklären, dass es ihm gelungen ist, die Elemente des traditionellen, optimistischen liberalen Denkens mit der sozialen und geistigen Wirklichkeit der kybernetischen Gesellschaft zu verschmelzen.
Skinner glaubt, dass der Mensch formbar und den sozialen Einflüssen unterworfen ist und dass in seiner „Natur“ nichts vorhanden ist, was man als endgültiges Hindernis für die Entwicklung auf eine friedliche und gerechte Gesellschaft hin ansehen könnte. So zieht sein System all jene Psychologen an, die zu den Liberalen gehören und die in Skinners System ein Argument finden, mit dem sie ihren politischen Optimismus verteidigen können. Er appelliert an alle, die glauben, dass wünschenswerte gesellschaftliche Ziele wie Frieden und Gleichheit nicht nur Ideale im luftleeren Raum sind, sondern dass sie sich verwirklichen lassen. Die ganze Idee, dass man eine bessere Gesellschaft auf wissenschaftlicher Basis „konstruieren“ kann, spricht viele an, die früher Sozialisten geworden wären. Wollte nicht auch Marx eine bessere Gesellschaft konstruieren? Hat er nicht seine Art von Sozialismus als „wissenschaftliche“ im Gegensatz zum „utopischen“ Sozialismus bezeichnet? Ist Skinners Methode nicht in einem geschichtlichen Augenblick besonders attraktiv, in dem politische Lösungen versagt zu haben scheinen und die revolutionären Hoffnungen auf einem Tiefpunkt angekommen sind?
Aber Skinners Optimismus allein hätte seine Ideen nicht so attraktiv gemacht, wenn er die traditionellen liberalen Ideen nicht mit ihrer ausgesprochenen Negation kombiniert hätte. Im kybernetischen Zeitalter wird der Einzelne immer mehr Gegenstand der Manipulation. Seine Arbeit, sein Konsum und seine Freizeit werden durch die Reklame, durch Ideologien und durch das, was Skinner als „positive reinforcement“ bezeichnet, manipuliert. Der Einzelne verliert seine aktive, verantwortliche Rolle im gesellschaftlichen Prozess; er wird völlig „ angepasst“ und lernt, dass jedes Verhalten, jeder Akt, jeder Gedanke und jedes Gefühl, das nicht in das allgemeine Schema hineinpasst, sich für ihn höchst nachteilig auswirkt; er ist effektiv das, was man von ihm erwartet. Wenn er sich darauf versteift, er selbst zu sein, riskiert er in Polizeistaaten seine Freiheit oder sogar sein Leben; in einigen Demokratien riskiert er, nicht befördert zu werden, oder, seltener, [VII-039] riskiert er seine Stelle, und – was vielleicht das Wichtigste ist – er riskiert, sich isoliert, ohne Kommunikation mit anderen zu fühlen. Während sich die meisten Menschen ihres inneren Unbehagens nicht klar bewusst sind, haben sie doch ein unbestimmtes Gefühl der Lebensangst, sie fürchten sich vor der Zukunft und vor der Langeweile, die das Einerlei und die Sinnlosigkeit ihres Tuns hervorrufen. Sie fühlen, dass eben die Ideale, an die sie gerne glauben möchten, ihre Verankerung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit verloren haben. Welche Erleichterung bedeutet es für sie, wenn sie erfahren, dass die Konditionierung die beste, progressivste und wirksamste Lösung ist. Skinner empfiehlt die Hölle des isolierten, manipulierten Menschen des kybernetischen Zeitalters als das Paradies des Fortschritts. Er beschwichtigt unsere Angst davor, wohin wir treiben, indem er uns sagt, wir brauchten keine Angst zu haben, die Richtung, die unser industrielles System eingeschlagen habe, sei die gleiche, die die großen Humanisten sich erträumt hätten, nur dass jetzt alles wissenschaftlich unterbaut sei. Überdies klingt Skinners Theorie wahr, da sie auf den entfremdeten Menschen der kybernetischen Gesellschaft (fast) zutrifft. Kurz, der Skinnerismus ist die Psychologie des Opportunismus, der sich als wissenschaftlicher Humanismus auftakelt.
Ich will damit nicht sagen, dass Skinner diese Apologetenrolle für das „technotrone“ Zeitalter spielen möchte. Im Gegenteil veranlasst ihn seine politische und gesellschaftliche Naivität gelegentlich dazu, Dinge zu schreiben, die überzeugender (und verwirrter) sind, als das möglich wäre, wenn er sich dessen bewusst wäre, wozu er uns da zu konditionieren versucht.
Behaviorismus und Aggression
Die behavioristische Methode ist für das Problem der Aggression so wichtig, weil in den Vereinigten Staaten die meisten Forscher, die sich mit der Aggression beschäftigt haben, behavioristisch orientiert sind. Ihre Argumentation lautet kurz gesagt: Wenn Johnny entdeckt, dass, wenn er sich aggressiv verhält, sein kleinerer Bruder (oder seine Mutter usw.) ihm das gibt, was er will, so wird er zu einem Menschen, der dazu neigt, sich aggressiv zu verhalten; das gleiche würde auch für ein unterwürfiges, mutiges oder liebevolles Verhalten zutreffen. Die Formel lautet, dass man so handelt, fühlt und denkt, wie es sich als erfolgreiche Methode zur Erlangung dessen, was man haben möchte, erwiesen hat. Die Aggression ist wie alle anderen Verhaltensformen nur angelernt und beruht darauf, dass man sich einen möglichst großen Vorteil zu erringen sucht.
Die behavioristische Ansicht über die Aggression hat A. H. Buss definiert als „Reaktion, die Reize liefert, welche anderen Organismen schaden“. Er schreibt:
Es gibt zwei Gründe dafür, dass man den Begriff der Absicht aus der Definition der Aggression ausklammert. Einmal impliziert er eine Teleologie, einen zweckgerichteten Akt, der auf ein zukünftiges Ziel ausgerichtet ist, und diese Ansicht verträgt sich nicht mit der in diesem Buch vertretenen behavioristischen Auffassung. Zweitens, was noch wichtiger ist, ist es schwierig, diesen Begriff auf Geschehen im behavioristischen Sinn anzuwenden. Absicht ist ein privates Geschehen, das verbalisiert werden kann oder auch nicht, das mit einer verbalen Feststellung genau wiedergegeben werden kann oder nicht. Man könnte „Absicht“ aus der „reinforcement“-Geschichte eines Organismus ableiten. Wenn eine aggressive Reaktion durch eine spezifische Konsequenz, wie zum [VII-040] Beispiel durch die Flucht des Opfers, systematisch verstärkt wurde, könnte man sagen, dass die Wiederholung der aggressiven Reaktion „die Absicht, Flucht hervorzurufen“, enthält. Eine derartige Schlussfolgerung ist jedoch bei der Analyse des Verhaltens überflüssig; fruchtbarer ist, die Beziehung zwischen der „reinforcement“-Geschichte einer aggressiven Reaktion und der unmittelbaren Situation, welche die Reaktion auslöst, zu untersuchen.
Im Ganzen gesehen ist die Absicht bei der Analyse des aggressiven Verhaltens nur hinderlich und überflüssig; worum es geht, ist vielmehr die Eigenart der „reinforcement“-Folgen, welche das Auftauchen und die Stärke der aggressiven Reaktionen beeinflussen. Mit anderen Worten fragt es sich, welche Arten von „reinforcement“ das aggressive Verhalten beeinflussen (A. H. Buss, 1961, S. 2).
Unter „Absicht“ versteht Buss eine bewusste Absicht. Aber Buss lehnt die psychoanalytische Auffassung nicht völlig ab: „Wenn der Zorn nicht der Antrieb für die Aggression ist, ist es dann fruchtbar, in ihm einen Antrieb zu sehen? Die hier vertretene Position lautet, dass es nicht fruchtbar ist“ (A. H. Buss, 1961, S. 11).[40]
So hervorragende behavioristische Psychologen wie A. H. Buss und L. Berkowitz haben ein weit größeres Einfühlungsvermögen in das Phänomen des menschlichen Fühlens als Skinner, doch bekennen auch sie sich zu Skinners Grundsatz, dass die Tat und nicht der Täter Objekt der wissenschaftlichen Beobachtung ist. Hierdurch legen sie nicht genügend Gewicht auf die fundamentalen Entdeckungen Freuds: die Entdeckung, dass psychische Kräfte das Verhalten determinieren, dass diese Kräfte weitgehend unbewusst sind und dass die Bewusstwerdung („Einsicht“) ein Faktor ist, der Veränderungen in der Energieladung und Richtung dieser Kräfte bewirken kann.
Die Behavioristen erheben den Anspruch, ihre Methode sei „wissenschaftlich“, weil sie sich mit dem befassen, was sichtbar ist, das heißt mit beobachtbaren Verhaltensweisen. Aber sie machen sich nicht klar, dass man das „Verhalten“ selbst, getrennt von der sich verhaltenden Person, nicht adäquat beschreiben kann. Ein Mann feuert einen Revolver ab und tötet eine andere Person; der Verhaltensakt an sich – das Abfeuern des Schusses, der die Person tötet – bedeutet psychologisch, vom „Aggressor“ isoliert, wenig. Tatsächlich wäre eine behavioristische Feststellung nur bezüglich des Revolvers adäquat; hinsichtlich des Revolvers ist das Motiv des Mannes, der abgedrückt hat, irrelevant. Aber das Verhalten des Mannes kann man nur ganz verstehen, wenn wir seine bewussten und unbewussten Motive kennen, die ihn veranlassten, abzudrücken. Wir finden dabei nicht nur eine einzige Ursache für sein Verhalten, sondern wir sind in der Lage, die innere psychische Struktur des Mannes zu entdecken – seinen Charakter – und die vielen bewussten und unbewussten Faktoren, die ihn an einem bestimmten Punkt veranlassten, den Revolver abzufeuern. Wir stellen fest, dass wir seinen Impuls, den Revolver abzufeuern, damit erklären können, dass er von vielen Faktoren in seinem Charakter-System determiniert war, dass aber der Akt des Schießens selbst der am meisten dem Zufall unterworfene aller Faktoren und daher am wenigsten vorauszusagen ist. Er hängt von vielen zufälligen situationsbedingten Elementen ab, wie zum Beispiel davon, ob dem Betreffenden gerade ein Revolver zur [VII-041] Hand war, ob andere Leute in der Nähe waren, ferner vom augenblicklichen Grad seines Stresses und dem allgemeinen Zustand seines psychophysischen Systems.
Die behavioristische Maxime, dass beobachtbares Verhalten eine wissenschaftlich zuverlässige Größe sei, stimmt einfach nicht. Tatsache ist, dass das Verhalten selbst Unterschiede aufweist, die vom motivierenden Impuls abhängen, selbst dann, wenn der Unterschied bei oberflächlicher Beobachtung nicht sichtbar ist.
Ein einfaches Beispiel kann dies zeigen: Zwei Väter von verschiedener Charakterstruktur schlagen ihren Sohn, weil sie glauben, das Kind brauche diese Strafe für seine gesunde Entwicklung. Die beiden Väter verhalten sich scheinbar identisch. Sie verhauen ihren Sohn mit der Hand. Wenn wir jedoch das Verhalten eines liebenden, fürsorglichen Vaters mit dem eines sadistischen vergleichen, finden wir, dass das Verhalten der beiden in Wirklichkeit nicht das gleiche ist. Die Art, wie sie das Kind halten und wie sie vor und nach der Strafe mit ihm reden, ihr Gesichtsausdruck, all das bewirkt, dass sich das Verhalten des einen stark von dem des anderen unterscheidet. Entsprechend unterscheidet sich auch die Reaktion der Kinder. Das eine Kind fühlt die destruktive oder sadistische Qualität der Strafe; das andere hat keinen Grund, an der Liebe seines Vaters zu zweifeln. Das gilt umso mehr, als dieses Einzelbeispiel für das Verhalten des Vaters nur eine unter zahllosen Verhaltensweisen darstellt, die das Kind zuvor erlebt hat und die sein Bild vom Vater und seine Reaktionen auf ihn geformt haben. Die Tatsache, dass beide Väter überzeugt sind, dass sie das Kind zu seinem eigenen Besten strafen, ändert daran kaum etwas, außer dass diese moralistische Überzeugung unter Umständen Hemmungen beseitigt, die der sadistische Vater sonst vielleicht hätte. Wenn der sadistische Vater andererseits sein Kind nie schlägt, weil er vielleicht Angst vor seiner Frau hat oder weil es im Widerspruch zu seinen progressiven Erziehungsideen stünde, wird sein „gewaltloses“ Verhalten trotzdem die gleiche Reaktion hervorrufen, weil sein Blick dem Kind denselben sadistischen Impuls mitteilt, den seine Hände ihm vermitteln würden, wenn sie zuschlagen würden. Da Kinder in der Regel sensibler sind als Erwachsene, reagieren sie auf den Impuls ihres Vaters und nicht auf ein isoliertes Teilstück seines Verhaltens.
Nehmen wir ein anderes Beispiel: Wir sehen einen Mann, der brüllt und ein rotes Gesicht hat. Wir beschreiben sein Verhalten so, dass wir sagen, er sei „wütend“. Wenn wir fragen, warum er wütend ist, kann die Antwort lauten: „Weil er Angst hat.“ – „Warum hat er Angst?“ – „Weil er unter einem tiefen Gefühl der Impotenz leidet.“ – „Woher kommt das?“ – „Weil er seine Mutterbindung nie lösen konnte und emotional noch ein kleines Kind ist.“ (Diese Konsequenz ist natürlich nicht die einzig mögliche.) Jede dieser Antworten ist „wahr“. Der Unterschied liegt nur darin, dass sie sich auf ein immer tieferes und gewöhnlich weniger bewusstes Erlebnisniveau beziehen. Je tiefer das Niveau liegt, auf das die Antwort sich bezieht, umso relevanter ist sie für das Verständnis seines Verhaltens. Nicht nur für das Verständnis seiner Motivationen, sondern dafür, dass man sein Verhalten in allen Einzelheiten durchschaut. In einem Fall wie diesem wird ein Beobachter mit Einfühlungsvermögen zum Beispiel auf seinem Gesicht eher den Ausdruck erschrockener Hilflosigkeit als nur den der Wut wahrnehmen. In einem anderen Fall kann das augenfällige Verhalten eines Mannes genau das gleiche sein, und doch wird sein Gesicht, wenn man es mit diesem Einfühlungsvermögen betrachtet, Härte und einen intensiven Zerstörungsdrang offenbaren. Sein zorniges Verhalten ist nur der unter [VII-042] Kontrolle gehaltene Ausdruck seiner destruktiven Impulse. Die beiden ähnlichen Verhaltensweisen sind effektiv ganz unähnlich, und man kann, abgesehen von dem intuitiven Einfühlungsvermögen, die Unterschiede wissenschaftlich nur verstehen, wenn man auch die Motivation – das heißt die jeweilige Charakterstruktur – versteht.
Ich habe nicht die übliche Antwort gegeben: „Er ist wütend, weil er beleidigt wurde – oder sich beleidigt fühlt.“ Eine solche Erklärung legt allen Nachdruck auf den auslösenden Impuls und übersieht, dass die Fähigkeit des Reizes, eine Reaktion auszulösen, auch von der Charakterstruktur der stimulierten Person abhängt. Eine Gruppe von Personen wird je nach dem Charakter des Einzelnen, auf den gleichen Reiz verschieden reagieren. A kann von dem Reiz angezogen werden; B kann davon abgestoßen werden; C kann davor erschrecken; D wird ihn ignorieren.
Buss hat recht, wenn er sagt, dass die Absicht ein privates Vorkommnis ist, das sich in Worte fassen lässt oder nicht. Aber gerade darin liegt das Dilemma des Behaviorismus: Da er keine Methode besitzt, nicht-verbalisierte Daten zu untersuchen, muss er seine Untersuchungen auf Daten beschränken, mit denen er fertig wird und die gewöhnlich zu grob sind, um einer subtilen theoretischen Analyse zu genügen.
Über psychologische Experimente
Wenn ein Psychologe sich die Aufgabe stellt, menschliches Verhalten zu verstehen, so muss er Untersuchungsmethoden wählen, die dem Studium menschlicher Wesen in vivo gerecht werden, während praktisch alle behavioristischen Untersuchungen in vitro vorgenommen werden. (Ich meine dieses Wort nicht im Sinne des physiologischen Laboratoriums, sondern in einem äquivalenten Sinn, nämlich dass der Betreffende unter kontrollierten, künstlich herbeigeführten Bedingungen und nicht im „realen“ Lebensprozess beobachtet wird.) Es hat den Anschein, als ob sich die Psychologie Respektabilität verschaffen wollte, indem sie die Methoden der Naturwissenschaft nachahmte, allerdings solche, die vor fünfzig Jahren ihre Gültigkeit hatten, und nicht die „wissenschaftlichen“ Methoden, die in den fortgeschrittensten Zweigen der Naturwissenschaft üblich sind.[41] Fernerhin versteckt sich der Mangel an theoretischer Bedeutung oft hinter eindrucksvoll wirkenden mathematischen Formeln, die nichts mit den Daten zu tun haben und ihren Wert in keiner Weise erhöhen.
Eine Methode für die Beobachtung und Analyse menschlichen Verhaltens außerhalb des Laboratoriums auszuarbeiten, ist ein schwieriges Unterfangen, jedoch ist es eine notwendige Voraussetzung für ein Verständnis des Menschen. Grundsätzlich gibt es zwei Beobachtungsbereiche für das Studium des Menschen:
- Die eine Methode besteht in der direkten und detaillierten Beobachtung einer anderen Person. Die bestentwickelte und fruchtbarste Situation dieser Art ist die psychoanalytische, das „psychoanalytische Laboratorium“, wie Freud es ausgearbeitet hat. Es gibt dem Patienten die Möglichkeit, seine unbewussten Impulse zum Ausdruck zu bringen, und [VII-043] erlaubt gleichzeitig, ihren Zusammenhang mit seinem nach außen sichtbaren „normalen“ und „neurotischen“ Verhalten zu untersuchen.[42] Weniger intensiv, aber auch recht fruchtbar, ist ein Interview oder besser eine Reihe von Interviews, zu denen möglichst auch die Untersuchung einiger Träume und einige projektive Tests gehören sollten. Man sollte jedoch auch die tiefenpsychologischen Erkenntnisse nicht unterschätzen, die ein geübter Beobachter schon allein dadurch gewinnen kann, dass er einen Menschen eine Zeitlang genau beobachtet (natürlich einschließlich seiner Gesten, seiner Stimme, seiner Haltung, seines Gesichtsausdrucks, seiner Hände usw.). Selbst dann, wenn man den Betreffenden nicht persönlich kennt und keine Tagebücher und Briefe und keine detaillierte Lebensgeschichte zur Verfügung hat, kann diese Art der Beobachtung doch eine wichtige Quelle für ein tiefenpsychologisches Verständnis seines Charakters sein.
- Eine weitere Methode zur Untersuchung des Menschen in vivo besteht darin, dass man, anstatt das Leben in das psychologische Laboratorium hereinzuholen, bestimmte, im Leben gegebene Situationen in ein „natürliches Laboratorium“ umwandelt. Anstatt dass man eine künstliche soziale Situation konstruiert, wie der Experimentator das in seinem psychologischen Laboratorium tut, studiert man die Experimente, die uns das Leben selbst bietet. Man wählt sich gegebene soziale Situationen aus, die vergleichbar sind, und verwandelt sie durch die Methode der Untersuchung in entsprechende Experimente. Dadurch, dass man bestimmte Faktoren konstant und andere variabel hält, erlaubt dieses natürliche Laboratorium auch die Überprüfung verschiedener Hypothesen. Es gibt viele vergleichbare Situationen, und man kann testen, ob eine Hypothese allen diesen Situationen gerecht wird, und – falls das nicht der Fall ist –, ob sich eine ausreichende Erklärung für diese Ausnahme finden lässt, ohne dass man die Hypothese ändert. Zu den einfachsten Formen solcher „natürlichen Experimente“ gehören die Enquêtes (unter Benutzung langer und offener Fragebögen beziehungsweise persönlicher Interviews) mit ausgewählten Vertretern gewisser Gruppen, wie Alters- oder Berufsgruppen, Gefangenen, Krankenhausinsassen und so weiter. (Die Anwendung der üblichen psychologischen Testreihen genügt meiner Ansicht nach jedoch nicht zu einem Verständnis des Charakters in seinen tieferen Schichten.)
Selbstverständlich können wir mit diesen „natürlichen Experimenten“ nicht die „Exaktheit“ der Laboratoriumsexperimente erreichen, da nie zwei soziale Konstellationen identisch sind. Aber wenn man keine „Versuchspersonen“, sondern Menschen, keine Artefakte, sondern das Leben beobachtet, so braucht man für eine angebliche (und oft zweifelhafte) Exaktheit nicht den Preis zu zahlen, dass bei diesen Experimenten triviale Ergebnisse herauskommen. Ich meine, dass, was die Analyse des Verhaltens betrifft, die Erforschung der Aggression entweder im Laboratorium des psychoanalytischen Interviews oder in einem sozial gegebenen „Laboratorium“ vom wissenschaftlichen Standpunkt aus den Methoden des psychologischen Laboratoriums weit vorzuziehen ist. Allerdings erfordert es ein weit höheres Niveau komplexen theoretischen Denkens als selbst sehr scharfsinnig ausgedachte Laboratoriumsexperimente.[43] [VII-044]
Zur Veranschaulichung des eben Gesagten wollen wir uns eine interessante Untersuchung näher ansehen, die Stanley Milgram in seinem „Interaktions-Laboratorium“ an der Yale University durchführte, nämlich seine Behavioral Study of Obedience; sie gehört zu den Untersuchungen auf dem Gebiet der Aggression, die große Beachtung gefunden haben (S. Milgram, 1963).[44]
Die Versuchspersonen waren 40 Männer zwischen 20 und 50 Jahren aus New Haven und den umliegenden Gemeinden. Wir verschafften uns die Versuchspersonen durch eine Zeitungsanzeige und direkte Aufforderung durch die Post. Wer auf unsere Aufforderung einging, tat dies in der Meinung, an einer Gedächtnis- und Lernuntersuchung an der Yale-University teilzunehmen. Das Sample umfasste einen weiten Bereich von Berufsgruppen. Typische Versuchspersonen waren Postangestellte, Highschool-Lehrer, Verkäufer, Ingenieure und Arbeiter. Ihrem Bildungsniveau nach rangierten sie von einem Teilnehmer, der die Grundschule nicht fertig absolviert hatte, bis zu Inhabern des Doktorgrades und anderer akademischer Grade. Sie erhielten für ihre Teilnahme am Experiment 4,50 Dollar. Man teilte ihnen jedoch mit, dass sie das Geld nur für ihr Erscheinen im Laboratorium erhielten und dass das Geld ihnen gehören würde, ganz gleich, was nach ihrer Ankunft sich dort ereigne.
An jedem Experiment waren eine nichtsahnende Versuchsperson und ein „Opfer“ (eine vom Versuchsleiter eingeweihte Person) beteiligt. Wir mussten uns einen Vorwand ausdenken, um die Verabreichung eines Elektroschocks durch die nichtsahnende Versuchsperson zu rechtfertigen.[45] Dies geschah mit Hilfe einer entsprechenden Deckgeschichte. Nach einer allgemeinen Einführung in die mutmaßliche Beziehung zwischen Strafe und Lernen sagten wir zu unseren Versuchspersonen:
„Wir wissen nur sehr wenig über die Wirkung der Strafe auf das Lernen, weil hierüber bei Menschen noch fast keine wissenschaftlichen Untersuchungen vorliegen. So wissen wir zum Beispiel nicht, wieviel Strafe für das Lernen am vorteilhaftesten ist – und welchen Unterschied es macht, wer die Strafe verabreicht, ob ein Erwachsener besser von jemand lernt, der jünger oder der älter ist als er selbst – und noch vieles mehr.
Deshalb haben wir hier in diesem Raum eine Anzahl von Erwachsenen aus verschiedenen Berufen und verschiedenen Altersgruppen zusammengeholt. Und wir wollen annehmen, dass die einen von Ihnen die Lehrer und die anderen die Lernenden sind.
Wir möchten herausfinden, welche Wirkung die verschiedenen Personen als Lehrer und Lernende aufeinander ausüben, und außerdem, welche Wirkung die Strafe in dieser Situation auf das Lernen hat. [VII-045]
Daher werde ich jetzt einen von Ihnen bitten, heute Abend hier der Lehrer zu sein, und jeweils einen anderen, den Lernenden abzugeben.
Möchte jemand lieber die eine als die andere Rolle spielen?“
Die Versuchspersonen zogen dann Papierstreifen aus einem Hut, um festzulegen, wer bei dem Experiment Lehrer und wer Lernender sein sollte. Das Ziehen der Lose wurde so eingerichtet, dass die nichtsahnende Versuchsperson stets der Lehrer und die Komplizen immer die Lernenden waren. (Auf beiden Papierstreifen stand das Wort „Lehrer“.) Unmittelbar nach dem Ziehen der Lose wurden Lehrer und Lernender in einen angrenzenden Raum gebracht, wo der Lernende auf einem „elektrischen Stuhl“ festgeschnallt wurde.
Der Versuchsleiter erklärte, die Riemen sollten verhindern, dass der Lernende während des Schocks sich zu heftig bewege. Es solle ihm auf diese Weise unmöglich gemacht werden, sich der Situation durch Flucht zu entziehen. Dann wurde eine Elektrode am Handgelenk des Lernenden angebracht, und er wurde an dieser Stelle mit Elektrodensalbe eingeschmiert, „um Blasen und Verbrennungen zu vermeiden“. Den Versuchspersonen wurde gesagt, die Elektrode sei an den Schockgenerator angeschlossen, der im angrenzenden Raum stehe (S. Milgram, 1963, S. 372 f.; vgl. S. Milgram, 1974, S. 31-35).
(...) Die Versuchsperson erhält den Auftrag, dem Lernenden jedes Mal, wenn er eine falsche Antwort gibt, einen Schock zu verabreichen. Außerdem – und auf diesen Befehl kam es an – wurde der Versuchsperson gesagt, sie solle „bei jeder falschen Antwort des Lernenden auf dem Schock-Generator einen Strich höher gehen“. Auch solle sie jedes Mal, bevor sie den Schock gebe, die Voltzahl laut angeben. Auf diese Weise sollten sich die Versuchspersonen stets der wachsenden Intensität der Schocks bewusst sein, die sie dem Lernenden verabreichten (...) In allen Fällen gibt der Lernende eine vorher festgelegte Reihe von Antworten zu einem Wortpaar-Test nach einem Plan, wonach etwa drei falsche Antworten auf eine richtige kommen. Unter diesen Versuchsbedingungen ist von dem Lernenden keine Laut-Reaktion oder ein anderes Zeichen des Protests zu hören, bis das Schockniveau 300 Volt erreicht hat. Sobald jedoch der Schock von 300 Volt gegeben wird, hämmert der Lernende mit den Fäusten gegen die Wand des Raumes, in dem er an den elektrischen Stuhl gebunden ist. Die Versuchsperson kann dieses Hämmern hören. Von nun an erfolgen die Antworten des Lernenden nicht mehr nach dem Vier-Antworten-Plan. (...) Wenn die Versuchsperson ein Zeichen gab, dass sie nicht mehr weiter machen wollte, antwortete der Versuchsleiter mit einer Reihe von „Aufforderungen“, wobei er so viele anwandte, wie notwendig waren, um die Versuchsperson zum Weitermachen zu veranlassen.
Aufforderung 1: Bitte machen Sie weiter, oder: bitte fortfahren!
Aufforderung 2: Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen.
Aufforderung 3: Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie weitermachen.
Aufforderung 4: Es bleibt Ihnen keine andere Wahl. Sie müssen weitermachen.
Diese Aufforderungen wurden stets der Reihe nach angewandt. Nur wenn Aufforderung 1 keinen Erfolg hatte, durfte Aufforderung 2 benutzt werden. Wenn die Versuchsperson sich auch noch nach Aufforderung 4 weigerte, dem Versuchsleiter zu gehorchen, war das Experiment beendet. Der Versuchsleiter sprach stets in bestimmtem, jedoch nicht unhöflichem Ton. Mit der Reihe wurde immer wieder von vorn angefangen, wenn die Versuchsperson stockte oder zögerte, den Befehlen nachzukommen.
Spezielle Aufforderungen: Wenn die Versuchsperson fragte, ob der Lernende einen dauernden körperlichen Schaden davontragen würde, sagte der Versuchsleiter: „Wenn die Schocks auch vielleicht schmerzhaft sind, so erleidet das Muskelgewebe doch keinen Dauerschaden, machen Sie also ruhig weiter.“ (Gefolgt von Aufforderung 2, 3 und 4, falls notwendig.)
Sagte die Versuchsperson, der Lernende wolle aber nicht weitermachen, so erwiderte der Versuchsleiter: „Ob der Lernende es will oder nicht, Sie müssen weitermachen, bis er alle Wortpaare [VII-046] richtig gelernt hat. Fahren Sie bitte fort!“ (Gefolgt von Aufforderung 2, 3 und 4, falls notwendig) (S. Milgram, 1963, S. 373 f.; vgl. S. Milgram, 1974, S. 37-40).
Welches waren die Ergebnisse dieses Experiments? „Viele Teilnehmer bekundeten Anzeichen von Nervosität in der Versuchssituation, besonders bei der Verabreichung der stärkeren Schocks. In sehr vielen Fällen erreichte die Spannung Grade, wie sie selten bei sozio-psychologischen Laborversuchen zu beobachten sind (im Original nicht kursiv). Es wurde beobachtet, dass die Versuchspersonen schwitzten, zitterten, stotterten, sich auf die Lippen bissen, stöhnten und sich die Fingernägel ins Fleisch gruben. Dies waren eher charakteristische als ausnahmsweise beobachtete Reaktionen auf das Experiment.
Ein Zeichen von Spannung war das regelmäßige Auftreten nervöser Lachanfälle. Bei vierzehn der vierzig Versuchspersonen war dieses nervöse Lachen und Lächeln deutlich zu beobachten. Das Lachen schien völlig fehl am Platz, ja sogar bizarr. Bei drei Versuchspersonen wurden regelrechte, unbeherrschbare Lachanfälle beobachtet. In einem Fall beobachteten wir einen Anfall, der so heftig und konvulsiv war, dass wir das Experiment unterbrechen mussten. Die Versuchsperson, ein sechsundvierzigjähriger Vertreter für eine Enzyklopädie, wurde richtig verlegen wegen seines unangemessenen und unbeherrschten Verhaltens. In den Interviews nach dem Experiment beteuerten die Versuchspersonen, sie seien keine Sadisten und ihr Lachen hätte nicht bedeutet, dass es ihnen Spaß gemacht hätte, ihr Opfer zu schocken (S. Milgram, 1963, S. 375).
Im Gegensatz zu den ursprünglichen Erwartungen des Versuchsleiters hörte keine der vierzig Versuchspersonen auf, bevor das Schockniveau 300 erreicht war, bei dem das Opfer gegen die Wand zu hämmern begann und die Fragen des Lehrers mit ihren verschiedenen Beantwortungsmöglichkeiten nicht mehr beantwortete. Nur fünf der vierzig Versuchspersonen weigerten sich, den Befehlen des Versuchsleiters über das 300-Volt-Niveau hinaus zu gehorchen. Weitere vier verabreichten noch einen weiteren Schock, zwei hörten bei 330 Volt auf und je einer bei 345, 360 und 375 Volt. So widersetzten sich im ganzen vierzehn Versuchspersonen (= 35 Prozent) dem Versuchsleiter. Die „gehorsamen“ Versuchspersonen
gehorchten oft unter extremem Stress (...) und zeigten eine ähnliche Angst wie die, welche sich dem Versuchsleiter widersetzten; dennoch gehorchten sie. Nachdem die höchsten Schocks ausgeteilt waren und der Versuchsleiter das Experiment für beendet erklärte, stießen viele gehorsame Versuchspersonen Seufzer der Erleichterung aus, rieben sich die Stirn, strichen sich mit den Fingern über die Augen oder griffen nervös nach einer Zigarette. Einige schüttelten offenbar bedauernd den Kopf. Einige Versuchspersonen blieben während des ganzen Experiments ruhig und zeigten von Anfang bis zum Ende nur minimale Anzeichen von Spannung (S. Milgram, 1963, S. 376).
In der Diskussion des Experimentes stellt der Autor fest, dass sich daraus zwei erstaunliche Feststellungen ergaben:
Die erste Feststellung betrifft die ungebrochene Stärke der Gehorsamstendenzen, die sich in dieser Situation manifestierten. Die Versuchspersonen hatten von Kindheit an gelernt, dass es ein fundamentales moralisches Vergehen ist, wenn man einen anderen Menschen gegen seinen Willen verletzt. Trotzdem wichen 26 Versuchspersonen von [VII-047] diesem Grundsatz ab und folgten den Anweisungen einer Autoritätsperson, die über keine spezielle Macht verfügte, ihren Befehlen Geltung zu verschaffen. (...) Der zweite nicht vorausgesehene Effekt war die außergewöhnliche Spannung, welche dieses Verfahren hervorrief. Man hätte erwarten sollen, dass die Versuchspersonen einfach aufgehört oder weitergemacht hätten, je nachdem, wie es ihnen ihr Gewissen befahl. Aber etwas völlig anderes geschah. Es kam zu auffallenden Spannungsreaktionen und zu einer heftigen emotionalen Belastung. Ein Beobachter berichtet:
„Ich habe beobachtet, wie ein ursprünglich gelassen wirkender Geschäftsmann mittleren Alters lächelnd und selbstsicher ins Laboratorium kam. Innerhalb von 20 Minuten wurde er zu einem zuckenden, stammelnden Wrack, das einem Nervenzusammenbruch nahe war. Er zerrte ständig an seinem Ohrläppchen und rang die Hände. Einmal stieß er sich mit der Faust gegen die Stirn und murmelte: ‘O Gott, wenn das nur aufhörte!’ Und trotzdem hörte er weiter auf jedes Wort des Versuchsleiters und gehorchte ihm bis zum Schluss“ (S. Milgram, 1963, S. 376 f.).
Das Experiment ist in der Tat nicht nur als Untersuchung über Gehorsam und Konformität, sondern auch über Grausamkeit und Destruktivität höchst interessant. Fast scheint es sich um die gleiche Situation zu handeln, wie sie sich im wirklichen Leben ereignet, wo man sich nach der Schuld der Soldaten fragt, die schreckliche Grausamkeiten und Gräueltaten begingen, indem sie die Befehle ihrer Vorgesetzten (oder das, was sie dafür hielten) ohne zu fragen ausführten. Gilt dies auch für die deutschen Generäle, die in Nürnberg als Kriegsverbrecher verurteilt wurden, oder für Leutnant Calley und einige seiner Untergebenen in Vietnam?
Ich glaube, dass sich aus dem Experiment auf die meisten Situationen im wirklichen Leben nicht schließen lässt. Der Psychologe war nicht nur eine Autorität, der man Gehorsam schuldig ist, sondern ein Vertreter der Wissenschaft und repräsentierte eines der angesehensten Institute des höheren Bildungswesens in den Vereinigten Staaten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Wissenschaft in der heutigen Industriegesellschaft weitgehend als der höchste Wert angesehen wird, ist es für den Durchschnittsbürger schwer zu glauben, dass das, was die Wissenschaft befiehlt, falsch oder unmoralisch sein könnte. Wenn Gott Abraham nicht befohlen hätte, seinen Sohn nicht zu töten, hätte er es getan, wie Millionen von Eltern, die im Laufe der Geschichte Kindesopfer dargebracht haben. Für den Gläubigen kann weder Gott noch sein modernes Äquivalent, die Wissenschaft, etwas befehlen, was unrecht ist. Aus diesem Grund, und aus anderen von Milgram erwähnten Gründen, ist der hochgradige Gehorsam nicht erstaunlicher, als dass 35 Prozent der Gruppe an einem gewissen Punkt den Gehorsam verweigerten. Tatsächlich könnte man diesen Ungehorsam von mehr als einem Drittel als erstaunlicher – und ermutigend – ansehen.
Ungerechtfertigt erscheint auch, wenn man sich darüber wundern wollte, dass soviel Spannung entstand. Der Versuchsleiter erwartete, „dass die Versuchspersonen einfach aufgehört oder weitergemacht hätten, je nachdem, wie es ihnen ihr Gewissen befahl“. Ist das tatsächlich die Art und Weise, wie die Menschen im wirklichen Leben ihre Konflikte lösen? Liegt die Besonderheit – und das Tragische – des menschlichen Handelns nicht gerade darin, dass der Mensch versucht, sich seinen Konflikten nicht zu stellen; das heißt, dass er nicht bewusst die Wahl trifft zwischen dem, was er – aus Habgier oder Angst – tun möchte, und dem, was ihm sein Gewissen verbietet? Tatsache ist, dass er mit Hilfe von [VII-048] Rationalisierungen das Bewusstwerden des Konfliktes von sich wegschiebt und dass sich der Konflikt lediglich im Unbewussten in Form von verstärktem Stress, neurotischen Symptomen oder von Schuldgefühlen aus falschen Gründen manifestiert. In dieser Hinsicht verhielten sich Milgrams Versuchspersonen durchaus normal.
Bei dieser Gelegenheit stellen sich noch einige weitere interessante Fragen. Milgram nimmt an, dass seine Versuchspersonen in einer Konfliktsituation sind, weil sie sich in einem ausweglosen Widerstreit zwischen dem Autoritätsgehorsam und Verhaltensmustern befinden, die sie von Kindheit an gelernt haben, nämlich anderen Menschen keinen Schaden zuzufügen.
Aber stimmt das wirklich? Haben wir gelernt, „anderen Menschen keinen Schaden zuzufügen“? Vielleicht lehrt man das im Religionsunterricht. In der realistischen Schule des Lebens dagegen lernen die Kinder, dass sie ihren eigenen Vorteil wahrnehmen müssen, selbst wenn sie damit anderen Menschen Schaden zufügen. Offenbar ist der Konflikt in dieser Hinsicht doch nicht so heftig, wie Milgram annimmt.
Ich glaube, dass die wichtigste Erkenntnis aus Milgrams Untersuchung die Stärke der Reaktionen gegen ein grausames Verhalten ist. Sicher konnten 65 Prozent der Versuchspersonen dazu „konditioniert“ werden, dass sie sich grausam verhielten, aber bei den meisten war doch eine Reaktion der Empörung oder des Widerwillens gegen ihr sadistisches Verhalten deutlich vorhanden. Leider gibt uns der Autor keine genauen Daten über die Anzahl der Versuchspersonen, die während des ganzen Experiments ruhig blieben. Für ein Verständnis menschlichen Verhaltens wäre es höchst interessant, mehr über sie zu erfahren. Offenbar fühlten sie kaum oder nur wenig Widerstreben gegen die grausamen Handlungen, die sie vollzogen. Die nächste Frage lautet, warum dies so war. Eine mögliche Antwort wäre, dass das Leiden der anderen sie befriedigte und dass sie keine Gewissensbisse fühlten, wenn ihr Verhalten von der Autorität sanktioniert wurde. Eine andere Möglichkeit wäre die, dass es sich bei ihnen um so stark entfremdete oder narzisstische Menschen handelte, dass sie gegen alles, was in anderen Leuten vorging, unempfindlich waren; oder vielleicht waren es auch „Psychopathen“, die moralisch überhaupt nicht reagierten. Diejenigen, bei denen sich der Konflikt in verschiedenen Symptomen von Stress und Angst manifestierte, dürften Menschen gewesen sein, die keinen sadistischen oder destruktiven Charakter hatten. (Wenn man ein tiefenpsychologisches Interview gemacht hätte, hätte man die Charakterunterschiede feststellen können, und man hätte sogar begründete Vermutungen anstellen können, wie sich die Leute verhalten würden.)
Das wichtigste Ergebnis aus Milgrams Untersuchung dürfte ein Resultat sein, auf das er selbst nicht besonders hinwies: Das Vorhandensein eines Gewissens bei den meisten Versuchspersonen und ihr Schmerz darüber, dass der Gehorsam sie zwang, gegen ihr Gewissen zu handeln. Während man daher das Experiment als neuen Beweis dafür interpretieren kann, wie leicht der Mensch zu entmenschlichen ist, weisen die Reaktionen der Versuchspersonen eher auf das Gegenteil hin – auf das Vorhandensein starker innerer Kräfte, die ein grausames Verhalten unerträglich finden. Das legt nahe, dass es bei der Untersuchung der Grausamkeit im realen Leben wichtig ist, nicht nur das grausame Verhalten, sondern auch das – oft unbewusste – schlechte Gewissen derer, die der Autorität gehorchen, zu berücksichtigen. (Die Nazis mussten ein ausgeklügeltes Verschleierungssystem für ihre Gräueltaten anwenden, um mit dem Gewissen des Durchschnittsbürgers [VII-049] fertig zu werden.) Milgrams Experiment veranschaulicht gut den Unterschied zwischen den bewussten und den unbewussten Aspekten des Verhaltens, selbst wenn er ihn nicht bei der Untersuchung berücksichtigte.
Noch ein weiteres Experiment ist in diesem Zusammenhang besonders relevant, da es sich direkt mit dem Problem der Ursachen der Grausamkeit befasst.
Der erste Bericht über dieses Experiment wurde in einer kurzen Mitteilung veröffentlicht (P. Zimbardo, 1972), bei der es sich, wie der Verfasser mir schrieb, um einen Auszug aus einem mündlichen Bericht handelt, den er vor einem Unterausschuss des Kongresses über die Strafvollzugsreform gab. Dr. Zimbardo hält diesen Auszug, seiner Kürze wegen, nicht für eine faire Basis zur Beurteilung seiner Arbeit. Ich respektiere seinen Wunsch, obwohl ich es bedaure, da gewisse Diskrepanzen zwischen der ersten und der späteren Veröffentlichung (C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo, 1973)[46] bestehen, auf die ich gern eingegangen wäre. Ich werde nur ganz kurz auf zwei entscheidende Punkte in seiner ersten Mitteilung eingehen: a) auf die Haltung der Wärter und b) auf die zentrale These der Verfasser.
Zweck dieses Experimentes war, das Verhalten normaler Menschen in einer bestimmten Situation zu untersuchen, nämlich wenn sie in einem „Schein-Gefängnis“ die Rollen von Gefangenen und deren Aufsehern spielten. Die allgemeine These, von der die Verfasser glauben, dass sie durch das Experiment bestätigt wurde, lautet, dass es kaum etwas gibt, wozu die meisten Menschen nicht durch den Einfluss einer bestimmten Situation gebracht werden könnten, und dies ohne Rücksicht auf ihre moralische Einstellung, auf ihre persönlichen Überzeugungen und Wertbegriffe (P. Zimbardo, 1972): genauer gesagt, dass in diesem Experiment die Gefängnissituation die meisten Versuchspersonen, die die Rolle der „Wärter“ spielten, in brutale Sadisten und die meisten von denen, welche die Rolle der Gefangenen spielten, in jämmerliche, verängstigte und unterwürfige Menschen verwandelte, von denen einige so ernste psychische Symptome entwickelten, dass sie nach ein paar Tagen wieder entlassen werden mussten. Tatsächlich waren die Reaktionen beider Gruppen so intensiv, dass das ursprünglich für zwei Wochen geplante Experiment nach sechs Tagen abgebrochen werden musste.
Ich bezweifle, dass das Experiment diese behavioristische These beweist, und werde die Gründe für meine Zweifel anführen. Doch muss ich den Leser zunächst mit den Einzelheiten des Experimentes bekannt machen, wie sie im zweiten Bericht geschildert werden. Studenten bewarben sich auf eine Zeitungsanzeige, die nach männlichen Freiwilligen suchte, welche bereit waren, sich an einer psychologischen Untersuchung über das Leben im Gefängnis zu beteiligen, und zwar gegen ein Entgelt von 15 Dollar pro Tag. Die Studenten, die sich bewarben,
mussten einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen über ihre Familienverhältnisse, ihren körperlichen und geistigen Gesundheitszustand, über ihre früheren Erlebnisse und psychopathologischen Tendenzen (einschließlich eigener Straffälligkeit). Jeder, der den Fragebogen über sein Milieu und seinen Werdegang ausfüllte, wurde von einem der beiden Versuchsleiter interviewt. Schließlich wurden 24 Versuchspersonen ausgewählt, [VII-050] die man für die körperlich und geistig stabilsten und reifsten hielt und von denen man annahm, dass sie am wenigsten in anti-soziale Aktionen verwickelt waren. Die Hälfte der Versuchspersonen wurde aufs Geratewohl für die Rolle des „Wärters“ und die andere Hälfte für die des „Gefangenen“ bestimmt (C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo, 1973, S. 73).
Die letzte Auswahl der Versuchspersonen musste sich am Tag vor Beginn der Simulation noch einer Reihe von psychologischen Tests unterziehen; um jedoch eine selektive Voreingenommenheit von Seiten der Versuchsleiter und Beobachter auszuschalten, wurden die Punkte erst nach Beendigung der Untersuchung in Tabellen eingetragen. Nach eigenen Äußerungen der Verfasser hatten sie eine Auswahl von Personen gewählt, die von der Normalbevölkerung nicht abwichen und die keine sadistische oder masochistische Prädisposition erkennen ließen.
Das „Gefängnis“ wurde in einem 35 Fuß langen Teil des Korridors im Untergeschoss des Psychologiegebäudes der Stanford-Universität eingerichtet. Allen Versuchspersonen wurde mitgeteilt, dass
sie, wie der Zufall es wolle, für die Rolle eines Wärters oder eines Gefangenen bestimmt würden, und alle hatten sich freiwillig bereit erklärt, eine dieser beiden Rollen zwei Wochen lang für 15 Dollar am Tag zu spielen. Sie unterzeichneten einen Vertrag, in dem ihnen eine angemessene minimale Ernährung, Bekleidung, Unterkunft und medizinische Betreuung sowie das finanzielle Entgelt dafür zugesagt wurde, dass sie ihrerseits ihre „Absicht“ bekundeten, auf die Dauer des Experiments die ihnen zugeteilte Rolle zu spielen.
Im Vertrag war ausdrücklich festgelegt, dass die zu Gefangenen Bestimmten damit rechnen mussten, unter Bewachung zu stehen (dass sie kaum oder nie allein gelassen würden) und dass gewisse bürgerliche Grundrechte während ihrer Gefangenschaft aufgehoben wären, aber mit Ausschluss körperlicher Misshandlung. Weitere Informationen darüber, was sie zu erwarten hatten, oder Instruktionen darüber, wie sie sich in ihrer Gefangenenrolle zu verhalten hätten, erhielten sie nicht. Den endgültig Ausgewählten wurde telefonisch mitgeteilt, sie hätten sich an einem bestimmten Sonntag, an dem wir mit dem Experiment beginnen wollten, in ihrer Wohnung zur Verfügung zu halten (C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo, 1973, S. 74).
Die Versuchspersonen, die zu Aufsehern bestimmt waren, nahmen an einer Besprechung mit dem „Gefängnisdirektor“ (einem nichtgraduierten Hochschulassistenten) und mit dem „Inspektor“ (dem Hauptversuchsleiter) teil. Man sagte ihnen, ihre Aufgabe bestehe darin, „im Gefängnis einigermaßen Ordnung zu halten, so dass alles richtig funktioniere“. Wichtig ist zu wissen, was die Autoren unter „Gefängnis“ verstehen. Sie gebrauchen das Wort nicht in seinem allgemeinen Sinn als einen Ort, wo Gesetzesübertreter interniert werden, sondern in einem spezifischen Sinn, in dem sich die Verhältnisse in gewissen amerikanischen Gefängnissen spiegeln.
Unsere Absicht war nicht eine buchstäbliche Simulierung eines amerikanischen Gefängnisses, sondern vielmehr die funktionelle Darstellung eines solchen. Aus ethischen, moralischen und pragmatischen Gründen konnten wir unsere Versuchspersonen nicht für längere oder unbestimmte Zeit einsperren, wir konnten ihnen auch nicht mit schweren körperlichen Strafen drohen oder solche in Aussicht stellen, wir konnten keine homosexuellen oder rassistischen Praktiken zulassen und gewisse andere spezifische Aspekte des Lebens im Gefängnis nicht simulieren. Trotzdem glaubten wir eine Situation hervorrufen zu können, die den Verhältnissen in der realen Welt so ähnlich [VII-051] war, dass ihr Rollenspiel über die oberflächlichen Anforderungen hinaus, welche diese Rolle an sie stellte, uns die Möglichkeit geben würde, einen Einblick in die Tiefenstruktur der Charaktere zu bekommen, die sie darstellten. Zu diesem Zweck sorgten wir für funktionale Äquivalente der verschiedenen Tätigkeiten und Erlebnisse im tatsächlichen Gefängnisleben, von denen wir annahmen, dass sie bei unseren Versuchspersonen qualitativ ähnliche psychologische Reaktionen hervorrufen würden – wie Gefühle der Macht oder Ohnmacht, der Kontrolle oder Unterdrückung, der Befriedigung oder Frustration, der willkürlichen Befehlsgewalt oder des Widerstandes gegen die Autorität, des Status oder der Anonymität, des Masochismus oder der Kastration (C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo, 1973, S. 71 f.).
Wie der Leser sogleich aus der Beschreibung der in diesem Gefängnis angewandten Methoden ersehen wird, ist diese Beschreibung eine beträchtliche Untertreibung der im Experiment angewandten Behandlung, auf die mit den letzten Worten nur vage angespielt wird. Die tatsächlich angewandten Methoden liefen auf eine strenge und systematische Demütigung und Degradierung hinaus, und dies nicht nur auf Grund des Verhaltens der „Wärter“, sondern auch durch die von den Versuchsleitern aufgestellte „Gefängnisordnung“. Durch die Anwendung des Wortes „Gefängnis“ wird unterstellt, dass wenigstens in den Vereinigten Staaten – und praktisch auch in jedem anderen Land – Gefängnisse diesen Typ repräsentieren. Diese stillschweigende Voraussetzung lässt die Tatsache unberücksichtigt, dass es auch andere Gefängnisse gibt, wie zum Beispiel einige der Bundesstrafanstalten in den Vereinigten Staaten und die entsprechenden Anstalten in anderen Ländern, die nicht im selben Grade unmenschlich sind, wie es die Autoren in ihrem Scheingefängnis dargestellt haben.
Wie wurden die „Gefangenen“ behandelt? Man hatte ihnen gesagt, sie sollten sich für den Beginn des Experiments bereithalten.
Unter Mitwirkung der städtischen Polizei von Palo Alto wurden alle Versuchspersonen, die Gefangene abgeben sollten, ohne Vorankündigung in ihren Wohnungen „verhaftet“. Ein Polizeibeamter teilte ihnen mit, sie stünden unter dem Verdacht, einen Diebstahl oder einen bewaffneten Raubüberfall begangen zu haben. Er unterrichtete sie über ihre gesetzlichen Rechte, legte ihnen Handschellen an, durchsuchte sie gründlich (oft während neugierige Nachbarn zuschauten), lud sie hinten in ein Polizeiauto und fuhr mit ihnen zum Polizeirevier. Dort mussten sie sich den routinemäßigen Prozeduren unterziehen, es wurden ihre Fingerabdrücke abgenommen, eine Erkennungskarte wurde vorbereitet, und anschließend wurden sie in eine Arrestzelle gebracht. Jedem Gefangenen wurden die Augen verbunden. Dann wurde er von einem der Versuchsleiter und einem „Wärter“ in unser Schein-Gefängnis gefahren. Während der ganzen Verhaftungsprozedur nahmen die Polizeibeamten eine offizielle, ernste Haltung ein und beantworteten grundsätzlich keine Fragen, mit denen die Betroffenen herauszubekommen versuchten, in welcher Beziehung diese Verhaftung zu dem Experiment des Schein-Gefängnisses stand.
Nach der Ankunft in unserem Versuchs-Gefängnis wurde jeder Gefangene bis auf die Haut ausgezogen, mit einem Entlausungsmittel (einem Deodorant-Spray) besprüht, worauf man ihn eine Weile nackt im Gefängnishof stehen ließ. Dann musste er die Gefängniskleidung anziehen, sein Erkennungsfoto wurde aufgenommen, und er wurde in seine Zelle gebracht, wobei man ihm den Befehl erteilte, sich ruhig zu verhalten (C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo, 1973, S. 76).
Da die „Verhaftungen“ von der wirklichen Polizei vorgenommen wurden (man fragt sich, wieweit deren Beteiligung bei der Prozedur überhaupt legal war), mussten die [VII-052] Versuchspersonen annehmen, dass sie tatsächlich eines Vergehens beschuldigt wurden, besonders da die Beamten ihre Frage unbeantwortet ließen, ob die Verhaftung mit dem Experiment in Verbindung stand. Was sollten sich die Versuchspersonen dabei denken? Woher sollten sie wissen, dass ihre „Verhaftung“ keine Verhaftung war, dass die Polizeibeamten sich dazu hergegeben hatten, die falschen Beschuldigungen zu erheben und Gewalt anzuwenden, nur um dem Experiment etwas Farbe zu geben?
Die Bekleidung der „Gefangenen“ war recht eigenartig. Sie bestand aus
einem losen Baumwollkittel, der vorn und hinten eine Kennnummer hatte. Unter diesem „Anzug“ trugen sie keine Unterwäsche. Um das eine Fußgelenk war eine leichte Kette mit Schloss geschlungen. An den Füßen hatten sie Gummisandalen, und das Haar wurde ihnen mit einem zu einer Kappe geschlungenen Nylonstrumpf bedeckt. (...) Diese Bekleidung sollte den Gefangenen nicht nur ihre Individualität nehmen, sie sollte sie auch demütigen und ein Symbol ihrer Abhängigkeit und ihres Unterworfenseins sein. Die Kette um den Knöchel erinnerte sie ständig (selbst im Schlaf noch, wenn sie mit ihrem anderen Knöchel in Berührung kam) an das Bedrückende ihrer Umgebung. Die Strumpfkappe beseitigte jedes Unterscheidungsmerkmal bezüglich Haarlänge und -farbe und Frisur (wie dies in einigen „wirklichen“ Gefängnissen und beim Militär dadurch erreicht wird, dass man dem Betreffenden den Kopf schert). In den schlechtsitzenden Kitteln fühlten sich die Gefangenen in ihren Bewegungen behindert, da die Kleider überdies ohne Unterwäsche getragen wurden, zwangen sie sie, eine ungewohnte Haltung einzunehmen, die der einer Frau ähnlicher war als der eines Mannes – was ebenfalls zu dem Entmannungsprozess beitrug, der mit dem Gefangenendasein Hand in Hand ging (C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo, 1973, S. 75 f.).
Welche Reaktionen zeigten die „Gefangenen“ und die „Wärter“ auf diese Situation während der sechs Tage, die das Experiment dauerte?
Am dramatischsten kam die Einwirkung dieser Situation auf die Teilnehmer in den schweren Reaktionen von fünf Gefangenen zum Ausdruck, die man wegen außerordentlich heftiger emotionaler Depressionen, Schreien, Wutanfällen und akuten Angstzuständen entlassen musste. Bei vier dieser Teilnehmer zeigten sich ganz ähnliche Symptome, und zwar begannen diese bereits am zweiten Tag der Einkerkerung. Die fünfte Versuchsperson wurde entlassen, nachdem man sie wegen eines psychosomatischen Hautausschlags hatte behandeln müssen, der ganze Teile des Körpers erfasste. Von den übrigen Gefangenen sagten nur zwei, sie wollten sich das verdiente Geld nicht dadurch verscherzen, dass man sie „vorzeitig entließ“. Als das Experiment nach sechs Tagen vorzeitig beendet wurde, waren alle übrigen Gefangenen über dieses unverhoffte Glück höchst erfreut. (C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo, 1973, S. 81.)
Während die Reaktion der „Gefangenen“ ziemlich einheitlich war und nur Gradunterschiede aufwies, bot die Reaktion der „Aufseher“ ein komplexeres Bild:
Im Gegensatz dazu machten die Wärter den Eindruck, als ob sie über unsere Entscheidung, mit dem Experiment Schluss zu machen, unglücklich wären, und wir hatten das Gefühl, dass sie so sehr in ihre Rolle hineingewachsen waren, dass es ihnen jetzt Spaß machte, eine so unumschränkte Kontrolle und Macht ausüben zu können, und dass sie es nur ungern wieder aufgaben (C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo, 1973, S. 81). [VII-053]
Die Autoren beschreiben die Haltung der „Wärter“ folgendermaßen:
Keiner der Wärter kam jemals zur Ablösung zu spät, und es kam sogar mehrmals vor, dass Wärter freiwillig weiter Dienst machten, ohne sich über die Überstunden zu beschweren, die sie nicht extra bezahlt bekamen.
Die hochgradig pathologischen Reaktionen, die bei beiden Gruppen der Versuchspersonen auftraten, beweisen die Macht der sozialen Kräfte, die am Werk waren. Trotzdem gab es individuelle Unterschiede in der Art, wie die Einzelnen mit der neuen Erfahrung fertig zu werden versuchten und wieweit ihnen eine erfolgreiche Anpassung gelang. Die Hälfte der Gefangenen hielt die bedrückende Atmosphäre aus, und nicht alle Wärter nahmen eine feindselige Haltung ein. Einige Wärter waren streng aber fair („sie hielten sich an die Regeln“), einige gingen weit über die Befugnisse ihrer Rolle hinaus, benahmen sich grausam und quälten die Gefangenen, während einige wenige passiv blieben und nur selten Zwangsmaßnahmen gegenüber den Gefangenen anwandten (C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo, 1973, S. 81).
Schade, dass wir nicht genauere Informationen erhalten als „einige“ und „einige wenige“. Dies scheint mir ein unnötiger Mangel an Genauigkeit, wäre es doch ein Leichtes gewesen, Zahlen anzugeben. Dies ist umso verwunderlicher, als in der früheren Veröffentlichung in Trans-Action etwas genauere und erheblich abweichende Feststellungen gemacht wurden. Der Prozentsatz der aktiv sadistischen „Wärter“, die „recht erfinderisch in ihren Methoden, die Gefangenen kleinzukriegen“, waren, wird dort mit etwa einem Drittel geschätzt. Der Rest wird in zwei andere Kategorien unterteilt, die als (1) „streng aber fair“ und (2) als „gute Wärter vom Standpunkt der Gefangenen“ beschrieben wurden, „da sie ihnen kleine Gefälligkeiten erwiesen und freundlich zu ihnen waren“. Diese Charakterisierung unterscheidet sich erheblich von der, dass einige wenige „passiv blieben und nur selten Zwangsmaßnahmen gegenüber den Gefangenen anwandten“, wie es im späteren Bericht heißt.
Derartige Beschreibungen lassen einen gewissen Mangel an Genauigkeit in der Formulierung der Daten erkennen, was umso bedauerlicher ist, wenn es im Zusammenhang mit der entscheidenden These des Experimentes zu verzeichnen ist. Die Autoren glauben, es beweise, dass die Situation allein innerhalb weniger Tage normale Personen in jämmerliche, unterwürfige Wesen oder in erbarmungslose Sadisten verwandeln könne. Mir scheint, dass das Experiment eher das Gegenteil beweist – wenn es überhaupt etwas beweist. Wenn trotz der Gesamtatmosphäre dieses Scheingefängnisses, die nach dem Konzept des Experiments entwürdigend und demütigend sein sollte (was die „Wärter“ offenbar sofort begriffen), zwei Drittel der „Wärter“ keine sadistischen Handlungen zu ihrem persönlichen Vergnügen begingen, so scheint mir das Experiment eher zu beweisen, dass man die Leute nicht so leicht nur mit Hilfe einer geeigneten Situation in Sadisten verwandeln kann.
In diesem Zusammenhang kommt es sehr stark auf den Unterschied zwischen Verhalten und Charakter an. Es ist etwas anderes, ob man sich entsprechend den sadistischen Vorschriften verhält oder ob man zu anderen Leuten grausam sein möchte und daran Gefallen findet. Dass bei diesem Experiment diese Unterscheidung nicht gemacht wurde, nimmt ihm viel von seinem Wert, wie es auch Milgrams Experiment beeinträchtigt.
Diese Unterscheidung ist auch für die andere Seite der These relevant, nämlich dafür, dass [VII-054] die vorausgegangene Testreihe ergeben hatte, dass die Versuchspersonen keine Neigung zu sadistischem oder masochistischem Verhalten zeigten, das heißt, dass die Tests auf keine sadistischen oder masochistischen Charakterzüge hinwiesen. Soweit dies die Psychologen angeht, für die das manifeste Verhalten das Wichtigste ist, mag diese Feststellung korrekt sein. Für den Psychoanalytiker ist es jedoch auf Grund seiner Erfahrungen nicht sehr überzeugend. Charakterzüge sind oft völlig unbewusst, und sie lassen sich außerdem nicht mit den konventionellen psychologischen Tests aufdecken. Was die projektiven Tests betrifft, wie zum Beispiel den T. A. T. [Thematischer Apperzeptions-Test] oder den Rorschach-Test, so werden nur Forscher mit einer beträchtlichen Erfahrung im Studium der unbewussten Prozesse mit ihrer Hilfe viel unbewusstes Material entdecken.
Die Daten über die „Wärter“ sind noch aus einem anderen Grunde fragwürdig. Diese Versuchspersonen wurden gerade deshalb ausgewählt, weil sie mehr oder weniger durchschnittliche, normale Menschen waren und man keine sadistischen Neigungen bei ihnen fand. Dieses Ergebnis widerspricht aber der Tatsache, dass der Prozentsatz unbewusster Sadisten in einer Durchschnittsbevölkerung nicht gleich Null ist. Einige Untersuchungen (E. Fromm, 1980a; E. Fromm und M. Maccoby, 1970b) haben dies gezeigt, und ein erfahrener Beobachter kann es auch ohne Fragebogen und ohne Tests feststellen. Aber wie hoch der Prozentsatz an sadistischen Charakteren in einer normalen Bevölkerung auch sein mag, das vollkommene Fehlen dieser Kategorie spricht eher dafür, dass man Tests anwandte, die sich für dieses Problem nicht eigneten.
Einige verwirrende Resultate des Experiments dürften durch einen anderen Faktor zu erklären sein. Die Verfasser stellen fest, dass es den Versuchspersonen schwergefallen sei, die Wirklichkeit von der Rolle, die sie spielten, zu unterscheiden, und sie nehmen an, dass dies aus der Situation resultiere. Das ist natürlich richtig, aber die Versuchsleiter haben diese Resultate in ihr Experiment eingebaut. Zunächst wurden die „Gefangenen“ durch mehrere Umstände in Verwirrung gebracht. Die Bedingungen, die man ihnen mitteilte und unter denen sie sich auf den Vertrag einließen, unterschieden sich drastisch von denen, die sie dann vorfanden. Sie konnten unmöglich darauf gefasst sein, sich in einer entwürdigenden, demütigenden Atmosphäre wiederzufinden. Noch wichtiger für das Zustandekommen der Verwirrung ist aber die Mitarbeit der Polizei. Da es höchst ungewöhnlich ist, dass die Polizeibehörde sich zu einem derartigen experimentellen Spiel hergibt, war es für die „Gefangenen“ äußerst schwierig, zwischen der Wirklichkeit und ihrer Rolle zu unterscheiden.
Aus dem Bericht geht hervor, dass sie nicht einmal wussten, ob ihre Verhaftung etwas mit dem Experiment zu tun hatte, und dass die Beamten sich weigerten, ihnen ihre Fragen zu beantworten, ob ein Zusammenhang bestand. Wäre nicht jeder Durchschnittsmensch hierdurch durcheinandergebracht worden und wäre nicht jeder mit dem verwirrten, hilflosen Gefühl an das Experiment herangegangen, dass man ihn hereingelegt hatte?
Warum haben die „Gefangenen“ nicht sofort oder nach ein oder zwei Tagen Schluss gemacht? Die Verfasser geben uns kein klares Bild davon, was den „Gefangenen“ über die Bedingungen gesagt wurde, unter denen sie wieder aus ihrem Scheingefängnis heraus konnten. Ich selbst habe wenigstens keinen einzigen Hinweis darauf gefunden, dass man ihnen überhaupt gesagt hatte, sie hätten das Recht, aufzuhören, wenn sie es nicht länger aushielten. Tatsächlich hinderten die „Wärter“ einige, die ausbrechen wollten, mit Gewalt [VII-055] daran. Scheinbar war ihnen der Eindruck vermittelt worden, dass sie von der Entlassungskommission die Erlaubnis erhalten konnten, das Gefängnis zu verlassen. Aber die Verfasser sagen:
Einer der bemerkenswertesten Vorfälle bei dem Experiment ereignete sich während einer Vernehmung durch die Entlassungskommission, bei der fünf Gefangene, die um Entlassung nachgesucht hatten, vom Hauptverfasser (des Aufsatzes) gefragt wurden, ob sie denn auf das gesamte Geld, das sie sich als Gefangene verdient hätten, bei ihrer Entlassung (aus dem Experiment) verzichten wollten. Drei der fünf Gefangenen sagten „ja“, das wollten sie. Man beachte, dass der ursprüngliche Beweggrund für ihre Teilnahme am Experiment die Geldzusage gewesen war, und dass sie trotzdem – schon nach vier Tagen – bereit waren, völlig darauf zu verzichten. Noch erstaunlicher war, dass jeder dieser Gefangenen ruhig aufstand und sich vom Aufseher in seine Zelle zurückführen ließ, als man ihnen mitteilte, man müsse diese Möglichkeit erst mit den anderen Leitern besprechen, bevor man darüber entscheiden könne. Hätten sie sich nur als „Versuchspersonen“ betrachtet, die sich für Geld an einem Experiment beteiligten, so hätte für sie kein Anlass mehr bestanden, an dem Experiment weiter teilzunehmen, und sie hätten sich einer Situation, die ihnen so widerwärtig geworden war, leicht dadurch entziehen können, dass sie einfach gegangen wären. Aber so stark war inzwischen die Kontrolle geworden, die die Situation über sie hatte, und die simulierte Umgebung war für sie so sehr zur Wirklichkeit geworden, dass sie nicht mehr erkennen konnten, dass ihr ursprüngliches und einziges Motiv, dazubleiben, nicht mehr zutraf, und so kehrten sie in ihre Zelle zurück, um dort darauf zu warten, dass ihre Kerkermeister sich entschließen würden, sie vorzeitig zu entlassen (C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo, 1973, S. 93).
Hätten sie sich der Situation wirklich so leicht entziehen können? Warum sagte man ihnen nicht bei der Vernehmung: „Wer von Ihnen gehen will, kann sofort weggehen, nur verliert er dann das Geld.“ Wenn sie nach dieser Bekanntgabe noch geblieben wären, wäre der Hinweis der Verfasser auf ihre Fügsamkeit tatsächlich gerechtfertigt. Indem sie aber sagten, „man müsse diese Möglichkeit erst mit den anderen Leitern besprechen, bevor man darüber entscheiden könne“, gab man ihnen die typische bürokratische Antwort, die sich vor der Verantwortung drückt; sie besagte unausgesprochen, dass die „Gefangenen“ nicht das Recht hatten zu gehen.
„Wussten“ die „Gefangenen“ wirklich, dass es sich bei all dem nur um ein Experiment handelte? Es hängt davon ab, was hier unter „wissen“ zu verstehen ist und welche Wirkung es auf die Denkprozesse des „Gefangenen“ hat, wenn man ihn von Anfang an absichtlich verwirrt, so dass er schließlich nicht mehr weiß, was ist was und wer ist wer.
Abgesehen von dem Mangel an Genauigkeit und an einer selbstkritischen Auswertung der Resultate, weist das Experiment noch einen weiteren Mangel auf: dass man die Resultate nicht an realen Gefängnissituationen gleicher Art überprüfte. Ist die Mehrzahl der Gefangenen in den schlimmsten amerikanischen Gefängnissen wirklich sklavisch unterwürfig, und sind die meisten Aufseher tatsächlich brutale Sadisten? Die Verfasser zitieren nur einen einzigen früheren Sträfling und einen Gefängnisgeistlichen als Zeugen für ihre These, dass die Resultate des Scheingefängnisses denen in den wirklichen Gefängnissen entsprechen. Da es sich hier um eine Frage handelt, die für die Hauptthese des Experiments von ausschlaggebender Bedeutung ist, hätten sie weit mehr Vergleiche anstellen müssen – zum Beispiel durch systematische Befragung vieler früherer Gefangener. Auch [VII-056] hätten sie, anstatt einfach nur von „Gefängnissen“ zu reden, genauere Angaben über den Prozentsatz der Gefängnisse in den Vereinigten Staaten machen müssen, die dem entwürdigenden Typ eines Gefängnisses entsprechen, den sie zu simulieren versuchten.
Dass es die Verfasser versäumten, ihre Schlussfolgerungen an einer realistischen Situation zu überprüfen, ist umso bedauerlicher, als reiches Material vorhanden ist über eine weit brutalere Gefängnissituation, als sie in den schlimmsten amerikanischen Gefängnissen zu finden ist: Ich meine Hitlers Konzentrationslager.
Was die spontane Grausamkeit der SS-Wärter betrifft, so ist dieses Problem noch nicht systematisch untersucht worden. Bei meinen eigenen nur beschränkten Möglichkeiten, Daten, über das Vorkommen eines spontanen Sadismus bei den Wärtern aufzutreiben – das heißt über ein sadistisches Verhalten, das über die Routinevorschriften hinausging und von individueller sadistischer Lust motiviert war –, habe ich Schätzungen von früheren Häftlingen erhalten, die zwischen 10 und 90 Prozent liegen, wobei die niedrigeren Schätzungen häufiger von früheren politischen Häftlingen stammen.[47] Um sicherzugehen, wäre es notwendig, eine gründliche Untersuchung des Sadismus der Wärter im Konzentrationslager-System der Nazis durchzuführen. Eine derartige Untersuchung könnte verschiedene Ansätze haben. Zum Beispiel:
- Systematische Interviews mit früheren Insassen von Konzentrationslagern, wobei man ihre Aussagen mit ihrem Alter, den Gründen für ihre Inhaftierung, der Dauer ihrer Gefangenschaft und anderen relevanten Daten in Beziehung bringen müsste, sowie ähnlichen Interviews mit früheren Wärtern in Konzentrationslagern.[48]
- „Indirekte“ Daten, wie etwa die folgenden: das (wenigstens 1939) angewandte System, neue Gefangene während der langen Eisenbahnfahrt ins Konzentrationslager „kirre zu machen“, indem man ihnen heftige körperliche Schmerzen zufügte (Schläge, Bajonettwunden) oder indem man sie hungern ließ oder sie äußersten Demütigungen aussetzte. Die SS-Wärter führten diese sadistischen Befehle aus, ohne das geringste Mitleid zu zeigen. Später dagegen, wenn die Gefangenen mit der Bahn von einem Lager in ein anderes transportiert wurden, rührte sie niemand an, da sie jetzt „alte Häftlinge“ waren (B. Bettelheim, 1964, S. 176 ff.). Wenn die Wärter sich mit ihrem sadistischen Verhalten ein Vergnügen hätten machen wollen, so hätten sie das gewiss tun können, ohne eine Bestrafung befürchten zu müssen.[49] Dass dies nicht häufiger vorkam, könnte zu gewissen Schlussfolgerungen über den individuellen Sadismus der Wärter Anlass geben. Was die Haltung der Gefangenen- betrifft, so dürften die Daten aus den Konzentrationslagern die Hauptthese von Haney, Banks und Zimbardo widerlegen, die dahingehend lautet, dass individuelle Werte, Moral und Überzeugungen, verglichen mit dem überwältigenden Einfluss der Umgebung, keinerlei Unterschiede bewirken. Ganz im Gegenteil beweisen die Unterschiede in der Haltung von apolitischen Gefangenen aus der Mittelklasse (meist [VII-057] Juden) einerseits und von Gefangenen mit einer echten politischen oder religiösen Überzeugung oder beidem andererseits, dass die Wertbegriffe und Überzeugungen der Gefangenen tatsächlich einen entscheidenden Unterschied in ihrer Reaktion auf die Bedingungen des Konzentrationslagers, die für alle gleich waren, bewirken.
Bruno Bettelheim gibt eine höchst lebendige, tiefgründige Analyse dieses Unterschiedes:
Unpolitische, dem Mittelstand angehörende Häftlinge (eine kleine Gruppe in den Konzentrationslagern) waren am wenigsten imstande, den ersten Schock auszuhalten. Sie konnten gar nicht begreifen, was ihnen zugestoßen war und warum es geschehen war. Noch mehr als vorher klammerten sie sich an das, was ihnen bis dahin Selbstachtung gegeben hatte. Noch während sie misshandelt wurden, versicherten sie, nie gegen den Nationalsozialismus gewesen zu sein. Sie konnten nicht verstehen, warum sie, die sich immer vorbehaltlos an die Gesetze gehalten hatten, verfolgt wurden. Nicht einmal, nachdem sie ungerechterweise inhaftiert worden waren, wagten sie es auch nur in Gedanken, sich gegen ihre Unterdrücker aufzulehnen, obwohl ihnen das die Selbstachtung verliehen hätte, die sie so dringend brauchten. Sie verlegten sich aufs Bitten, und viele krochen vor der SS zu Kreuze. Da für sie Gesetz und Polizei unanfechtbar waren, nahmen sie alles, was die Gestapo tat, als gerecht hin. Sie wandten sich lediglich dagegen, dass ausgerechnet sie selbst Opfer einer Verfolgung geworden waren, die sie an sich als gerecht betrachteten, da sie ja von der Obrigkeit veranlasst war. Sie versuchten, das alles zu erklären, indem sie sagten, es müsse sich um einen „Irrtum“ handeln. Die SS-Leute machten sich über sie lustig und misshandelten sie schwer; sie hatten Gefallen an Situationen, in denen sich ihre Überlegenheit zeigte. Die Gruppe als ganze war besonders darauf bedacht, in irgendeiner Weise ihren sozialen Stand respektiert zu sehen. Am meisten bedrückte es sie, „wie gemeine Verbrecher“ behandelt zu werden.
Das Verhalten dieser Menschen zeigte, wie wenig der unpolitische deutsche Mittelstand in der Lage war, sich gegen den Nationalsozialismus zu behaupten. Sie besaßen keinerlei ideellen Rückhalt – ethischer, politischer oder sozialer Natur –, der ihre Integrität geschützt oder ihnen die Stärke gegeben hätte, sich innerlich gegen den Nationalsozialismus aufzulehnen. Sie hatten keine oder nur geringe innere Kraftreserven, auf die sie hätten zurückgreifen können, als der Schock der Verhaftung sie überraschte. Ihr Selbstbewusstsein hatte auf ihrem sozialen Stand und der Achtung beruht, die ihnen ihre Stellung einbrachte, auf ihrem Beruf, auf der Tatsache, dass sie Familienväter waren, oder auf anderen äußerlichen Faktoren. (...)
Fast alle diese Menschen verloren die ihrer Klasse wünschenswert erscheinenden typischen Eigenschaften, wie etwa Selbstachtung und das Gefühl für das, was „sich schickt“. Stattdessen wurden sie völlig hilflos, und die unangenehmen Eigenschaften ihrer Klasse traten deutlich hervor: Kleinlichkeit, Streitsucht, Selbstbemitleidung. Viele von ihnen litten unter Depressionen und Rastlosigkeit und beschwerten sich über alles und jedes. Andere entwickelten sich zu Betrügern und bestahlen ihre Mithäftlinge. (Die SS zu bestehlen oder zu betrügen galt als ebenso ehrenhaft, wie der Kameradendiebstahl als verabscheuungswürdig betrachtet wurde.) Sie schienen nicht mehr in der Lage zu sein, nach ihrer eigenen Fasson zu leben, und richteten sich in ihrem Verhalten nach anderen Häftlingsgruppen. Einige folgten dem Beispiel der kriminellen Häftlinge.
Nur sehr wenige eigneten sich die Verhaltensweisen der politischen Häftlinge an, die in der Regel am angenehmsten, wenn auch fragwürdig waren. Wieder andere versuchten sich im Gefängnis so zu verhalten, wie sie es auch vorher im Leben getan hatten: Sie unterwarfen sich vorbehaltlos denen, die zu sagen hatten. Einige wenige versuchten, sich den der Oberklasse entstammenden Häftlingen anzuschließen und deren Verhalten nachzuahmen. Viel größer war die Zahl derer, die sich selbst zu Sklaven der SS machten; einige wurden sogar zu Spitzeln, wozu sich sonst nur kriminelle Häftlinge hergaben. Das nützte ihnen aber auch nichts, denn die Gestapo wollte zwar den Verrat, verachtete aber den Verräter (B. Bettelheim, 1964, S. 132-134). [VII-058]
Bettelheim gibt hier eine tiefschürfende Analyse des Identitätsgefühls und der Selbstachtung des durchschnittlichen Vertreters der Mittelklasse: Seine soziale Stellung, sein Prestige, seine Befehlsgewalt sind die Stützen, auf denen seine Selbstachtung ruht. Werden ihm diese Stützen genommen, sinkt er moralisch in sich zusammen wie ein Ballon, aus dem man die Luft ablässt. Bettelheim zeigt, warum diese Menschen demoralisiert wurden und warum viele von ihnen zu erbärmlichen Sklaven und sogar zu Spionen der SS wurden. Auf ein wichtiges Element unter den Ursachen dieser Wandlung ist noch hinzuweisen: Diese nichtpolitischen Häftlinge konnten die Situation nicht begreifen; sie konnten nicht verstehen, weshalb sie im Konzentrationslager waren, weil sie in ihrem konventionellen Glauben verhaftet waren, dass nur „Verbrecher“ bestraft werden – und sie waren doch keine Verbrecher. Dieses Nicht-Begreifen und die daraus resultierende Verwirrung haben viel zu ihrem Zusammenbruch beigetragen.
Die politischen und religiösen Häftlinge reagierten völlig anders auf die gleichen Bedingungen.
Für die politischen Häftlinge, die eine Verfolgung durch die SS erwartet hatten, war die Inhaftierung nicht ein derart großer Schock, weil sie psychologisch darauf vorbereitet waren. Sie hassten ihr Schicksal, nahmen es aber als etwas hin, das nach ihrer Meinung in den Gang der Ereignisse zu passen schien. Sie machten sich zwar zu Recht und verständlicherweise Sorgen über ihre Zukunft und das Schicksal ihrer Angehörigen und Freunde, aber fühlten sich ohne Zweifel durch die Inhaftierung nicht erniedrigt, wenn sie auch ebenso sehr wie andere unter den Verhältnissen im Lager litten.
Da die Zeugen Jehovas Wehrdienstverweigerer waren, kamen sie alle ins Konzentrationslager. Ihnen machte die Inhaftierung noch weniger aus als den politischen Häftlingen, und sie bewahrten sich ihre Integrität, weil sie starke religiöse Überzeugungen besaßen. Da ihr einziges Verbrechen in den Augen der SS darin bestand, dass sie sich weigerten, Dienst mit der Waffe zu tun, wurde ihnen häufig Entlassung angeboten, wenn sie sich bereit erklären würden, Wehrdienst zu leisten. Sie blieben standhaft und lehnten ab.
Die Angehörigen dieser Gruppe hatten in der Regel einen begrenzten Horizont und bemühten sich, andere zu ihrem Glauben zu bekehren. Andererseits waren sie beispielhafte Kameraden, hilfsbereit, korrekt, verlässlich. Zu Auseinandersetzungen und Streitereien ließen sie sich nur dann hinreißen, wenn jemand ihre Glaubenswahrheiten anzweifelte. Weil sie gewissenhafte Arbeiter waren, wurden sie oft als Kapos ausgewählt. Wenn sie das geworden waren und die SS-Leute ihnen einen Befehl gaben, bestanden sie darauf, dass die Häftlinge die Arbeit gut und in der dafür vorgesehenen Zeit verrichteten. Sie waren zwar die einzige Gruppe von Häftlingen, die andere Lagerinsassen nie beschimpften oder misshandelten (im Gegenteil, sie waren in der Regel recht höflich gegenüber ihren Mithäftlingen), aber die SS-Leute bevorzugten sie dennoch als Kapos, weil sie arbeitsam, geschickt und zurückhaltend waren. Im Gegensatz zu dem ständigen mörderischen Kleinkrieg zwischen den anderen Häftlingsgruppen missbrauchten die Zeugen Jehovas die Tatsache, dass sie mit den SS-Leuten zu tun hatten, nie dazu, sich eine Vorzugsstellung im Lager zu verschaffen (B. Bettelheim, 1964, S. 135).
Wenn auch Bettelheims Beschreibung der politischen Häftlinge nur sehr skizzenhaft ist[50], geht doch ganz klar daraus hervor, dass die Insassen der Konzentrationslager, die eine [VII-059] Überzeugung hatten und an sie glaubten, auf dieselben Umstände völlig anders reagierten als die Gefangenen, die keine derartigen Überzeugungen hatten. Diese Tatsache widerspricht der behavioristischen These, die C. Haney, C. Banks und P. Zimbardo (1973) mit ihrem Experiment zu beweisen versuchten.
Man fragt sich unwillkürlich nach dem Wert solcher „künstlicher“ Experimente, da für „natürliche“ Experimente so viel Material zur Verfügung steht. Diese Frage drängt sich umso mehr auf, weil derartige Experimente nicht nur die angebliche Genauigkeit vermissen lassen, auf Grund derer sie natürlichen Experimenten vorzuziehen seien, sondern auch, weil das künstliche Arrangement dahin tendiert, die gesamte experimentelle Situation im Vergleich zu der des „wirklichen Lebens“ zu verzerren.
Was ist hier unter „wirklichem Leben“ zu verstehen?
Vielleicht ist es besser, wenn ich den Ausdruck anhand einiger Beispiele statt mit einer formalen Definition erkläre, die nur philosophische und epistemologische Fragen heraufbeschwören würde, deren Diskussion von unserem Hauptthema zu weit abführt.
Bei Manövern wird erklärt, dass eine bestimmte Anzahl Soldaten „getötet“ und eine gewisse Anzahl Geschütze „zerstört“ wurde. Das geschieht entsprechend den Spielregeln, doch hat es für die Soldaten als Person oder für die Geschütze als Gegenstand keinerlei Konsequenzen; der „tote“ Soldat ist froh, dass er sich ein wenig ausruhen kann, und das „zerstörte“ Geschütz wird auch weiterhin seinem Zweck dienen. Das Schlimmste, was der verlierenden Seite passieren könnte, ist, dass ihr kommandierender General bei seiner weiteren Karriere Schwierigkeiten bekommt. Mit anderen Worten hat das, was beim Manöver geschieht, keinerlei Folgen für die reale Situation der meisten Beteiligten.
Auch das Glücksspiel gehört hierher. Die meisten Leute, die sich an Glücksspielen mit Karten, am Roulette oder auch an Pferdewetten beteiligen, sind sich der Grenze zwischen „Spiel“ und „Wirklichkeit“ sehr wohl bewusst; sie spielen nur um Summen, deren Verlust ihre wirtschaftliche Situation nicht ernstlich beeinträchtigen, das heißt, keine schwerwiegenden Folgen nach sich ziehen würde.
Die Minorität der wirklichen „Spieler“ riskiert dagegen Beträge, deren Verlust ihre wirtschaftliche Lage effektiv bis zum Ruin beeinträchtigen würde. Aber der „Spieler“ „spielt“ nicht im eigentlichen Sinn; er praktiziert eine sehr realistische, oft dramatische Lebensform. Die gleiche Konzeption von „Spiel“ und „Realität“ gilt für einen Sport wie das Fechten; keiner der beiden Partner riskiert dabei sein Leben. Wird die Situation so eingerichtet, dass er dies doch tut, so sprechen wir von einem Duell und nicht von Sport.[51]
Wenn die „Versuchspersonen“ sich bei psychologischen Experimenten völlig klar darüber wären, dass das Ganze nur ein Spiel ist, wäre alles sehr einfach. Aber bei vielen Experimenten – wie auch bei dem von Milgram – werden sie falsch informiert und angelogen; was das Gefängnis-Experiment angeht, so wurde da alles so eingerichtet, dass die Versuchspersonen möglichst wenig oder überhaupt nicht erkennen konnten, dass es sich nur um ein Experiment handelte. Gerade die Tatsache, dass viele dieser Experimente, um überhaupt durchführbar zu sein, mit der Vorspiegelung falscher Tatsachen arbeiten [VII-060] müssen, beweist ihre besondere Unwirklichkeit; das Gefühl der Teilnehmer für die Wirklichkeit wird in Verwirrung gebracht, und ihr kritisches Urteilsvermögen wird stark reduziert.[52]
Im „wirklichen Leben“ wissen wir, dass unser Verhalten Konsequenzen nach sich zieht. Jemand mag in seiner Phantasie den Wunsch haben, einen Menschen zu töten, aber diese Phantasie führt nur selten zur Tat. Viele drücken derartige Phantasien in Träumen aus, weil Phantasien im Schlafzustand keine Konsequenzen haben. Experimente, bei denen die Versuchspersonen nicht unbedingt das Gefühl haben, dass es sich um die Wirklichkeit handelt, können eher Reaktionen hervorrufen, die unbewusste Tendenzen repräsentieren, als dass sie zeigen, wie sich der Betreffende in Wirklichkeit verhalten würde.[53] Ob ein Ereignis real oder ein Spiel ist, ist aber auch noch aus einem anderen Grund von entscheidender Wichtigkeit. Bekanntlich mobilisiert eine reale Gefahr eine „Notstandsenergie“, um mit ihr fertig zu werden, und dies oft in einem Ausmaß, dass der Betreffende es nie für möglich gehalten hätte, dass er über so viel physische Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer verfügen würde. Aber diese Notstandsenergie wird nur dann mobilisiert, wenn der ganze Organismus mit einer realen Gefahr konfrontiert ist, und dies aus guten neurophysiologischen Gründen; Gefahren, die man in Tagträumen erlebt, stimulieren dagegen den Organismus nicht auf diese Weise, sondern führen nur zu Angst und Besorgnis. Das gleiche gilt nicht nur für Notstandsreaktionen angesichts der Gefahr, sondern auch für den Unterschied zwischen Phantasie und Wirklichkeit in anderer Hinsicht, zum Beispiel für die Mobilisierung von moralischen Hemmungen und Gewissensreaktionen, die nicht aufkommen, wenn man das Gefühl hat, dass die Gesamtsituation keine reale ist.
Außerdem ist bei derartigen Laboratoriumsexperimenten auch die Rolle des Versuchsleiters zu bedenken. Er herrscht über eine fiktive Realität, die er selbst konstruiert hat und die er kontrolliert. In gewissem Sinn repräsentiert er selbst für die Versuchsperson die Realität; aus diesem Grund übt er einen hypnoiden Einfluss auf sie aus, der dem des Hypnotiseurs auf sein Objekt ähnlich ist. Der Versuchsleiter befreit seine Versuchsperson bis zu einem gewissen Grad von ihrer Verantwortung und dem eigenen Willen und macht sie daher weit eher geneigt, sich seinen Anordnungen zu fügen, als sie dies in einer nicht hypnoiden Situation tun würde.
Schließlich ist der Unterschied zwischen den Schein-Gefangenen und den wirklichen Gefangenen so groß, dass es praktisch unmöglich ist, aus der Beobachtung der ersteren gültige Analogien abzuleiten.[54] Für einen Gefangenen, der wegen einer bestimmten [VII-061] Handlung ins Gefängnis gekommen ist, ist die Situation äußerst real; er kennt die Gründe – ob seine Bestrafung gerecht ist oder nicht, ist ein anderes Problem –, er kennt seine Hilflosigkeit und die wenigen Rechte, die er hat, er kennt seine Chancen für eine frühzeitige Entlassung. Ob jemand weiß, dass er (selbst unter den schlimmsten Bedingungen) nur zwei Wochen im Gefängnis bleiben muss, oder ob es sich um zwei Monate, zwei Jahre oder um zwanzig Jahre handelt, ist ganz offensichtlich ein Faktor, der seine Haltung entscheidend beeinflussen muss. Dieser Faktor ist entscheidend für seine Hoffnungslosigkeit, seine Demoralisierung und gelegentlich (wenn auch nur ausnahmsweise) auch für die Mobilisierung neuer Energien – mit guten oder schlechten Zielen. Außerdem ist ein Gefangener nicht schlechthin „ein Gefangener“. Gefangene sind Individuen und reagieren auf individuelle Weise, je nach ihrer unterschiedlichen Charakterstruktur. Das besagt jedoch nicht, dass ihre Reaktion nur die Funktion ihres Charakters und nicht auch die ihrer Umgebung ist. Es wäre sehr naiv, annehmen zu wollen, dass sie entweder das eine oder das andere sein müsste. Das komplexe, schwierige Problem ist, bei jedem Einzelnen – und bei jeder Gruppe – herauszufinden, welche spezifische Interaktion zwischen einer gegebenen Charakterstruktur und einer gegebenen gesellschaftlichen Struktur besteht. Erst an diesem Punkt beginnt eine wirkliche Forschung, die durch die Annahme, dass die Situation der einzige Faktor sei, der menschliches Verhalten erklärt, nur gehemmt wird.
Die Frustrations-Aggressions-Theorie
Es existieren noch viele andere behavioristisch orientierte Untersuchungen über Aggression[55], von denen jedoch keine eine allgemeine Theorie über die Ursprünge von Aggression und Gewalt entwickelt, mit Ausnahme der Frustrations-Aggressions-Theorie von J. Dollard et al. (1939), welche den Anspruch erhebt, die Ursache jeder Aggression gefunden zu haben. Genauer gesagt lautet diese Theorie: „Das Auftreten aggressiven Verhaltens setzt stets das Vorhandensein von Frustration voraus, und umgekehrt führt das Vorhandensein von Frustration stets zu irgendeiner Form von Aggression“ (J. Dollard et al., 1939, S. 1; dt.: S. 9). Zwei Jahre später gab einer der Verfasser, N. E. Miller, den zweiten Teil der Hypothese wieder auf und räumte ein, dass die Frustration auch eine Anzahl andersartiger Reaktionen hervorrufen könne und dass die Aggression nur eine der möglichen Reaktionen sei. (N. E. Miller, 1941).
Wie Buss feststellt, wurde diese Theorie mit nur sehr wenigen Ausnahmen von fast allen Psychologen anerkannt. Buss selbst kommt zu dem kritischen Ergebnis: „Der Nachdruck, der auf die Frustration gelegt wurde, hat leider dazu geführt, dass man die andere große Klasse der Antezedenzien (schädliche Reize) ebenso vernachlässigte, wie die Aggression als instrumentale Reaktion. Die Frustration ist nur ein Antezedens der Aggression und nicht das wirksamste“ (A. H. Buss, 1961, S. 28).
Eine gründliche Diskussion der Frustrations-Aggressions-Theorie ist im Rahmen dieses Buches wegen der umfangreichen einschlägigen Literatur, die zu behandeln wäre, nicht [VII-062] möglich.[56] Ich werde mich daher im Folgenden auf ein paar grundlegende Gesichtspunkte beschränken.
Die Einfachheit der ursprünglichen Formulierung der Theorie wird stark durch die Vieldeutigkeit dessen beeinträchtigt, was man unter Frustration versteht. Grundsätzlich gibt es zwei Bedeutungen: a) die Unterbrechung einer begonnenen, zielgerichteten Aktivität. (Beispiele dafür wären etwa, wenn ein Junge die Hand in der Keksbüchse hat und die Mutter ins Zimmer kommt und ihm Einhalt gebietet; oder wenn jemand im Zustand sexueller Erregung im Coitus unterbrochen wird.) b) Frustration als Negation eines Begehrens oder eines Wunsches – „Versagung“ nach Buss. (Beispiele hierfür wären, wenn der Junge seine Mutter um ein Keks bittet und sie es ihm versagt oder wenn ein Mann einer Frau einen Antrag macht und sie ihn zurückweist.)
Ein Grund für die Vieldeutigkeit des Begriffes „Frustration“ liegt darin, dass Dollard et al. (1939) sich nicht mit der nötigen Klarheit ausdrücken. Ein weiterer Grund ist wahrscheinlich der, dass das Wort „Frustration“ in der Umgangssprache meist im zweiten Sinn gebraucht wird und dass psychoanalytische Gedankengänge hierzu auch beigetragen haben dürften. (Zum Beispiel wird das Verlangen eines Kindes nach Liebe von seiner Mutter „frustriert“.)
Je nach der Bedeutung des Wortes „Frustration“ haben wir es mit zwei völlig verschiedenen Theorien zu tun. Frustration im ersteren Sinn dürfte relativ selten sein, da die Voraussetzung dafür ist, dass die beabsichtigte Aktivität bereits begonnen hat. Das dürfte nicht häufig genug vorkommen, um damit alle Aggression oder auch nur einen beträchtlichen Teil erklären zu können. Andererseits könnte aber die Erklärung der Aggression als Folge der Unterbrechung einer Aktivität der einzige stichhaltige Teil der Theorie sein. Neue neurophysiologische Daten könnten für einen Beweis oder eine Widerlegung dieser Theorie von entscheidender Bedeutung sein.
Andererseits hat es den Anschein, dass sich die Theorie, die sich auf die zweite Bedeutung des Wortes „Frustration“ gründet, nicht gegen das Gewicht empirischer Tatsachen behaupten kann. Vor allem müssen wir eine grundlegende Tatsache des Lebens bedenken: dass nichts Wichtiges erreicht werden kann, ohne Frustration zu akzeptieren. Die Idee, man könne ohne Mühe, das heißt ohne Frustration, lernen, mag als Werbeslogan gut sein, doch stimmt sie ganz gewiss nicht, wenn es darum geht, wichtigere Fertigkeiten zu erlangen. Wenn der Mensch nicht die Fähigkeit besessen hätte, sich mit Frustrationen abzufinden, hätte er sich vermutlich überhaupt nicht weiterentwickelt. Und zeigt uns nicht unsere Alltagserfahrung, dass immer wieder Menschen Versagungen erleiden, ohne dass sie darauf mit Aggression reagieren?[57] Was dagegen eine wichtige Rolle spielt, ist die Bedeutung, welche die Frustration für den Betreffenden hat, und diese psychologische Bedeutung der Frustration ist je nach der Gesamtkonstellation, in der sie auftritt, sehr unterschiedlich.
Wenn man zum Beispiel einem Kind verbietet, Süßigkeiten zu essen, so wird diese [VII-063] Frustrierung keine Aggression mobilisieren, falls die Eltern dem Kind gegenüber eine liebevolle Haltung einnehmen, die nicht auf Kontrolle aus ist. Ist jedoch dieses Verbot nur eine von vielen Manifestationen des elterlichen Wunsches, das Kind zu beherrschen, oder bekommt beispielsweise das kleine Geschwisterchen ein Keks, so mag das einen beträchtlichen Zornausbruch zur Folge haben. Was diese Aggression hervorruft, ist nicht die Frustration als solche, sondern die in der Situation enthaltene Ungerechtigkeit oder Zurückweisung.
Der wichtigste Faktor bei der Feststellung von Frustration und der Beurteilung ihrer Intensität ist der Charakter des Betreffenden. Ein gieriger Mensch zum Beispiel wird mit Zorn reagieren, wenn er nicht so viel zu essen bekommt, wie er haben möchte, und ein geiziger Mensch wird aggressiv, wenn sein Wunsch, etwas billig einzukaufen, frustriert wird. Ein narzisstischer Mensch fühlt sich frustriert, wenn er nicht das Lob und die Anerkennung findet, die er erwartet. Vom Charakter eines Menschen hängt in erster Linie ab, was ihn frustriert, und in zweiter Linie die Intensität seiner Reaktion auf die Frustration.
So wertvoll wie viele der behavioristisch orientierten psychologischen Forschungsarbeiten über die Aggression sind, was ihre speziellen Ziele betrifft, so ist ihnen doch keine Formulierung einer globalen Hypothese über die Ursachen der gewalttätigen Aggression gelungen. „Nur wenige der von uns untersuchten Arbeiten“, sagt Megargee am Ende seines vorzüglichen Überblicks über die psychologische Literatur, „haben den Versuch gemacht, die Theorien über die menschliche Gewaltsamkeit zu überprüfen. Die empirischen Untersuchungen, die sich mit ihr beschäftigen, dienten im allgemeinen nicht der Überprüfung von Theorien. Forschungsarbeiten, die sich mit wichtigen theoretischen Problemen befassen, untersuchten meist mildere Formen aggressiven Verhaltens, oder sie bedienen sich inframenschlicher Versuchsobjekte“ (E. I. Megargee, 1969; Hervorhebung E. F.). Angesichts der Begabung dieser Forscher, des ihnen zur Verfügung stehenden Materials und der zahlreichen Studenten, die sich wissenschaftlich auszeichnen möchten, bestätigen diese mageren Resultate die Annahme, dass die behavioristische Psychologie sich nicht für die Entwicklung einer systematischen Theorie über die Quellen der gewalttätigen Aggression eignet.
3. Triebtheorien und Behaviorismus – ihre Unterschiede und Ähnlichkeiten
Gemeinsamkeiten
Der Mensch der Instinkt- und Triebtheorien lebt die Vergangenheit der Art, der Mensch der Behavioristen die Gegenwart des gesellschaftlichen Systems. Ersterer ist eine Maschine, die nur die ererbten Muster der Vergangenheit, letzterer ist eine Maschine[58], die nur die sozialen Muster der Gegenwart produzieren kann. Trieblehren und Behaviorismus haben eine Grundprämisse gemeinsam: dass der Mensch keine Psyche mit eigener Struktur und eigenen Gesetzen besitzt.
Für die Trieb- und Instinktforschung im Sinne von Lorenz gilt dasselbe, was am radikalsten von einem seiner früheren Schüler, Paul Leyhausen, formuliert wurde. Er kritisiert all jene Psychologen, die sich mit menschlichen Wesen befassen (die Humanpsychologen) und behaupten, alles Psychische könne nur psychologisch, das heißt auf der Basis psychologischer Prämissen erklärt werden. (Das „nur“ ist eine leichte Übertreibung ihrer Position der besseren Argumentation zuliebe.) Leyhausen behauptet im Gegenteil:
Wenn wir irgendwo die Erklärung für psychisches Geschehen und Erleben ganz bestimmt nicht finden, dann ist es im Psychischen selbst, und zwar aus dem gleichen Grunde, weshalb wir die Erklärung für die Verdauung nicht in den Verdauungsvorgängen finden, sondern in jenen besonderen ökologischen Verhältnissen, die vor etwa einer Milliarde Jahren eine Anzahl von Organismen einem Selektionsdruck aussetzten, der sie dazu brachte, statt nur anorganische Nährstoffe zu assimilieren, nun auch solche organischer Natur aufzunehmen. Die psychischen Vorgänge sind ganz ebenso unter Selektionsdruck entstandene Leistungen von lebens- und arterhaltendem Wert, und die Erklärung für sie liegt in jedem Sinne vor ihnen. (K. Lorenz, P. Leyhausen, 1968, S. 14).
Einfacher ausgedrückt, behauptet Leyhausen, man könne psychologische Fakten allein aus dem Evolutionsprozess erklären. Das Ausschlaggebende hierbei ist, was man unter „erklären“ versteht. Wenn man beispielsweise wissen möchte, wie der Angsteffekt [VII-065] sich als Ergebnis der Gehirnentwicklung von den niedrigsten bis zu den höchsten Lebewesen entwickeln konnte, so ist dies Aufgabe jener Wissenschaftler, die die Evolution des Gehirns erforschen. Will man dagegen erklären, warum ein Mensch Angst hat, werden die Daten der Evolution kaum viel zur Beantwortung beitragen. Die Erklärung ist dann notwendigerweise im wesentlichen eine psychologische. Vielleicht fühlt sich der Betreffende von einem stärkeren Feind bedroht, oder er versucht mit seiner eigenen unterdrückten Aggression fertig zu werden, oder er leidet unter einem Gefühl der Machtlosigkeit, oder ein paranoides Element in seinem Inneren bewirkt, dass er sich verfolgt fühlt, und es gibt noch viele andere Faktoren, aus denen allein oder aus deren Zusammenspiel sich die Angst erklären lässt. Der Versuch, die Angst einer bestimmten Person aus einem Evolutionsprozess zu erklären, ist von vornherein aussichtslos.
Leyhausens Prämisse, der einzig mögliche Weg zur Erforschung menschlicher Phänomene sei der evolutionäre, bedeutet, dass wir den psychischen Prozess im Menschen ausschließlich auf Grund unseres Wissens erklären können, wie er im Verlauf der Evolution zu dem wurde, was er ist. Ähnlich behauptet er, man könne die Verdauungsprozesse nur aus Bedingungen erklären, wie sie vor Millionen Jahren existierten. Könnte ein Arzt, der sich mit den Störungen des Verdauungstrakts bei einem Patienten befasst, diesem helfen, wenn er sich um die Evolution der Verdauung kümmerte, anstatt um die Ursachen des speziellen Symptoms bei diesem speziellen Patienten? Für Leyhausen wird die Evolution zur einzigen Wissenschaft, die alle anderen Wissenschaften, welche sich mit dem Menschen befassen, absorbiert. Meines Wissens hat Lorenz selbst dieses Prinzip nie so drastisch formuliert, doch gründet sich seine Theorie auf dieselbe Prämisse. Er behauptet, der Mensch könne sich nur hinreichend verstehen, wenn er den Evolutionsprozess verstehe, der ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist.[59]
Trotz ihrer großen Unterschiede besitzen die Trieb- und die behavioristische Theorie eine gemeinsame Grundorientierung. Sie entfernen beide die Person, den sich verhaltenden Menschen aus ihrem Gesichtsfeld. Ob der Mensch das Produkt der Konditionierung oder das Produkt der Evolution der Lebewesen ist, er wird in beiden Fällen ausschließlich durch Bedingungen determiniert, die außerhalb seiner selbst liegen. Er hat keinen Teil an seinem Leben, keine Verantwortung und keine Spur von Freiheit. Der Mensch ist eine Marionette, kontrolliert von den Trieben oder der Konditionierung.
Neuere Auffassungen
Trotz – oder vielleicht auch wegen – der Tatsache, dass die Instinkt- und Triebforscher und die Behavioristen gewisse Züge in ihrem Menschenbild und ihrer philosophischen Orientierung gemeinsam haben, bekämpften sie sich mit einem bemerkenswerten Fanatismus. „Nature OR nurture“, „Trieb ODER Milieu“ wurden zu Flaggen, unter denen sich die jeweilige Seite sammelte, von denen keine bereit war, Gemeinsamkeiten zu sehen. [VII-066]
In den letzten Jahren existiert eine wachsende Tendenz, die scharfen Alternativen im Krieg zwischen Instinkt- bzw. Trieblehren und Behaviorismus zu überwinden. Eine Lösung bestand darin, dass man die Terminologie änderte. Einige wollten den Terminus „Instinkt“ für die niedrigeren Tiere reserviert wissen und bei menschlichen Motivationen von „organischen Trieben“ sprechen. Auf diese Weise kamen Formulierungen zustande wie: „Das Verhalten des Menschen ist größtenteils erlernt, während das Verhalten eines Vogels größtenteils nicht erlernt ist“ (M. F. Nimkoff, 1953, S. 295). Diese Formulierung ist charakteristisch für die neue Tendenz, das alte „Entweder-oder“ durch eine „Mehr-oder-weniger“-Formulierung zu ersetzen, um auf diese Weise der allmählichen Veränderung im Gewicht der betreffenden Faktoren Rechnung zu tragen. Das Modell für diese Auffassung ist ein Kontinuum, an dessen einem Ende die (fast) vollständige angeborene Determination liegt, während am anderen Ende das (fast) vollständige Lernen steht.
F. A. Beach, ein namhafter Gegner der Instinkt-Theorie, schreibt:
Eine vielleicht noch ernster zu nehmende Schwäche in der gegenwärtigen psychologischen Behandlung des Instinktes liegt in der Annahme, ein Zwei-Klassen-System sei für die Klassifizierung eines komplexen Verhaltens adäquat. Die stillschweigende Voraussetzung, alles Verhalten müsse durch Lernen oder Vererbung determiniert sein, wobei beide Begriffe nur zum Teil verstanden werden, ist völlig ungerechtfertigt. Die endgültige Form einer Reaktion wird von einer Vielzahl von Variablen beeinflusst, von denen nur zwei genetisch oder erfahrungsbedingt sind. Die Psychologie sollte sich mit der Identifikation und Analyse aller dieser Faktoren befassen. Wenn diese Aufgabe richtig verstanden und durchgeführt wird, wird es überflüssig, noch weiter über die unklaren Auffassungen des instinktiven Verhaltens zu disputieren (F. A. Beach, 1955, S. 405 f.).
Ähnlich schreiben auch N. R. F. Maier und T. C. Schneirla:
Da das Lernen für das Verhalten höherer Lebewesen eine wichtigere Rolle spielt als für die niedrigeren Formen, werden die angeborenen Verhaltensmuster der höheren Formen viel weitgehender durch die Erfahrung modifiziert als die der niedrigeren Formen. Durch eine solche Modifikation kann sich das Tier an eine andere Umgebung anpassen und aus der engen Begrenzung ausbrechen, die ihm die optimale Bedingung aufzwingt. Höhere Formen sind daher für ihr Überleben weniger abhängig von spezifischen äußeren Umweltbedingungen als die niedrigeren Formen.
Wegen der Interaktion erworbener und angeborener Verhaltensfaktoren ist es unmöglich, viele Verhaltensmuster zu klassifizieren. Jeder Verhaltenstyp muss getrennt untersucht werden (N. R. F. Maier und T. C. Schneirla, 1964, S. 284).
Die in diesem Buch vertretene Anschauung ist in mancher Hinsicht der der oben erwähnten Autoren und der anderer Forscher ähnlich, die sich weigern, noch länger unter der Flagge der „Instinkte“ gegen die Vertreter des „Lernens“ zu kämpfen. Ich werde jedoch im Dritten Teil zeigen, dass das wichtigere Problem vom Standpunkt dieser Untersuchung aus ist, dass man unterscheidet zwischen „organischen Trieben“ (Nahrung, Kampf, Flucht, Sexualität), deren Funktion es ist, das Überleben des Individuums und der Art zu gewährleisten, und den „nichtorganischen Trieben“ (im Charakter wurzelnde Leidenschaften)[60], [VII-067] welche nicht phylogenetisch programmiert und nicht allen Menschen gemeinsam sind, wozu das Streben nach Liebe und Freiheit sowie die Destruktivität, der Narzissmus, der Sadismus und der Masochismus gehören.
Diese nichtorganischen Triebe, welche die zweite Natur des Menschen ausmachen, werden oft mit den organischen Trieben verwechselt. Ein solcher Fall ist der Sexualtrieb. Es ist eine psychoanalytisch wohlbegründete Beobachtung, dass die Intensität dessen, was subjektiv als Sexualwunsch erlebt wird (einschließlich seiner entsprechenden physiologischen Manifestationen), oft auf nichtsexuelle Leidenschaften zurückzuführen ist, wie zum Beispiel auf Narzissmus, Sadismus, Masochismus, Machtstreben und sogar auf Angst, Einsamkeit und Langeweile.
Für einen narzisstischen Mann kann zum Beispiel der Anblick einer Frau deshalb sexuell erregend wirken, weil er durch die Möglichkeit, sich selbst seine Attraktivität beweisen zu können, erregt wird. Oder ein sadistischer Mensch kann dadurch sexuell erregt werden, dass er die Chance hat, eine Frau (oder je nachdem einen Mann) zu erobern und zu beherrschen. Viele sind durch eben dieses Motiv jahrelang emotional aneinander gebunden, besonders dann, wenn der Sadismus des einen Partners dem Masochismus des anderen entspricht. Bekanntlich machen Ruhm, Macht und Reichtum ihren Besitzer sexuell attraktiv, wenn bestimmte körperliche Voraussetzungen gegeben sind. In allen diesen Fällen wird das körperliche Begehren durch nichtsexuelle Leidenschaften mobilisiert, die auf diese Weise befriedigt werden. Es bleibt jedem überlassen zu schätzen, wie viele Kinder ihre Existenz der Eitelkeit, dem Sadismus und Masochismus und nicht einer echten körperlichen Anziehung verdanken, von Liebe ganz zu schweigen. Aber die Leute, besonders Männer, halten sich lieber für „besonders leicht sexuell erregbar“ als für „übertrieben eitel“.[61]
Das gleiche Phänomen hat man in Fällen zwanghaften Essens gründlich klinisch untersucht. Dieses Symptom ist nicht durch „physiologischen“, sondern durch „psychischen“ Hunger motiviert, der durch Gefühle von Depression, Angst und „Leere“ hervorgerufen wird.
Meine These – die in den folgenden Kapiteln zu beweisen ist – lautet, dass Destruktivität und Grausamkeit keine instinktiven Triebe, sondern Leidenschaften sind, die in der Gesamtexistenz des Menschen wurzeln. Sie gehören zu den Möglichkeiten, dem Leben einen Sinn zu geben; sie sind beim Tier kaum zu finden, sie können dies auch nicht sein, weil sie ihrer Natur nach im „Menschsein“ verwurzelt sind. Der Hauptirrtum von Lorenz und anderen Instinktforschern ist der, dass sie die beiden Arten von Trieben, die im Instinkt verwurzelten und die im Charakter verwurzelten, durcheinanderbrachten. Ein sadistischer Mensch, der gleichsam auf eine Gelegenheit wartet, seinem Sadismus Ausdruck verleihen zu können, erweckt den Eindruck, als ob auf ihn das hydraulische Modell des aufgestauten Instinktes passte. Aber nur Menschen mit sadistischem Charakter warten auf die Gelegenheit, sich sadistisch betätigen zu können, genauso wie Menschen mit liebevollem Charakter auf die Gelegenheit warten, ihrer Liebe Ausdruck zu verleihen. [VII-068]
Der politische und gesellschaftliche Hintergrund beider Theorien
Es ist instruktiv, den gesellschaftlichen und politischen Hintergrund der Fehde zwischen den Vertretern der Milieutheorie und denen der Trieb- und Instinktlehren etwas genauer zu untersuchen.
Die Milieutheorie ist gekennzeichnet vom Geist der politischen Revolution des Bürgertums im achtzehnten Jahrhundert. Der Feudalismus stützte sich auf die Annahme, dass seine Ordnung die natürliche war. Bei dem Kampf gegen diese „natürliche“ Ordnung, die das Bürgertum stürzen wollte, lag die Theorie nahe, dass der Status eines Menschen in keiner Weise von irgendwelchen angeborenen oder natürlichen Faktoren, sondern einzig und allein von den gesellschaftlichen Verhältnissen abhing, deren Verbesserung sich die Revolution zum Ziel gesetzt hatte. Alle Laster und alle Torheiten wurden nicht aus der menschlichen Natur, sondern aus den schlechten und lasterhaften Einrichtungen der Gesellschaft erklärt. Daher stand einem absoluten Optimismus in Bezug auf die Zukunft der Menschheit nichts im Wege.
Während so die Milieutheorie eng mit den revolutionären Hoffnungen des aufstrebenden Bürgertums im achtzehnten Jahrhundert verknüpft war, spiegeln sich in den auf Darwins Lehren basierenden Instinkt- und Trieblehren die Grundauffassungen des Kapitalismus des neunzehnten Jahrhunderts. Der Kapitalismus als ein System, bei dem durch rücksichtslosen Konkurrenzkampf aller gegen alle Harmonie entsteht, würde als natürliche Ordnung erscheinen, wenn man beweisen könnte, dass das komplexeste und erstaunlichste aller Phänomene, der Mensch, das Produkt dieses Konkurrenzkampfes aller Lebewesen seit dem Beginn des Lebens ist. Die Entwicklung des Lebens vom einzelligen Organismus bis zum Menschen würde dann als das großartigste Beispiel freien Unternehmertums erscheinen, bei dem die Besten durch den Konkurrenzkampf gewinnen und bei dem alle diejenigen ausgemerzt werden, die nicht die Fähigkeiten haben, in dem sich weiterentwickelnden ökonomischen System überleben zu können.[62]
Die Gründe für die siegreich gegen die Instinkt- und Trieblehre gerichtete Revolution, die in den zwanziger Jahren von K. Dunlap, Zing Yang Kuo und L. Bernard angeführt wurde, sind im unterschiedlichen Charakter des Kapitalismus des zwanzigsten und des neunzehnten Jahrhunderts zu suchen. Ich möchte hier nur auf einige in diesem Zusammenhang relevante Punkte eingehen. Der Kapitalismus des neunzehnten Jahrhunderts war ein verbissener Konkurrenzkampf unter den Kapitalisten, der zur Ausmerzung der schwächeren und weniger tüchtigen führte. Im Kapitalismus des zwanzigsten Jahrhunderts ist an die Stelle des Konkurrenzkampfes bis zu einem gewissen Grade die Kooperation der großen Konzerne getreten. Man musste daher nicht mehr den Beweis erbringen, dass der rücksichtslose Konkurrenzkampf einem Naturgesetz entsprach. Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der veränderten Methode der Herrschaft. Im Kapitalismus des neunzehnten Jahrhunderts gründet sich Herrschaft im Großen und Ganzen auf die Ausübung streng patriarchalischer Prinzipien, die moralisch durch die Autorität Gottes [VII-069] und des Königs gestützt wurden. Der kybernetische Kapitalismus mit seinen gigantischen zentralisierten Unternehmen und seiner Fähigkeit, die Arbeiter mit Brot und Spielen zu versorgen, ist in der Lage, durch psychologische Manipulation und „human engineering“ die Menschen zu kontrollieren. Er braucht einen Menschen, der besonders formbar und leicht zu beeinflussen ist, und nicht so sehr einen, dessen „Instinkte“ von der Angst vor Autorität beherrscht werden. Schließlich hat unsere heutige Industriegesellschaft auch eine andere Auffassung vom Ziel des Lebens, als das vorige Jahrhundert. Damals war das Ideal – wenigstens beim Bürgertum – Unabhängigkeit und private Initiative. Man wollte „sein eigener Herr“ sein. Heute dagegen ist das ersehnte Ziel uneingeschränkter Konsum und uneingeschränkte Beherrschung der Natur. Die Menschheit wird angefeuert durch den Traum, eines Tages die Natur vollständig zu beherrschen und wie Gott zu sein; warum sollte etwas in der menschlichen Natur sein, was nicht unter Kontrolle zu bringen ist?
Aber wenn im Behaviorismus die Stimmung des Industrialismus des zwanzigsten Jahrhunderts zum Ausdruck kommt, wie erklärt sich dann das Wiederaufleben der Trieb- bzw. Instinktlehren in den Schriften von Lorenz und seine Popularität bei der breiten Öffentlichkeit? Wie bereits angedeutet, ist ein Grund dafür das Gefühl der Angst und Hoffnungslosigkeit, das viele wegen der ständig wachsenden Gefahren erfüllt, gegen die nichts unternommen wird. Viele, die an den Fortschritt geglaubt und darauf gehofft hatten, dass sich das Schicksal der Menschen grundsätzlich ändern würde, nehmen jetzt ihre Zuflucht zu der Erklärung, dass die menschliche Natur an diesem Versagen schuld sein muss, anstatt dass sie den gesellschaftlichen Prozess, der zu ihrer Enttäuschung geführt hat, sorgfältig analysieren. Schließlich sind noch die persönlichen und politischen Standpunkte der Autoren zu berücksichtigen, die sich zu Befürwortern des neuen Instinktivismus gemacht haben.
Einige Schriftsteller auf diesem Gebiet sind sich der politischen und philosophischen Konsequenzen ihrer diesbezüglichen Theorien nur vage bewusst. Auch die Kommentatoren ihrer Theorien haben diesen Zusammenhängen kaum Beachtung geschenkt. Es gibt jedoch Ausnahmen. N. Pastore (1949) hat die gesellschaftspolitischen Ansichten von vierundzwanzig Psychologen, Biologen und Soziologen hinsichtlich des Nature-nurture-Problems miteinander verglichen. Von den zwölf „Liberalen“ oder Radikalen waren elf Vertreter der Milieutheorie und nur einer ein Anhänger der Vererbungslehre; von den zwölf „Konservativen“ waren elf Vertreter der Vererbungslehre und nur einer ein Vertreter der Milieutheorie. Selbst wenn man die geringe Anzahl der Beteiligten in Betracht zieht, ist dieses Ergebnis recht aufschlussreich.
Andere Autoren sind sich auch über die emotionalen Faktoren klar, wenn auch gewöhnlich nur in den Hypothesen ihrer Gegner. Ein gutes Beispiel für diese einseitige Erkenntnis ist die Feststellung eines der namhaftesten Vertreter der orthodoxen Psychoanalyse, R. Waelder:
Ich beziehe mich hierbei auf eine Gruppe von Kritikern, die entweder regelrechte Marxisten waren oder zu jener Richtung der westlichen liberalen Tradition gehörten, deren Ableger der Marxismus war, nämlich der Denkrichtung, die leidenschaftlich davon überzeugt war, dass der Mensch von Natur aus „gut“ ist und dass alle Übel und Missstände in den menschlichen Angelegenheiten auf die verdorbenen Institutionen [VII-070] zurückzuführen sind – etwa auf die Einrichtung des Privateigentums oder – in einer neueren und gemäßigteren Version – auf die sogenannte „neurotische Kultur“. (...)
Aber ganz gleich ob man Vertreter der Evolutionstheorie oder Revolutionär ist, ob man in seinen Anschauungen gemäßigt oder radikal oder einseitig orientiert ist, niemand, der an die fundamentale Gutheit des Menschen glaubt und der davon überzeugt ist, dass für das menschliche Leiden ausschließlich äußere Ursachen verantwortlich sind, wird umhin können, durch die Theorie von einem Destruktions- oder Todestrieb in Verwirrung zu geraten. Denn wenn diese Theorie stimmt, dann sind die Möglichkeiten für Konflikte und für Leiden dem menschlichen Dasein inhärent und die Versuche, Leiden abzuschaffen oder zu mildern, scheinen, wenn nicht überhaupt ein hoffnungsloses Unterfangen, mindestens weit komplizierter zu sein, als es sich die sozialen Revolutionäre vorgestellt haben (R. Waelder, 1956).
So scharfsinnig Waelders Bemerkungen sind, man sollte doch nicht übersehen, dass er nur die Einstellung der Gegner- der Trieb- und Instinktlehren berücksichtigt und nicht die derjenigen, die seine eigene Auffassung teilen.
4. Der psychoanalytische Weg zum Verständnis der Aggression
Bietet die Psychoanalyse eine Methode zum Verständnis der Aggression, die die Verkürzungen des Behaviorismus und der Trieb- bzw. Instinktlehren vermeidet? Auf den ersten Blick hat man den Eindruck, dass die Psychoanalyse diese Nachteile nicht ausschaltet, sondern im Gegenteil, dass sie mit den Nachteilen beider Richtungen belastet ist. Die psychoanalytische Theorie ist gleichzeitig ihren allgemeinen theoretischen Vorstellungen nach in den Instinktlehren verwurzelt[63] und umweltorientiert in ihrem therapeutischen Bezug.
Dass Freuds Theorie[64] in den Instinkttheorien wurzelt, da sie das menschliche Verhalten aus dem Widerstreit von Selbsterhaltungstrieb und Sexualtrieb (und in seiner späteren Theorie von Lebens- und Todestrieb) erklärt, ist zu allgemein bekannt, als dass ich es hier noch im einzelnen belegen müsste. Dass der Begriffsrahmen gleichzeitig milieuorientiert ist, ist ebenfalls leicht zu erkennen, wenn man bedenkt, dass die analytische Therapie die Entwicklung der Persönlichkeit aus der spezifischen Umweltkonstellation der frühen Kindheit, das heißt dem Einfluss der Familie, zu erklären versucht. Dieser Aspekt verträgt sich jedoch insofern mit den Instinktlehren, als angenommen wird, dass der modifizierende Einfluss der Umgebung über den Einfluss der libidinösen Struktur erfolgt.
In der Praxis jedoch erweisen Patienten, Öffentlichkeit und häufig auch die Analytiker selbst dem spezifischen Einfluss des Sexualtriebs nur einen Lippendienst (wobei dessen Auswirkungen oft auf Grund von „Funden“ rekonstruiert werden und diese „Funde“ selbst oft nur eine Konstruktion darstellen, die sich auf das System theoretischer Erwartungen gründet); oft vertritt man eine Stellung, die völlig der Milieutheorie entspricht. Das Axiom lautet, dass jede negative Entwicklung beim Patienten als Resultat [VII-072] schädigender Einflüsse in seiner frühen Kindheit zu verstehen ist. Dies hat manchmal zu unberechtigten Selbstanklagen der Eltern geführt, die glaubten, an jedem unerwünschten oder pathologischen Charakterzug schuld zu sein, der bei ihrem Kind nach dessen Geburt auftauchte, während die Patienten in der Analyse dazu neigten, ihre Eltern für alle Störungen verantwortlich zu machen, wodurch sie es sich ersparten, sich mit dem Problem ihrer eigenen Verantwortlichkeit auseinanderzusetzen.
Angesichts dieser Tatsachen könnte es nur legitim erscheinen, wenn die Psychologen die Psychoanalyse als Theorie in die Kategorie der Instinktlehren einreihten, und so sind ihre Argumente gegen Lorenz eo ipso Argumente gegen die Psychoanalyse. Doch ist hier Vorsicht geboten. Die Frage lautet: Wie ist die Psychoanalyse zu definieren? Stellt sie die Gesamtsumme von Freuds Theorien dar, oder kann man auch bei ihm zwischen den ursprünglichen und schöpferischen und den nebensächlichen, zeitbedingten Teilen seines Systems unterscheiden, eine Unterscheidung, welche man im Werk aller großen Pioniere des Denkens machen kann? Wenn eine solche Unterscheidung legitim ist, müssen wir uns fragen, ob die Libidotheorie zum Kern von Freuds Werk gehört oder ob es sich dabei nur um die Form handelt, in die er seine neuen Einsichten gefasst hat, weil er angesichts seiner philosophischen und wissenschaftlichen Umwelt seine Grunderkenntnisse nicht anders konzipieren und ausdrücken konnte (vgl. E. Fromm, 1970d).
Freud selbst hat nie den Anspruch erhoben, dass seine Libidotheorie wissenschaftlich gesichert sei. Er bezeichnete sie als „unsere Mythologie“ und ersetzte sie dann durch seine Theorie vom Eros und dem Todes-“Trieb“. Ebenso bedeutungsvoll ist, dass er die Psychoanalyse als eine Theorie definierte, die sich auf Widerstand und Übertragung gründet – und nicht auf die Libidotheorie, was daraus zu schließen ist, dass er sie in diesem Zusammenhang nicht erwähnt.
Noch wichtiger als Freuds eigene Äußerungen ist jedoch, dass man sich vor Augen hält, was seinen Entdeckungen ihre einzigartige historische Bedeutung verleiht: ganz sicher nicht seine Triebtheorien als solche. Instinkt- und Triebtheorien waren seit dem neunzehnten Jahrhundert recht verbreitet. Dass er den Sexualtrieb (neben dem Selbsterhaltungstrieb) als die Quelle aller Leidenschaften heraushob, war neu und revolutionär in einer Zeit, in der noch immer die Moral des viktorianischen Bürgertums herrschte. Aber selbst diese spezielle Version der Trieb- und Instinkttheorie hätte wahrscheinlich nicht diesen mächtigen dauernden Eindruck hinterlassen. Meiner Ansicht nach beruht Freuds historische Bedeutung auf der Entdeckung der unbewussten Prozesse, und zwar nicht auf philosophischem oder spekulativem, sondern auf empirischem Wege, wie er in einigen seiner Einzelfallstudien und besonders in seinem grundlegenden Werk, der Traumdeutung (S. Freud, 1900a) dargelegt hat. Wenn man beispielsweise zeigen kann, dass ein bewusst friedlicher und gewissenhafter Mensch mächtige Impulse hat zu töten, so ist es von sekundärer Bedeutung, ob man diese Impulse auf den „ödipalen“ Hass gegen seinen Vater zurückführt oder ob man erklärt, sie seien eine Manifestation des Todestriebes oder das Ergebnis seines verletzten Narzissmus oder sie hätten noch andere Gründe. Freuds Revolution bestand darin, dass er uns den unbewussten Aspekt des menschlichen Denkens und die Energie erkennen ließ, die der Mensch darauf verwendet, das Bewusstwerden unerwünschter Begierden zu unterdrücken. Er zeigte, dass gute Absichten bedeutungslos sind, wenn sich hinter ihnen unbewusste Wünsche verstecken. Er entlarvte die „ehrliche“ [VII-073] Unehrlichkeit, indem er zeigte, dass es nicht genügt, bewusst „in guter Absicht“ zu handeln. Er war der erste Wissenschaftler, der die Tiefe, die Unterwelt im Menschen erforschte, und aus diesem Grund hatten seine Ideen einen so starken Einfluss auf Künstler und Schriftsteller zu einer Zeit, als die meisten Psychiater sich noch weigerten, seine Theorien ernst zu nehmen.
Aber Freud ging noch weiter. Er zeigte nicht nur, dass im Menschen Kräfte wirksam sind, deren er sich nicht bewusst ist, und dass er sich mit Rationalisierungen gegen deren Bewusstwerden schützt; er erklärte auch, dass diese unbewussten Kräfte in ein System integriert sind, dem er den Namen „Charakter“ in einem neuen, dynamischen Sinn gab.[65]
Freud begann diese Auffassung in seiner ersten Abhandlung über den „analen Charakter“ (S. Freud, 1908b) zu entwickeln. Gewisse Charakterzüge, wie Eigensinn, Ordnungsliebe und Sparsamkeit, traten, wie er ausführt, sehr oft gemeinsam als ein Syndrom von Charakterzügen auf. Außerdem waren – immer wenn dieses Syndrom vorhanden war – Besonderheiten bei der Erziehung des Kindes zur Sauberkeit, das heißt zur Beherrschung des Schließmuskels festzustellen und gewisse Verhaltensweisen zu beobachten, die mit der Kotentleerung in Beziehung standen. So bestand der erste Schritt Freuds darin, dass er ein Syndrom von Verhaltensweisen entdeckte und dass er diese mit der Art und Weise in Verbindung brachte, wie sich das Kind (teilweise als Reaktion auf die Anforderungen seiner Erzieher) bei der Stuhlentleerung verhielt. Sein brillanter und kreativer nächster Schritt war, dass er diese beiden Gruppen von Verhaltensmustern durch eine theoretische Erwägung zueinander in Beziehung brachte, wobei er sich auf eine frühere Annahme über die Entwicklung der Libido stützte. Diese Annahme lautete, dass in einer frühen Phase der Kindheitsentwicklung, nachdem der Mund aufgehört hat, das Hauptorgan der Lust und Befriedigung zu sein, der Anus zu einer wichtigen erogenen Zone wird und dass die meisten libidinösen Wünsche sich auf den Prozess der Zurückhaltung und Entleerung der Exkremente beziehen. Seine Schlussfolgerung war, das Syndrom der Verhaltensweisen als Sublimierung der libidinösen Befriedigung der Analität oder als Reaktionsbildung gegen ihre Versagung aufzufassen. Eigensinn und Sparsamkeit werden als Sublimierung der ursprünglichen Weigerung angesehen, auf die Lust zu verzichten, den Stuhl zurückzuhalten; peinliche Ordnungsliebe gilt als Reaktionsbildung gegenüber dem ursprünglichen Wunsch des Kindes, sich ganz nach eigenem Belieben zu entleeren. Freud hat gezeigt, dass diese drei ursprünglichen Merkmale des Syndroms, von denen man bis dahin angenommen hatte, sie seien völlig unabhängig voneinander, Teile einer Struktur oder eines Systems sind, da sie alle drei ihren Ursprung in der analen Libido haben, welche sich in diesen Charakterzügen ausdrückt, und zwar hauptsächlich als Reaktionsbildung oder [VII-074] Sublimierung. So konnte Freud erklären, wieso diese Charakterzüge mit Energie geladen sind und sich nur schwer ändern lassen.[66]
Eine der wichtigsten Ergänzungen war der Begriff des „oral-sadistischen“ Charakters (den ich als ausbeuterischen Charakter bezeichne). Es gibt noch weitere Begriffe der Charakterbildung, je nachdem, welche Aspekte man besonders hervorheben möchte: zum Beispiel den autoritären[67] (sado-masochistischen), den rebellischen und den revolutionären, den narzisstischen und den inzestuösen Charakter. Letztere Begriffe, die zum größten Teil nicht zum klassischen psychoanalytischen Gedankengut gehören, sind untereinander verwandt und überschneiden sich; durch ihre Kombination kann man zu einer noch vollständigeren Beschreibung eines bestimmten Charakters gelangen.
Freuds theoretische Erklärung der Charakterstruktur gründete sich darauf, dass die Libido (die orale, anale und genitale) die Quelle sei, welche die verschiedenen Charakterzüge mit Energie speist. Aber selbst wenn man von der Libidotheorie absieht, büßt seine Entdeckung nichts von ihrer Bedeutung für die klinische Beobachtung der Syndrome ein, und die Tatsache bleibt bestehen, dass sie aus einer gemeinsamen Energiequelle gespeist werden. Ich habe zu zeigen versucht, dass die Charaktersyndrome in bestimmten Formen der Bezogenheit des Individuums auf die Außenwelt und auf sich selbst wurzeln und von ihnen gespeist werden; ferner, dass – insofern die gesellschaftliche Gruppe eine gemeinsame Charakterstruktur aufweist (den „Gesellschafts-Charakter“) – die allen Mitgliedern der Gruppe gemeinsamen sozio-ökonomischen Bedingungen den Gesellschafts-Charakter formen (E. Fromm, 1932a; 1941a; 1947a; 1970a; 1980a; E. Fromm und M. Maccoby, 1970b).[68]
Der Begriff des Charakters ist deshalb von so außerordentlicher Wichtigkeit, weil er die alte Dichotomie von Trieb und Umwelt transzendiert. Der Sexualinstinkt in Freuds System wurde von ihm als sehr formbar angesehen, und zwar großenteils durch Einflüsse der Umwelt. So nahm man an, dass der Charakter das Ergebnis der Interaktion von Instinkt und Umwelt sei. Diese Auffassung war nur deshalb möglich, weil Freud alle Triebe unter einem einzigen, nämlich dem Sexualtrieb (neben dem Selbsterhaltungstrieb), subsumierte. Die vielen Triebe, die wir auf den Listen der älteren Trieb- und Instinktforscher finden, waren relativ starr fixiert, da jedes Verhaltensmotiv einem speziellen angeborenen Trieb zugeschrieben wurde. In Freuds Schema dagegen wurden die [VII-075] Unterschiede zwischen den verschiedenen Motivationskräften aus dem Einfluss der Umwelt auf die Libido erklärt. Paradoxerweise gab so die Erweiterung des Begriffs der Sexualität Freud die Möglichkeit, das Tor für die Einbeziehung der Umwelteinflüsse viel weiter zu öffnen, als dies für die Triebtheorie vor Freud möglich war. Liebe, Zärtlichkeit, Sadismus, Masochismus, Ehrgeiz, Neugier, Angst, Rivalität – diese und noch viele andere Triebe – wurden nicht länger einem speziellen Trieb zugeschrieben, sondern auf den Einfluss der Umgebung (besonders der signifikanten Personen der frühen Kindheit) via Libido zurückgeführt. Bewusst blieb Freud der Weltanschauung seiner Lehrer treu, doch ist er durch die Annahme eines Supertriebes über seinen eigenen instinktivistischen Standpunkt hinausgewachsen. Allerdings behinderte er seine Ideen dadurch, dass er die Libidotheorie so sehr in den Vordergrund rückte, immer noch stark, und es ist an der Zeit, diese Belastung durch die Trieblehre endlich ganz abzuschütteln. Worauf ich hier besonders hinweisen möchte, ist die Tatsache, dass sich Freuds „Trieblehre“ stark von der traditionellen Triebforschung unterscheidet.
Aus unserer Beschreibung geht bis jetzt hervor, dass „der Charakter das Verhalten bestimmt“, dass ein Charakterzug, ob er nun liebevoll oder destruktiv ist, den Menschen dazu treibt, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, und dass der Mensch sich befriedigt fühlt, wenn er sich seinem Charakter entsprechend verhält. Tatsächlich können wir aus dem betreffenden Charakterzug schließen, wie jemand sich gern verhalten möchte. Freilich ist als wichtige Qualifikation hinzuzufügen: wenn er könnte.
Was bedeutet dieses „wenn er könnte“?
Wir müssen hier noch einmal auf einen der grundlegendsten Begriffe Freuds zurückkommen, nämlich das „Realitätsprinzip“, das sich auf den Selbsterhaltungstrieb gründet, gegenüber dem „Lustprinzip“, das auf dem Sexualtrieb basiert. Ob wir vom Sexualtrieb oder von einer nicht-sexuellen Leidenschaft, in der ein bestimmter Charakterzug verwurzelt ist, getrieben werden, immer bleibt der Konflikt zwischen dem, was wir tun möchten, und den Anforderungen unseres Selbstinteresses von ausschlaggebender Bedeutung. Wir können uns nicht immer so verhalten, wie es uns unsere Leidenschaften eingeben, da wir unser Verhalten bis zu einem gewissen Grade modifizieren müssen, um am Leben zu bleiben. Der Durchschnittsmensch bemüht sich um einen Kompromiss zwischen dem, was er seinem Charakter entsprechend gerne tun möchte, und dem, was er tun muss, um nicht mehr oder weniger peinliche Konsequenzen auf sich nehmen zu müssen. Natürlich gibt es Gradunterschiede, wieweit jemand den Geboten seines Selbsterhaltungstriebes (seines Ichinteresses[69]) folgt. Beim einen Extrem ist das Gewicht der Ichinteressen gleich Null; dies gilt für den Märtyrer und den Typ des Mörders aus Fanatismus. Das andere Extrem bildet der „Opportunist“, dessen Selbstinteresse alles umfasst, was ihn erfolgreicher oder beliebter machen oder was seiner Bequemlichkeit förderlich sein könnte. Zwischen diesen beiden Extremen kann man alle Menschen einordnen, die durch eine spezifische Mischung von Selbstinteresse und im Charakter verwurzelten Leidenschaften gekennzeichnet sind. Wieweit jemand seine leidenschaftlichen Wünsche unterdrückt, hängt nicht nur von inneren Faktoren, sondern auch von der jeweiligen Situation ab; ändert sich die Situation, so werden verdrängte Wünsche bewusst und verschaffen sich Ausdruck. Dies gilt zum Beispiel für einen Menschen von sado-masochistischem Charakter. Wir alle kennen diesen Typ, der sich seinem Chef völlig unterordnet und seine Frau und seine Kinder [VII-076] sadistisch tyrannisiert. Ein anderer Fall, der hierher gehört, ist eine Charakteränderung, die eintritt, wenn die gesellschaftliche Gesamtsituation sich ändert. Der sadistische Charakter, der sich als unterwürfiger, ja sogar liebenswürdiger Mensch gegeben haben mag, kann in einer terroristischen Gesellschaft, in welcher der Sadismus nicht verurteilt, sondern geschätzt wird, zu einem wahren Teufel werden. Ein anderer kann seinen sadistischen Charakter in allen nach außen sichtbar werdenden Verhaltensweisen unterdrücken, doch wird dieser in gewissen Feinheiten seines Mienenspiels oder in scheinbar harmlosen Bemerkungen zum Ausdruck kommen.
Auch bei den edelsten Impulsen kann es zu einer Verdrängung von Charakterzügen kommen. Obwohl die Lehren Jesu noch immer zu unserer moralischen Ideologie gehören, wird ein Mensch, der sie befolgt, in der Regel als Narr oder „Neurotiker“ angesehen. Daher rationalisieren viele ihre Impulse der Nächstenliebe als vom Selbstinteresse motiviert.
Diese Erwägungen zeigen, dass die Motivationskraft von Charakterzügen in unterschiedlichem Grad vom Selbstinteresse beeinflusst wird. Sie zeigen ferner, dass in erster Linie der Charakter das menschliche Verhalten motiviert, jedoch durch die Anforderungen des Selbstinteresses unter unterschiedlichen Bedingungen eingeschränkt und modifiziert. Es ist die große Leistung Freuds, dass er die dem Verhalten zugrunde liegenden Charakterzüge nicht nur entdeckte, sondern dass er auch Mittel und Wege aufzeigte, wie man sie zum Beispiel mit Hilfe der Traumdeutung, der freien Assoziation und anhand von Fehlleistungen untersuchen kann.
Hier liegt der fundamentale Unterschied zwischen dem Behaviorismus und der psychoanalytischen Charakterologie. Die Konditionierung wirkt dadurch, dass sie an das Selbstinteresse appelliert, wie zum Beispiel an das Bedürfnis nach Nahrung, Sicherheit und Anerkennung und an die Vermeidung von Schmerz. Bei Tieren erweist sich dieses Selbstinteresse als so stark, dass sich bei wiederholten, in optimalen Abständen angewandten Belohnungen oder Strafen das Interesse an der Selbsterhaltung als stärker erweist als andere Instinkte wie Sexualität oder Aggression. Natürlich verhält sich auch der Mensch so, wie es seinem Selbstinteresse entspricht, doch tut er dies nicht immer und nicht notwendigerweise. Er handelt oft auch nach seinen Leidenschaften, seinen niedrigsten und seinen edelsten, und ist oft bereit – und fähig – sein Selbstinteresse, seinen Besitz, seine Freiheit und sein Leben für seine Liebe, für die Wahrheit und für seine Integrität – oder auch für seinen Hass, seine Gier, seinen Sadismus und seine Destruktivität – aufs Spiel zu setzen. Dieser Unterschied ist der Grund, weshalb die Konditionierung keine ausreichende Erklärung für das menschliche Verhalten ist.
Zusammenfassung
Epochemachend an Freuds Entdeckungen war, dass er den Schlüssel zum Verständnis des Systems von Kräften, welche das menschliche Charaktersystem ausmachen, sowie zu den in diesem System vorhandenen Widersprüchen gefunden hat. Die Entdeckung der unbewussten Prozesse und der dynamischen Charakterauflassung war radikal, weil sie bis zu den Wurzeln menschlichen Verhaltens vordrang. Sie war beunruhigend, weil fortan [VII-077] niemand sich mehr hinter seinen guten Absichten verstecken konnte; sie war gefährlich, weil die Gesellschaft bis in ihre Grundfesten erschüttert wurde, wenn jeder wissen würde, was er über sich und andere wissen könnte.
In dem Maße wie die Psychoanalyse erfolgreich und respektabel wurde, gab sie ihren radikalen Kern auf und legte den Nachdruck auf das, was allgemein akzeptabel war. Sie behielt den Teil des Unbewussten bei, auf den Freud den Nachdruck gelegt hatte, den Sexualtrieb. Die Konsumgesellschaft räumte mit vielen der viktorianischen Tabus auf (nicht durch den Einfluss der Psychoanalyse, sondern aus zahlreichen anderen Gründen, die sich aus ihrer Struktur ergaben). Man geriet nicht mehr außer Fassung, wenn man seine eigenen inzestuösen Wünsche, die „Kastrationsangst“ oder den „Penisneid“ entdeckte. Aber die Aufdeckung verdrängter Charaktereigenschaften wie Narzissmus, Sadismus, Streben nach Allmacht, Unterwürfigkeit, Entfremdung, Indifferenz, unbewussten Verrat an der eigenen Integrität, die illusorische Natur des Realitätsbegriffs, das alles in sich selbst, im Gesellschaftssystem, in Führern zu entdecken, das war „gesellschaftliches Dynamit“. Freud hat sich nur mit dem triebhaft gesteuerten Es befasst, er konnte sich in einer Zeit, die die menschliche Leidenschaft nur mit den Trieben zu erklären wusste, hiermit durchaus zufriedengeben. Aber was damals revolutionär war, ist heute konventionell. Anstatt die Triebtheorie als Hypothese anzusehen, die man in einer bestimmten Epoche brauchte, wurde sie zum Mittelpunkt und zur Zwangsjacke der orthodoxen psychoanalytischen Lehre. Auf diese Weise hemmte sie die weitere Entwicklung des Verständnisses für die menschlichen Leidenschaften, denen Freuds Hauptinteresse gehörte.
Aus diesem Grunde meine ich, dass die Klassifizierung der Psychoanalyse als Triebtheorie, die in einem formalen Sinne korrekt ist, nicht die Substanz der Psychoanalyse tatsächlich kennzeichnet. Die Psychoanalyse ist im wesentlichen eine Theorie der unbewussten Impulse, des Widerstandes, der Verfälschung der Realität je nach den eigenen subjektiven Bedürfnissen und Erwartungen („Übertragung“), des Charakters und der Konflikte zwischen leidenschaftlichen Wünschen, wie sie in den Charakterzügen verkörpert sind, und den Anforderungen der Selbsterhaltung. In diesem revidierten Sinn (der den Kern von Freuds Entdeckungen unangetastet lässt) bedient sich dieses Buch bei der Untersuchung des Problems der menschlichen Aggression und Destruktivität der psychoanalytischen Methode und nicht der Triebtheorie oder der behavioristischen Methode.
Eine wachsende Zahl von Psychoanalytikern gab inzwischen Freuds Libidotheorie auf, wenn sie sie auch oft nicht durch ein ebenso präzises und systematisches theoretisches System ersetzten; die „Triebe“, mit denen sie arbeiten, sind weder in der Physiologie, noch in den Bedingungen der menschlichen Existenz, noch in einer adäquaten Gesellschaftsauffassung genügend verankert. Oft bedient man sich etwas oberflächlicher Kategorien, die sich von den cultural patterns der amerikanischen Anthropologie kaum unterscheiden. (Ich denke dabei beispielsweise an Karen Horneys Begriff des „Konkurrenzbedürfnisses“.) Im Gegensatz dazu haben eine Anzahl von Psychoanalytikern – viele unter dem Einfluss von Adolf Meyer – Freuds Libidotheorie aufgegeben und eine neue Theorie entwickelt, die meiner Ansicht nach zu den vielversprechendsten und kreativsten Entwicklungen in der psychoanalytischen Theorie gehört. Hauptsächlich von der Untersuchung schizophrener Patienten ausgehend, gelangten sie zu einem immer tieferen Verständnis der unbewussten Prozesse in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Da sie durch die [VII-078] Libidotheorie – insbesondere hinsichtlich der Begriffe von Ich, Es und Überich – nicht länger in ihrer Bewegungsfreiheit gehemmt sind, können sie uneingeschränkt alles beschreiben, was sich in der Beziehung zwischen zwei Menschen und in einem jeden von ihnen in seiner Rolle als Partner abspielt. Zu den hervorragendsten Vertretern dieser Schule gehören – neben Adolf Meyer – Harry Stack Sullivan, Frieda Fromm-Reichmann und Theodore Lidz. Meiner Ansicht nach sind R. D. Laing die scharfsinnigsten Analysen gelungen, nicht nur deshalb, weil er radikal die persönlichen und subjektiven Faktoren untersucht, sondern auch, weil seine Analyse der gesellschaftlichen Situation ebenso radikal ist und frei von der unkritischen Akzeptierung unserer heutigen Gesellschaft als einer seelisch gesunden. Außer den bereits Genannten repräsentieren Namen wie Winnicott, Fairbairn, Balint und Guntrip die Entwicklung der Psychoanalyse von einer Theorie und Therapie der Triebfrustration und -kontrolle in eine „Theorie und Therapie, welche die Wiedergeburt und das Wachstum eines echten Selbst in einer echten Beziehung zum Ziel hat“. (H. Guntrip, 1971, S. 53). Ihnen gegenüber lassen die Arbeiten einiger „Existenzialisten“ wie L. Binswanger eine präzise Beschreibung der zwischenmenschlichen Prozesse vermissen, da sie genaue klinische Daten durch etwas vage philosophische Begriffe ersetzen.
Zweiter Teil
Befunde, die gegen die Thesen der Instinkt- und Triebforscher sprechen
5. Neurophysiologie
In den Kapiteln dieses Abschnitts soll gezeigt werden, dass die relevanten Daten auf dem Gebiet der Neurophysiologie, der Tier-Psychologie, der Paläontologie und der Anthropologie[70] die Hypothese nicht stützen, dass dem Menschen ein spontaner, sich selbst antreibender Aggressionstrieb angeboren sei.
Die Beziehung zwischen Psychologie und Neurophysiologie
Bevor wir in die Diskussion der neurophysiologischen Daten eintreten, sind ein paar Worte zur Beziehung zwischen der Psychologie, der Wissenschaft von der Seele, und der neurologischen Wissenschaft, der Wissenschaft vom Nervensystem, zu sagen.
Jede Wissenschaft besitzt ihren eigenen Forschungsgegenstand und ihre eigenen Methoden, und die Richtung, die sie einschlägt, wird durch die Anwendbarkeit ihrer Methoden auf ihre Daten bestimmt. Man kann nicht erwarten, dass der Neurophysiologe den Weg einschlägt, der vom Standpunkt des Psychologen aus als der wünschenswerteste erscheint, und umgekehrt. Doch kann man erwarten, dass beide Wissenschaften in engem Kontakt miteinander bleiben und sich gegenseitig unterstützen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn beide Seiten einige elementare Kenntnisse voneinander besitzen, die es ihnen zumindest ermöglichen, die Sprache des anderen zu verstehen und grundlegende Erkenntnisse zu beurteilen. Wenn die Forscher beider Wissensgebiete in so engem Kontakt miteinander stünden, würden sie finden, dass es Bereiche gibt, in denen die Erkenntnisse des einen zu denen des anderen in Beziehung gebracht werden können; dies trifft zum Beispiel für das Problem der defensiven Aggression zu.
In den meisten Fällen jedoch liegen die psychologischen und die neurophysiologischen Forschungen und ihr jeweiliger Bezugsrahmen weit auseinander, und der Neurologe ist gegenwärtig nicht in der Lage, den Wunsch des Psychologen nach Information über Probleme wie das neurophysiologische Äquivalent zu Leidenschaften wie Destruktivität, Sadismus, Masochismus oder Narzissmus zu erfüllen[71], und auch der Psychologe kann [VII-082] dem Neurophysiologen kaum weiterhelfen. Scheinbar ist es am besten, wenn jede Wissenschaft auf ihre Weise vorgeht und sich um die Lösung ihrer eigenen Probleme kümmert, bis beide – was zu vermuten ist – sich eines Tages so weit entwickelt haben, dass sie ein und dieselben Probleme mit ihren verschiedenen Methoden in Angriff nehmen und dann ihre Ergebnisse zueinander in Beziehung setzen. Sicher wäre es absurd, wenn jede Wissenschaft zuwarten wollte, bis die andere positive oder negative Belege für ihre Hypothesen erbracht hätte. Solange eine psychologische Theorie nicht durch klare neurophysiologische Belege widerlegt ist, braucht der Psychologe seinen Erkenntnissen nur das normale wissenschaftliche Misstrauen entgegenzubringen, wobei immer vorauszusetzen ist, dass sie sich auf eine adäquate Beobachtung und Interpretation der Daten gründen.
R. B. Livingston äußert sich folgendermaßen zu der Beziehung zwischen beiden Wissenschaften
Eine echte Verbindung zwischen Psychologie und Neurophysiologie wird zustande kommen, wenn eine große Anzahl von Wissenschaftlern in beiden Disziplinen beheimatet ist. Wie stabil und wie nützlich eine solche Verbindung sein wird, bleibt abzuwarten. Indessen sind neue Forschungsbereiche aufgetaucht, innerhalb derer Verhaltensforscher zusätzlich zu ihrer Untersuchung der Umwelt das Gehirn manipulieren und Hirnforscher sich die Vorstellungen und Methoden der Verhaltensforscher zunutze machen können. Vieles von den traditionellen ldentifizierungen beider Wissensbereiche ist verlorengegangen. Wir sollten uns bemühen, alle noch verbleibenden Provinzialismen und alle Empfindlichkeiten bezüglich des Zuständigkeitsbereiches sowie jede Rivalität zwischen beiden Disziplinen fallenzulassen. Gegen wen wehren wir uns? Doch nur gegen unsere eigene Unwissenheit.
Trotz der in jüngster Zeit erreichten Fortschritte stehen bis jetzt überall auf der Welt nur relativ wenig Mittel für die Grundlagenforschung in der Psychologie und Neurophysiologie zur Verfügung. Es gibt überwältigend viele Probleme, die zu lösen sind. Wir können nur zu einem größeren Verständnis gelangen, wenn wir unsere gegenwärtigen Konzeptionen ändern. Dies wiederum kann aber nur durch einfallsreiche experimentelle und theoretische Arbeit geschehen (R. B. Livingston, 1962).
Viele Leute sind der irrtümlichen Meinung, die gelegentlich von populärwissenschaftlichen Berichten hervorgerufen wird, die Neurophysiologen hätten für das Problem des menschlichen Verhaltens viele Antworten gefunden. Die meisten Forscher auf dem Gebiet der Neurologie stehen dagegen auf einem völlig anderen Standpunkt. T. H. Bullock, ein Experte auf dem Gebiet der Nervensysteme wirbelloser Tiere, elektrischer Fische und Meeressäugetiere, beginnt seine Abhandlung Evolution of Neurophysiological Mechanism (Die Entwicklung neurophysiologischer Mechanismen) „mit der Verneinung unserer Fähigkeit, im gegenwärtigen Augenblick Entscheidendes zur Lösung des tatsächlichen [VII-083] Problems beizutragen“, und stellt fest, dass wir „im Grunde kaum eine dunkle Ahnung von dem die Neuronen betreffenden Mechanismus des Lernprozesses, von dem physiologischen Substrat instinktiver Verhaltensweisen oder von irgendwelchen komplexen Verhaltensmanifestationen überhaupt haben“ (T. H. Bullock, 1961).[72]
Ähnlich stellt Birger Kaada fest:
Unser Wissen und unsere Vorstellungen von der Organisation des aggressiven Verhaltens im Zentralnervensystem sind dadurch begrenzt, dass die meisten unserer Informationen aus Tierexperimenten gewonnen wurden, weshalb wir fast nichts über die Beziehung des Zentralnervensystems zu den „gefühlsmäßigen“ oder „affektiven“ Aspekten der Emotionen wissen. Wir sind ausschließlich auf die Beobachtung und die experimentelle Analyse der Ausdrucks- und Verhaltensphänomene und die objektive Feststellung der peripheren körperlichen Veränderungen angewiesen. Offensichtlich sind auch diese Verfahren nicht zuverlässig, und es ist trotz ausgedehnter Untersuchungen schwer, Verhalten allein anhand dieser Anhaltspunkte zu interpretieren (B. Kaada, 1967, S. 95).
Einer der namhaftesten Neurologen, W. Penfield, kommt zum gleichen Schluss:
Wer das Problem der Neurophysiologie der Seele und des Geistes zu lösen hofft, ist wie jemand, der am Fuße eines Berges steht. Man steht in der Lichtung, die man im Vorgebirge gehauen hat, und blickt zum Berg hinauf, den man zu erklimmen hofft. Aber der Gipfel ist in ewigen Wolken verborgen, und viele sind der Ansicht, dass er nie erobert werden kann. Wenn freilich einmal der Tag dämmert, an dem der Mensch zu einem vollen Verständnis seines eigenen Gehirns und Geistes gelangt, so könnte dies seine größte Eroberung und seine endgültige Leistung sein. (...)
Für den Forscher gibt es bei seiner wissenschaftlichen Arbeit nur eine Methode: Die Beobachtung der Naturphänomene, der die vergleichende Analyse folgen muss, die durch Experimente auf Grund einer wohldurchdachten Hypothese zu ergänzen ist. Neurophysiologen, die sich an die Regeln der wissenschaftlichen Methode halten, werden – wenn sie aufrichtig sind – kaum behaupten, dass sie auf Grund ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit diese Fragen beantworten können (W. Penfield, 1960, S. 1441).[73] [VII-084]
Einige Neurologen haben sich mehr oder weniger pessimistisch über die Möglichkeit einer Annäherung von Neurologie und Psychologie im allgemeinen und zum Wert des Beitrages der heutigen Neurophysiologie zur Erklärung des menschlichen Verhaltens im besonderen geäußert. Diesen Pessimismus brachten H. von Foerster und T. Melnechuk[74], H. R. Maturana und F. C. Varela (1972) zum Ausdruck. Kritisch äußert sich auch F. G. Worden, wenn er schreibt: „Es werden Beispiele aus der neurologischen Forschung angeführt, um zu illustrieren, wie man nach besseren Begriffssystemen sucht in dem Maße, wie einzelne Forscher sich allmählich direkter mit den Bewusstseinsphänomenen beschäftigen und wie Ihnen die Unzulänglichkeiten der klassischen materialistischen Doktrin immer hinderlicher werden“ (F. G. Worden, 1975, S. 209).[75] Aus einer Anzahl mündlicher und schriftlicher Mitteilungen von Neurologen habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese nüchterne Auffassung von immer mehr Forschern geteilt wird. Das Gehirn wird mehr und mehr als ein Ganzes verstanden, als ein System, so dass Verhalten nicht erklärt werden kann, indem man auf einzelne Gehirnpartien verweist. Eindrucksvolle Daten, die diese Ansicht stützen, hat E. Valenstein (1968) beigesteuert, der zeigte, dass die angeblichen hypothalamischen „Zentren“ für Hunger, Durst, Sexualität usw., wenn sie überhaupt existieren, nicht so rein vorhanden sind, wie man einmal angenommen hat – dass die Stimulation eines „Zentrums“ für ein bestimmtes Verhalten ein Verhalten auslösen kann, das einem anderen Zentrum zugehörig ist, vorausgesetzt, dass die Umgebung Reize liefert, die mit dem zweiten Zentrum im Einklang stehen. D. Ploog (1970) zeigte, dass die „Aggression“ (genauer gesagt die nichtverbale Kommunikation einer Drohung) eines Totenkopfäffchens von einem anderen Affen nicht ernst genommen wird, wenn die Drohung von einem Affen ausgeht, der sozial unter dem zweiten Affen steht. Diese Tatsachen befinden sich in Übereinstimmung mit der holistischen Ansicht, dass das Gehirn bei seiner Überlegung, welcher Befehl bezüglich des Verhaltens auszugeben ist, nicht nur einen Strang der eintreffenden Stimulation berücksichtigt, sondern dass der Gesamtzustand der augenblicklichen physischen und sozialen Umgebung die Bedeutung des spezifischen Reizes modifiziert.
Freilich bedeutet dieser Skeptizismus hinsichtlich der Fähigkeit der Neurophysiologie, menschliches Verhalten adäquat zu erklären, nicht, dass damit die relative Gültigkeit vieler experimenteller Entdeckungen im Verlauf der letzten Jahrzehnte bestritten wird. Diese Entdeckungen sind gültig genug, um uns wichtige Hinweise zum Verständnis einer bestimmten Art der Aggression, nämlich der defensiven Aggression, zu liefern, wenn sie auch neu formuliert und in eine umfassendere Struktur integriert werden könnten. [VII-085]
Das Gehirn als Grundlage für aggressives Verhalten
Die Erforschung der Beziehung zwischen Gehirnfunktionen und Verhalten wurde weitgehend durch Darwins These bestimmt, dass die Struktur und die Funktion des Gehirns vom Prinzip der Erhaltung des Individuums und der Art geprägt werden.[76]
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959120333
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (März)
- Schlagworte
- Aggression Aggressivität Zerstörung Nekrophilie Humanismus Stalin Hitler