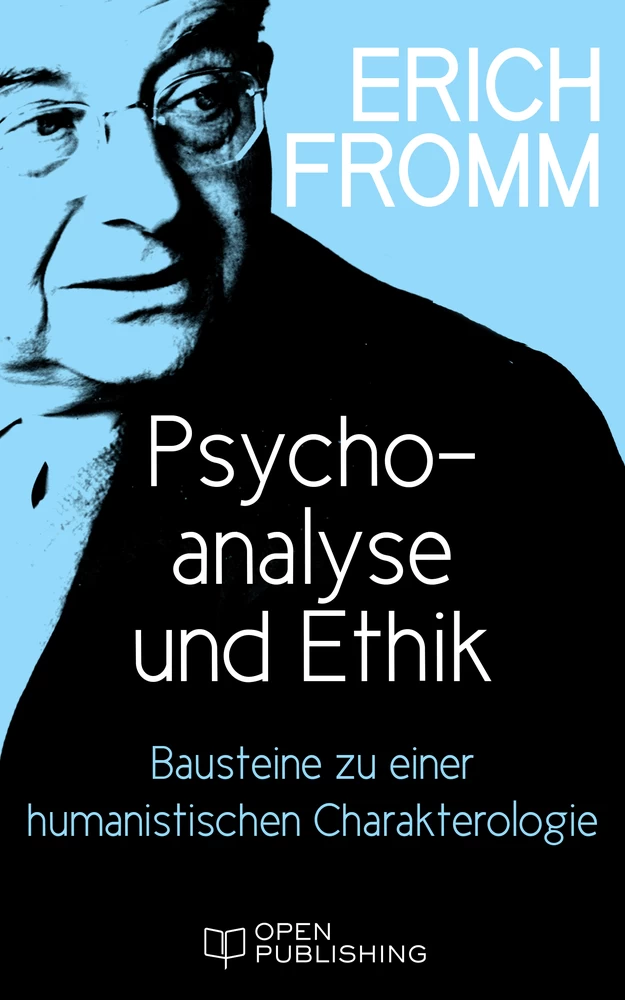Zusammenfassung
Im zentralen Kapitel 3 arbeitet Fromm die einzelnen Charakter-Orientierungen heraus und bewertet sie hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die psychische Entfaltung des Menschen als produktiv bzw. nicht-produktiv.
Im zweiten Teil behandelt Fromm ethische Fragen, die sich aus seiner psychoanalytischen Sicht des Menschen ergeben. Er zeigt, dass Selbstliebe die Voraussetzung für Nächstenliebe und das pure Gegenteil von Selbstsucht ist; dass das Gewissen nicht mit dem Freudschen Über-Ich identisch ist; was Lust ist und was sie nicht ist und was sie mit Glück und Freude zu tun hat; dass die Fähigkeit zu glauben vom Charakter abhängt und dass der Mensch weder gut noch böse ist, jedoch die Fähigkeit zu beidem hat.
Für Fromm gibt es ein dem Menschen tief inne-wohnendes Streben nach Glück und Gesundheit, eine primäre Tendenz zu Wachstum und produktiver Orientierung. Das ganze Buch ist eine Art Bekenntnisschrift des Frommschen Humanismus. Es handelt vom Glauben, dass der Mensch selbst das Maß und das Ziel ist und auf Grund seiner Anlagen sein kann. Und es zeigt die psychologischen Voraussetzung für eine "Kunst des Lebens" auf, bei der "der Mensch sowohl der Künstler als auch der Gegenstand seiner Kunst" ist.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Psychoanalyse und Ethik Bausteine zu einer humanistischen Charakterologie
- Inhalt
- Vorwort
- 1. Die Fragestellung
- 2. Humanistische Ethik als angewandte Wissenschaft der Kunst des Lebens
- a) Humanistische Ethik im Gegensatz zu autoritärer Ethik
- b) Subjektivistische Ethik im Gegensatz zu objektivistischer Ethik
- c) Die Wissenschaft vom Menschen[10]
- d) Die Tradition der humanistischen Ethik
- e) Ethik und Psychoanalyse
- 3. Die Natur des Menschen und sein Charakter
- a) Die Situation des Menschen
- 1. Die biologische Schwäche des Menschen
- 2. Die existenziellen und historischen Dichotomien im Menschen
- b) Die Persönlichkeit
- 1. Das Temperament
- 2. Der Charakter
- 4. Probleme der humanistischen Ethik
- a) Selbstsucht, Selbstliebe, Selbstinteresse
- b) Das Gewissen – der Ruf des Menschen zu sich selbst
- 1. Das autoritäre Gewissen
- 2. Das humanistische Gewissen
- c) Lust und Glück
- 1. Lust als Wertmaßstab
- 2. Formen der Lust
- 3. Das Problem von Mittel und Zweck
- d) Glaube als Charakterzug
- e) Die sittlichen Kräfte im Menschen
- 1. Ist der Mensch gut oder böse?
- 2. Verdrängung und Produktivität
- 3. Charakter und moralische Beurteilung
- f) Absolute Ethik im Gegensatz zur relativen Ethik, universale Ethik im Gegensatz zur gesellschaftsimmanenten Ethik
- 5. Das ethische Problem der Gegenwart
- Hinweise zur Übersetzung
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
Seid euer eignes Licht.
Seid eure eigne Zuversicht.
Haltet euch an die Wahrheit in euch selbst
als das einzige Licht.
Buddha
Wahre Worte erscheinen immer widersinnig,
doch sind sie durch keine andere Lehrweise zu ersetzen.
Laotse
Wer sind die wahren Philosophen?
Die das Bild der Wahrheit lieben.
Platon
Mein Volk ist dahin,
darum dass es nicht lernen will.
Denn du verwirfest Gottes Wort,
darum will ich dich auch verwerfen.
Hosea
Wenn nun auch der Weg,
der, wie ich gezeigt habe, hierhin führt,
äußerst schwierig zu sein scheint,
lässt er sich doch finden.
Schwierig freilich muss sein,
was so selten erreicht wird.
Denn wie wäre es möglich,
wenn das Heil so zur Hand wäre
und ohne große Anstrengung
gefunden werden könnte,
dass fast alle es unbeachtet lassen?
Nein, alles Erhabene ist ebenso schwer wie selten.
Spinoza
Vorwort
Das vorliegende Buch[1] ist in mancher Hinsicht eine Fortsetzung von Die Furcht vor der Freiheit (1941a). Wollte ich dort die Furcht des modernen Menschen vor sich selbst und vor der Freiheit analysieren, so erörtere ich hier das Problem der Ethik, der Normen und jener Werte, die dem Menschen zur Verwirklichung seines Selbst und seiner Möglichkeiten verhelfen sollen. Es ist unvermeidbar, dass einige Gedankengänge wiederkehren, die ich bereits in Die Furcht vor der Freiheit (1941a) entwickelt habe. Wiederholungen suchte ich so weit wie möglich zu verkürzen, ganz umgehen ließen sie sich nicht. In dem Kapitel Die Natur des Menschen und sein Charakter behandle ich charakterologische Fragen allgemeiner Art, die in dem vorhergehenden Buch noch nicht berührt wurden, und ich beziehe mich nur kurz auf die dort erörterten Probleme. Der Leser, der von meiner Charakterologie einen umfassenden Eindruck gewinnen will, müsste zweckmäßigerweise beide Bücher kennen. Unbedingt notwendig ist dies zum Verständnis der vorliegenden Arbeit jedoch nicht.
Dass ein Psychoanalytiker sich mit Problemen der Ethik beschäftigt, wird manchen überraschen. Noch überraschender ist sein Standpunkt, die Psychologie habe nicht nur die Pflicht, falsche ethische Urteile zu demaskieren, sondern sie könne auch bei der Aufstellung objektiver und gültiger Normen der Lebensführung als Grundlage dienen. Eine solche Auffassung steht im Widerspruch zur derzeit vorherrschenden Psychologie, die mehr auf „Anpassung“ ausgerichtet ist als auf die Frage nach dem „Guten“ und die deshalb zum ethischen Relativismus neigt. Die Erfahrungen meiner psychoanalytischen Praxis haben mich darin bestärkt, dass Probleme der Ethik bei der Erforschung der Persönlichkeit nicht ausgeschlossen werden dürfen. Das ist weder theoretisch noch bei der therapeutischen Behandlung möglich. Denn Werturteile, die wir fällen, bestimmen unsere Handlungen. Von ihrer Gültigkeit hängen Glück und seelische Gesundheit ab. Betrachten wir dagegen Werturteile nur als Rationalisierungen unserer unbewussten, irrationalen Wünsche – das können sie auch sein –, so würde dies unser Bild von der Gesamtpersönlichkeit einengen und verzerren. Letzten Endes ist die Neurose als solche Symptom eines moralischen Versagens (obwohl „Anpassung“ keinesfalls schon ein Zeichen für moralische Leistung ist). In vielen Fällen ist ein neurotisches Symptom die spezifische Erscheinungsform eines [II-004] moralischen Konflikts. Der Erfolg der therapeutischen Bemühung hängt davon ab, ob das moralische Problem erkannt und gelöst wird.
Die Trennung von Psychologie und Ethik ist vergleichsweise jung. Die großen humanistischen Ethiker der Vergangenheit, auf deren Werke sich dieses Buch stützt, waren Philosophen und Psychologen zugleich. Nach ihrer Auffassung ist ein Verstehen der menschlichen Natur und der für das menschliche Leben gültigen Werte und Normen unlösbar miteinander verbunden. Obwohl Freud und seine Schule für den Fortschritt des ethischen Denkens einen unschätzbaren Beitrag leisteten, indem sie irrationale Werturteile demaskierten, nahmen sie doch den Werten gegenüber einen relativistischen Standpunkt ein, was nicht nur für die Entwicklung der ethischen Theorie, sondern auch für den Fortschritt der Psychologie selbst einen negativen Effekt hatte.
Die wichtigste Ausnahme innerhalb dieses Trends der Psychoanalyse war C. G. Jung. Er erkannte die enge Verwandtschaft von Psychologie und Psychotherapie mit den philosophischen und ethischen Problemen des Menschen. Aber so wichtig Jungs Erkenntnis auch ist, so führte seine philosophische Orientierung doch nur zu einer Reaktion gegen Freud, nicht zu einer philosophisch orientierten Psychologie, die über Freud hinausgeht. Für Jung wurden das „Unbewusste“ und der Mythos zu neuen Quellen der Offenbarung, die ihres irrationalen Ursprungs wegen angeblich dem rationalen Denken überlegen sein sollen. Die Stärke der monotheistischen westlichen Religionen wie die der großen Religionen Indiens und Chinas beruhte darauf, dass sie die Wahrheit suchten und gleichzeitig den Anspruch erhoben, im Besitz des wahren Glaubens zu sein. Verursachte diese Überzeugung oft auch fanatische Intoleranz gegen andere Religionen, so flößte sie zugleich Anhängern wie Gegnern gleichermaßen Ehrfurcht vor der Wahrheit ein. In seiner eklektischen Bewunderung für jede Religion hat Jung diese Suche nach der Wahrheit in seiner Theorie aufgegeben. Jedes System, vorausgesetzt, es ist nicht-rational, jeder Mythos oder jedes Symbol ist ihm gleichwertig. Hinsichtlich der Religion ist er ein Relativist. Er bekämpft nicht den Relativismus als solchen, er negiert einen rationalen Relativismus. Dieser Irrationalismus ist kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt, gleichgültig, ob er sich in psychologische, philosophische, rassische oder politische Begriffe kleidet. Der Rationalismus des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts versagte ja nicht wegen seines Vernunftglaubens, sondern wegen der Enge seiner Vorstellungen. Nicht weniger, sondern mehr Vernunft und ein unermüdliches Suchen nach der Wahrheit kann die Irrtümer eines einseitigen Rationalismus korrigieren, nicht aber ein pseudo-religiöser Obskurantismus.
Die Psychologie kann weder von der Philosophie und der Ethik noch von der Soziologie und den Wirtschaftswissenschaften getrennt werden. Die Tatsache, dass ich in diesem Buch die philosophischen Probleme der Psychologie betone, bedeutet nicht, dass ich zu der Überzeugung gekommen bin, die sozio-ökonomischen Faktoren seien weniger wichtig. Dieses einseitige Gewicht erklärt sich aus Gründen der Darstellung, und ich hoffe, einen weiteren Band zur Sozialpsychologie zu veröffentlichen, der sich mit der Wechselwirkung zwischen psychischen und sozio-ökonomischen Faktoren beschäftigen wird.[2]
Es könnte den Anschein haben, als ob der Psychoanalytiker, der die Zähigkeit und [II-005] Hartnäckigkeit irrationaler Strebungen beobachtet, pessimistisch sein müsste hinsichtlich der Fähigkeit des Menschen, sein eigener Herr zu sein und sich selbst aus den Fesseln irrationaler Leidenschaften zu befreien. Ich muss gestehen, dass ich im Verlauf meiner analytischen Arbeit in immer stärkerem Maße vom Gegenteil beeindruckt wurde, nämlich von der Stärke des Strebens nach Glück und nach Gesundheit, das zur Natur des Menschen gehört. „Heilen“ bedeutet nichts anderes, als die Widerstände aus dem Weg zu räumen, die verhindern, dass diese Strebungen wirksam werden können. In Wirklichkeit sollte man sich weniger darüber wundern, dass es so viele neurotische Menschen gibt, als über die Tatsache, dass die meisten Menschen trotz ungünstiger Einflüsse relativ gesund sind.
Eine Warnung scheint angebracht zu sein. Viele Menschen erwarten heute, in einem Buch über Psychologie Rezepte zu finden, wie man „Glück“ oder „Seelenfrieden“ erreichen könne. Dieses Buch enthält keine derartigen Anweisungen. Es ist ein theoretischer Versuch, das Problem von Ethik und Psychologie zu klären. Sein Ziel ist, den Leser in Frage zu stellen, nicht aber ihn zu beruhigen.
Wie sehr ich mich allen Freunden, Kollegen und Studenten verpflichtet fühle, die dieses Buch durch Ermunterung und Anregungen förderten, kann ich nur unvollkommen ausdrücken. Ich möchte denen meinen besonderen Dank aussprechen, die unmittelbar zur Vollendung dieses Buches beigetragen haben. Von unschätzbarem Wert war Patrick Mullahys Mitwirkung. Im Zusammenhang mit den hier erörterten philosophischen Fragen steuerten er und Dr. Alfred Seidemann wertvolle Anregungen und kritische Einwände bei. Professor David Riesman fühle ich mich für manche konstruktiven Vorschläge zutiefst verpflichtet, ebenso Donald Slesinger; der die Lesbarkeit des Manuskripts wesentlich verbesserte. Am meisten danke ich meiner Frau. Sie half bei der Durchsicht des Manuskripts und gab wichtige Hinweise für die Gliederung und den Inhalt des Buches; die Konzeption der positiven und negativen Aspekte der nicht-produktiven Orientierung verdankt viel ihren Anregungen.[3]
1. Die Fragestellung
Denn die Seele nährt sich doch wohl von Kenntnissen, sprach ich. Dass also nur nicht der Sophist uns betrüge, was er verkauft uns anpreisend, wie Kaufleute und Krämer mit den Nahrungsmitteln für den Körper tun. Denn auch diese verstehen selbst nicht, was wohl von den Waren, welche sie führen, dem Körper heilsam oder schädlich ist, loben aber alles, wenn sie es feil haben; noch auch verstehen es die, welche von ihnen kaufen, wenn nicht einer etwa ein Arzt ist oder ein Vorsteher der Leibesübungen. Ebenso auch die, welche mit Kenntnissen in den Städten umherziehn und jedem, der Lust hat, davon verkaufen und verhökern, loben freilich alles, was sie feil haben; vielleicht aber, mein Bester, mag auch unter ihnen so mancher nicht wissen, was wohl von seinen Waren heilsam oder schädlich ist für die Seele, und ebenso wenig wissen es die, welche von ihnen kaufen, wenn nicht etwa einer darunter in Beziehung auf die Seele ein Heilkundiger ist. Verstehst du dich nun darauf, was hievon heilsam oder schädlich ist, so kannst du unbedenklich Kenntnisse kaufen vom Protagoras sowohl als von jedem andern; wo aber nicht, so sieh wohl zu, du Guter, dass du nicht um dein Teuerstes würfelnd ein gefährliches Spiel machst. Denn überdies ist noch weit größere Gefahr beim Einkauf der Kenntnisse als bei dem der Speisen.
(Platon, Protagoras, übersetzt von Friedrich Schleiermacher)
Stolz und Optimismus kennzeichnen den Geist der westlichen Zivilisation in den letzten Jahrhunderten: Es ist der Stolz auf die Vernunft als das Instrument, mit dessen Hilfe der Mensch die Natur versteht und beherrscht; es ist der Optimismus, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl zu finden und damit die kühnsten Hoffnungen der Menschheit zu erfüllen.
Dieser Stolz des Menschen ist berechtigt. Kraft seiner Vernunft hat er eine materielle Welt aufgebaut, deren Wirklichkeit sogar die Träume und Visionen von Märchen und Utopien übersteigt. Er weiß Kräfte und Natur zu nutzen, die es der Menschheit [II-007] ermöglichen, die für ein würdiges und produktives Dasein unerlässlichen materiellen Voraussetzungen zu schaffen. Wenn von seinen Zielen auch viele noch nicht erreicht sind, so kann doch kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass sie realisierbar sind und dass das Problem der Produktion – das Problem der Vergangenheit – im Prinzip gelöst ist. Zum ersten Mal in seiner Geschichte vermag der Mensch jetzt wahrzunehmen, dass die Idee von der Einheit der menschlichen Rasse und der Eroberung der Natur im Dienste des Menschen nicht mehr länger ein Traum, sondern reale Möglichkeit ist. Hat er nicht allen Grund, darauf stolz zu sein und zu sich selbst und zur Zukunft der Menschheit Vertrauen zu haben?
Und doch fühlt sich der heutige Mensch unwohl und verunsichert. Er arbeitet und müht sich ab und verspürt doch ein Gefühl der Sinnlosigkeit bei all seinem Tun. Während seine Macht über die Materie immer größer wird, fühlt er sich in seinem individuellen Leben und in der Gesellschaft ohnmächtig. Während er neue und bessere Mittel zur Beherrschung der Natur erfindet, hat er sich in das Netz dieser Mittel verstrickt und den Blick auf das Ziel verloren, das allein diesen Mitteln Sinn geben kann: den Menschen. Aber während der Mensch sich zum Herrn der Natur machte, wurde er zum Sklaven der von ihm selbst geschaffenen Maschine. Trotz all seines Wissens um die Materie ist er in den wichtigsten und grundlegenden Fragen der menschlichen Existenz unwissend: was der Mensch ist, wie er leben soll und wie er die in ihm schlummernden gewaltigen Kräfte freilegen und produktiv einsetzen kann.
Die gegenwärtige Krise der Menschheit hat zu einer Abkehr von den Hoffnungen und Ideen der Aufklärung geführt, unter deren Schirmherrschaft unser politischer und ökonomischer Fortschritt begann. Der Fortschrittsgedanke selbst wird als kindische Illusion abgetan. Stattdessen predigt man „Realismus“, doch dies ist nur ein neues Wort dafür, dass jeglicher Glaube an den Menschen fehlt. Die Idee von der Würde und der Macht des Menschen, die ihm die Kraft und den Mut zu den gewaltigen Errungenschaften der letzten Jahrhunderte gab, ist durch die Annahme in Frage gestellt worden, dass der Mensch sich wieder damit abfinden müsse, im Letzten doch ohnmächtig und bedeutungslos zu sein. Dieser Gedanke droht sogar die Wurzeln zu zerstören, aus denen unsere Kultur gewachsen ist.
Die Ideen der Aufklärung lehrten den Menschen, dass er seiner eigenen Vernunft als Führer vertrauen könne, wenn er gültige ethische Normen aufstelle, und dass er sich auf sich selbst verlassen könne und weder einer Offenbarung noch der Autorität der Kirche bedürfe, wenn er wissen wolle, was gut und was böse sei. Das Motto der Aufklärung, sapere aude, was soviel heißt wie „habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ (Kant), wurde zur treibenden Kraft für alle Anstrengungen und Errungenschaften des modernen Menschen. Der wachsende Zweifel an der menschlichen Vernunft und Autonomie schuf jedoch einen Zustand moralischer Verwirrung, in dem der Mensch sowohl der Führung durch die Offenbarung als auch der Führung durch die Vernunft beraubt ist. Das Ergebnis ist die Einnahme eines relativistischen Standpunktes. Man behauptet, Werturteile und ethische Normen seien ausschließlich Angelegenheit des Geschmacks oder willkürliche Bevorzugungen, und deshalb könne man keine objektiv gültigen Aussagen machen. Doch ohne Werte und Normen vermag der Mensch nicht zu leben und fällt durch einen solchen Relativismus leicht [II-008] irrationalen Wertsystemen zum Opfer. Er wird auf einen Ausgangspunkt zurückgeworfen, den die griechische Aufklärung, das Christentum, die Renaissance und die Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts bereits überwunden hatten. Die Forderungen des Staates, die Begeisterung für magische Eigenschaften mächtiger Führer, gewaltige Maschinen sowie materieller Erfolg sind die Quellen, aus denen der Mensch seine Normen und Werturteile schöpft. Sollen wir es dabei bewenden lassen? Sollen wir anerkennen, dass es nur diese eine Alternative zwischen Religion und Relativismus gibt? Sollen wir die Abdankung der Vernunft in Fragen der Ethik akzeptieren? Müssen wir glauben, die Entscheidung zwischen Freiheit und Sklaverei, Liebe und Hass, Wahrheit und Lüge, Integrität und Opportunismus, Leben und Tod sei nichts anderes als das Ergebnis irgendwelcher subjektiver Bevorzugungen? Es gibt eine Alternative. Gültige ethische Normen können von der menschlichen Vernunft, und zwar von ihr allein, aufgestellt werden. Der Mensch hat die Fähigkeit zu unterscheiden und Werturteile zu entwickeln, die genauso gültig sind wie alle anderen Urteile, die sich aus der Vernunft herleiten. Die große Tradition des humanistischen ethischen Denkens hat die Grundlage für Wertsysteme geschaffen, die auf der menschlichen Autonomie und Vernunft beruhen. Alle diese Systeme gingen von der Voraussetzung aus, man müsse die Natur des Menschen kennen, um zu wissen, was für ihn gut oder schlecht sei. Sie waren deshalb grundsätzlich auch psychologische Untersuchungen.
Wenn die humanistische Ethik auf der Erkenntnis der Natur des Menschen aufbaut, dann hätte die moderne Psychologie, insbesondere die Psychoanalyse, zu einem der stärksten Antriebe für die Entwicklung der humanistischen Ethik werden müssen. Während die Psychoanalyse zwar unser Wissen vom Menschen gewaltig bereicherte, hat sie dennoch unser Wissen darüber, wie wir leben und was wir tun sollen, um keinen Schritt weitergebracht. Ihre hauptsächliche Aufgabe bestand in der „Entlarvung“, im Aufweis, dass Werturteile und ethische Normen Rationalisierungen von irrationalen – und oft unbewussten – Wünschen und Ängsten sind, und dass sie deshalb keine objektive Gültigkeit beanspruchen können. War diese Desillusionierung an sich recht wertvoll, so wurde sie doch immer unfruchtbarer, je weniger es gelang, über die reine Kritik hinauszugehen.
Bei dem Versuch, Psychologie in eine Naturwissenschaft umzuwandeln, beging die Psychoanalyse den Fehler, die Psychologie von den Problemen der Philosophie und der Ethik loszulösen. Sie ignorierte die Tatsache, dass die Persönlichkeit des Menschen nicht verstanden werden kann, es sei denn, wir betrachten den Menschen in seiner Totalität, und dies bedeutet, dass er eine Antwort auf die Sinnfrage seiner Existenz braucht und dass er Normen entdecken muss, denen gemäß er leben soll. Freuds homo psychologicus ist eine ebenso wirklichkeitsfremde Konstruktion wie der homo oeconomicus der klassischen Nationalökonomie. Es ist unmöglich, den Menschen mit all seinen emotionalen und psychischen Störungen zu verstehen, wenn man sich nicht über das Wesen von Werten und moralischen Konflikten im Klaren ist. Der Fortschritt der Psychologie ist nicht in der Trennung eines vermeintlichen natürlichen Bereichs von einem vermeintlichen geistigen Bereich zu suchen, auch nicht in der Konzentrierung der Aufmerksamkeit auf den ersteren, sondern in der Rückkehr zu [II-009] der großen Tradition der humanistischen Ethik. Diese betrachtet den Menschen in seiner physisch-geistigen Totalität und vertritt die Auffassung, es sei die Bestimmung des Menschen, er selbst zu sein, und die Voraussetzung dafür sei, dass der Mensch Selbstzweck sein kann (man for himself).
Ich habe dieses Buch in der Absicht geschrieben, die Gültigkeit der humanistischen Ethik erneut unter Beweis zu stellen, indem ich zeige, dass unsere Kenntnis der Natur des Menschen nicht zu einem ethischen Relativismus führt, sondern im Gegenteil zu der Überzeugung, dass die Quellen der Normen für eine sittliche Lebensführung in der Natur des Menschen selbst zu finden sind.[4] Ich versuche aufzuzeigen, dass ethische Normen in Qualitäten gründen, die dem Menschen innewohnen, und dass ihre Verletzung psychische und emotionale Desintegration zur Folge hat. Ich werde zu zeigen versuchen, dass die Charakterstruktur der reifen und integrierten Persönlichkeit, der produktive Charakter, der Ursprung und die Grundlage der „Tugend“ ist und dass „Laster“ letztlich Gleichgültigkeit gegen das eigene Selbst und deshalb Selbst-Verstümmelung ist. Die höchsten Werte der humanistischen Ethik sind nicht Selbstaufgabe oder Selbstsucht, sondern Selbst-Liebe, nicht die Verleugnung des individuellen Selbst, sondern die Bejahung des wahrhaft menschlichen Selbst. Soll der Mensch Vertrauen in Werte haben, dann muss er sich selbst und die Fähigkeit seiner Natur zum Guten und zur Produktivität kennen.
2. Humanistische Ethik als angewandte Wissenschaft der Kunst des Lebens
Sussja betete einst zu Gott: „Herr, ich liebe dich so sehr, und ich fürchte dich nicht genug! Herr, ich liebe dich so sehr, und ich fürchte dich nicht genug! Mache, dass ich dich fürchte wie einer deiner Engel, die dein furchtbarer Name durchfährt!“
Alsbald erhörte Gott das Gebet, und der Name durchfuhr dem Sussja das verborgene Herz, wie es den Engeln geschieht. Da kroch Sussja unter das Bett wie ein Hündchen, und die Angst des Tieres erschütterte ihn, bis er aufheulte: „Herr, lass mich dich wieder lieben wie Sussja!“
Und Gott erhörte ihn zum andernmal.
(Chassidische Legende, in: N. N. Glatzer, 1946, S. 62)
a) Humanistische Ethik im Gegensatz zu autoritärer Ethik
Wenn wir nicht wie der ethische Relativismus darauf verzichten wollen, nach objektiv gültigen Normen der Lebensführung zu suchen, welche Kriterien können wir dann für derartige Normen finden? Die Art der Kriterien hängt vom Typus des ethischen Systems ab, dessen Normen wir untersuchen. Notwendigerweise sind die Kriterien in einer autoritären Ethik grundsätzlich verschieden von denen in einer humanistischen Ethik. In einer autoritären Ethik bestimmt eine Autorität, was für den Menschen gut ist, und stellt die Gesetze und Normen der Lebensführung auf; in einer humanistischen Ethik gibt sich der Mensch seine Norm selbst und unterwirft sich ihr aus eigenem Willen. Er ist Ursache, Gestalter und Gegenstand der Norm.[5]
Die Verwendung des Ausdrucks „autoritär“ fordert eine Klärung des Begriffes Autorität.[6] In Bezug auf diesen Begriff herrscht eine derartige Verwirrung, dass weithin die Auffassung gilt, es existiere nur die Alternative zwischen diktatorischer, irrationaler Autorität und dem völligen Fehlen jeglicher Autorität. Diese Alternative ist jedoch falsch. Das eigentliche Problem besteht darin, von welcher Art die Autorität ist. Wenn wir von Autorität sprechen, meinen wir dann rationale oder irrationale [II-011] Autorität? Rationale Autorität hat ihren Ursprung in Kompetenz. Der Mensch, dessen Autorität respektiert wird, handelt kompetent in dem ihm zugewiesenen Bereich, den ihm andere anvertraut haben. Er braucht weder einzuschüchtern, noch muss er durch magische Eigenschaften Bewunderung erregen. Solange und in dem Maße, in dem er kompetente Hilfe leistet, anstatt auszubeuten, beruht seine Autorität auf rationalen Grundlagen und braucht keinerlei irrationale Furcht. Rationale Autorität lässt nicht nur ständige Prüfung und Kritik seitens derer zu, die ihr unterworfen sind, sondern fordert diese geradezu heraus.
Rationale Autorität ist immer zeitlich begrenzt. Ihre Anerkennung ist davon abhängig, wie die Aufgabe erfüllt wird. Irrationale Autorität dagegen hat ihren Ursprung stets in der Macht über Menschen. Diese Macht kann eine physische oder eine psychische sein, sie kann tatsächlich vorhanden sein oder aber in der Angst und Hilflosigkeit des Menschen, der sich dieser Autorität unterwirft, ihren Grund haben. Macht auf der einen, Furcht auf der anderen Seite, das sind stets die Stützen irrationaler Autorität. Kritik an dieser Art von Autorität ist nicht nur nicht erwünscht, sondern verboten. Rationale Autorität beruht auf der Gleichheit desjenigen, der die Autorität besitzt und dessen, der sich ihr unterstellt. Beide unterscheiden sich lediglich im Grad des Wissens oder in der Befähigung auf einem bestimmten Gebiet. Irrationale Autorität beruht ihrer Natur nach auf Ungleichheit und das heißt gleichzeitig, auf einem Wertunterschied. Der Begriff „autoritäre Ethik“ bezieht sich immer auf irrationale Autorität, gemäß dem herkömmlichen Sprachgebrauch des Wortes „autoritär“ als einem Synonym für totalitär und antidemokratisch. Der Leser wird bald erkennen, dass humanistische Ethik und rationale Autorität durchaus vereinbar sind.
Autoritäre Ethik unterscheidet sich von humanistischer Ethik durch zwei Kennzeichen, ein formales und ein materiales. In formaler Hinsicht leugnet autoritäre Ethik die Fähigkeit des Menschen, zu wissen, was gut und was böse ist. Der Normgeber ist stets eine Autorität, die das Individuum transzendiert. Ein solches System gründet nicht in Vernunft und Wissen, sondern in der Furcht vor der Autorität und in dem Gefühl der Schwäche und der Abhängigkeit des Untergebenen. Die magische Kraft der Autorität bewirkt, dass man es ihr überlässt, Entscheidungen zu treffen. Ihre Entscheidungen können und dürfen nicht in Frage gestellt werden. In materialer oder inhaltlicher Hinsicht beantwortet autoritäre Ethik die Frage nach Gut und Böse primär vom Standpunkt der Interessen der Autorität und nicht der Interessen des Individuums.
Sie beutet immer aus, auch dann, wenn der Untergebene beträchtlichen psychischen oder materiellen Gewinn aus ihr zu ziehen vermag.
Sowohl die formalen wie die materialen Kennzeichen der autoritären Ethik treten in der Genese ethischer Werturteile beim Kinde und unreflektierter Werturteile des durchschnittlichen Erwachsenen in Erscheinung.[7] Die Grundlagen unserer Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, werden im Kindesalter geschaffen. Dies gilt zunächst hinsichtlich physiologischer Funktionen, dann aber auch in Bezug auf komplexere Fragen des Verhaltens. Das Kind erwirbt bereits ein Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse, noch ehe es mit Hilfe der Vernunft zu unterscheiden lernt. Seine Werturteile sind das Ergebnis freundlicher oder unfreundlicher [II-012] Reaktionen jener Menschen, die für sein Leben bedeutungsvoll sind. In Anbetracht seiner völligen Abhängigkeit von der Fürsorge und Liebe der Erwachsenen kann es nicht überraschen, dass schon ein Ausdruck der Billigung oder Missbilligung im Gesicht der Mutter genügt, dem Kind den Unterschied zwischen Gut und Böse beizubringen. In der Schule und in der Gesellschaft wirken ähnliche Faktoren. „Gut“ ist das, wofür man gelobt wird, „böse“ ist das, wofür man von gesellschaftlichen Autoritäten oder von der Mehrzahl seiner Mitmenschen missbilligend angesehen oder auch getadelt wird. In der Tat scheint es so zu sein, dass die Furcht vor Tadel und der Wunsch nach Anerkennung die mächtigste und beinahe ausschließliche Motivierung für ethisches Urteilen ist. Dieser intensive emotionale Druck hindert das Kind, später auch den Erwachsenen, kritisch zu fragen, ob „gut“ etwas Gutes für ihn selbst oder für die Autorität bedeutet. Diese Unterscheidung wird deutlich, wenn wir Werturteile in Bezug auf Dinge betrachten. Sage ich, ein Auto sei „besser“ als ein anderes, dann ist selbstverständlich, dass ich das eine Auto darum als „besser“ bezeichne, weil es mir mehr nützt als das andere. Gut oder schlecht bezieht sich hier auf den Gebrauchswert, den ein Gegenstand für mich hat. Hält der Besitzer eines Hundes seinen Hund für „gut“, dann bezieht er sich auf bestimmte Eigenschaften des Hundes, die für ihn von Nutzen sind, zum Beispiel, dass er den Ansprüchen des Besitzers an einen Wachhund, Jagdhund oder an ein anhängliches Schoßhündchen entspricht. Ein Ding wird dann als gut bezeichnet, wenn es für die Person gut ist, die es gebraucht. Das gleiche Wertkriterium lässt sich auch auf den Menschen anwenden. Der Arbeitgeber bezeichnet einen Arbeitnehmer als „gut“, wenn dieser ihm von Nutzen ist. Der Lehrer wird einen Schüler vermutlich dann „gut“ nennen, wenn er gehorsam ist, den Unterricht nicht stört und ihm alle Ehre macht. Ein Kind wird man gleichfalls „gut“ nennen, wenn es lernwillig und gehorsam ist. Das „gute Kind“ ist vielleicht eingeschüchtert und unsicher und hat nur das Bestreben, seinen Eltern zu gefallen, indem es sich ihrem Willen unterwirft, während das „böse Kind“ seinen eigenen Willen und eigene Interessen hat, die jedoch den Eltern missfallen.
Die formalen und materialen Aspekte der autoritären Ethik sind offensichtlich nicht voneinander zu trennen. Wenn die Autorität den ihr Unterworfenen nicht ausbeuten wollte, hätte sie keine Veranlassung, ihn durch Furcht und emotionale Unterwürfigkeit zu beherrschen. Sie könnte jedes vernunftmäßige Urteil und jede Kritik fördern, müsste dann aber das Risiko eingehen, als nicht kompetent befunden zu werden. Da jedoch ihre eigenen Interessen auf dem Spiel stehen, gilt für die Autorität das Gesetz, dass Gehorsam die höchste Tugend und Ungehorsam die Kardinalsünde ist. Rebellion ist in der autoritären Ethik eine unverzeihliche Sünde. Sie stellt das Recht der Autorität in Frage, Normen aufzustellen; und sie stellt ihr Axiom in Frage, dass die von ihr aufgestellten Normen den Interessen der ihr Unterworfenen am besten dienen. Ein Sünder wird dadurch, dass er die Strafe hinnimmt und sich schuldig fühlt, wieder ein „guter Mensch“, denn er beweist damit, dass er die Überlegenheit der Autorität anerkennt.
In den Erzählungen über die Anfänge der menschlichen Geschichte gibt das Alte Testament eine Illustration dessen, was autoritäre Ethik ist. Die Sünde von Adam und [II-013] Eva wird nicht durch die Tat als solche erklärt. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen war nicht an sich schlecht; tatsächlich stimmen sowohl die jüdische wie die christliche Religion darin überein, dass die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, eine Grundtugend ist. Die Sünde bestand im Ungehorsam, in der Herausforderung der göttlichen Autorität. Gott fürchtete deshalb: „Seht, der Mensch ist geworden wie wir; er erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt!“ (Gen 3,2) Die humanistische Ethik kann ebenso wie die autoritäre Ethik mittels formaler und materialer Kriterien erfasst werden. In formaler Hinsicht beruht sie auf dem Prinzip, dass nur der Mensch selbst das Kriterium für Tugend und Sünde bestimmen kann, niemals aber eine Autorität, die ihn transzendiert. Materialiter basiert sie auf dem Prinzip: „Gut“ ist das, was für den Menschen gut ist, „böse“ ist das, was ihm schadet. Das Wohl des Menschen ist das einzige Kriterium für ein ethisches Werturteil.
Der Unterschied zwischen humanistischer und autoritärer Ethik zeigt sich in den verschiedenen Bedeutungen, die das Wort „Tugend“ hat. Aristoteles gebraucht „Tugend“, um eine „Vortrefflichkeit“ zu bezeichnen, nämlich die Vortrefflichkeit, die dem Menschen eigenen Möglichkeiten zu realisieren. Paracelsus zum Beispiel gebraucht das Wort „Tugend“ als Synonym für die individuellen Eigentümlichkeiten eines jeden Dinges, das heißt also, für seine Besonderheit. Ein Stein oder eine Blume, jedes hat seine Tugend, seine spezifischen Eigenschaften. So besteht auch die „Tugend“ des Menschen in jenen Eigenschaften, die für die Spezies Mensch charakteristisch sind, während die Tugend jedes Einzelnen in seiner einmaligen Individualität besteht.
Der Mensch ist „tugendhaft“, wenn er seine „Tugend“ zur Entfaltung bringt. Im Gegensatz hierzu ist „Tugend“ im heutigen Sinn ein Begriff der autoritären Ethik. Tugendhaft zu sein bedeutet hier Selbstverleugnung und Gehorsam, Unterdrückung der Individualität und nicht deren völlige Entfaltung.
Humanistische Ethik ist anthropozentrisch, freilich nicht in dem Sinne, dass der Mensch der Mittelpunkt des Universums ist, vielmehr in dem Sinne, dass seine Werturteile, wie alle anderen Urteile und Wahrnehmungen, in der Besonderheit seiner Existenz ihren Ursprung haben und nur in Beziehung zu dieser sinnvoll sind. Der Mensch ist tatsächlich „das Maß aller Dinge“. Vom humanistischen Standpunkt aus gibt es nichts Höheres und nichts Erhabeneres als die menschliche Existenz. Gegen diese Auffassung wurde eingewandt, dass es gerade im Wesen des ethischen Verhaltens liege, dass es auf etwas bezogen sei, was den Menschen transzendiere und dass deshalb ein System, das nur den Menschen und sein Interesse anerkenne, nicht wirklich ethisch sein könne, denn es könne lediglich das isolierte egoistische Individuum zum Gegenstand haben.
Dieses Argument beruht auf einem Fehlschluss. Es wird gewöhnlich vorgebracht, um die Fähigkeit des Menschen – und sein Recht – zu widerlegen, die für sein Leben gültigen Normen selbst erstellen und beurteilen zu können. Denn der Grundsatz, gut ist, was für den Menschen gut ist, bedeutet nicht, dass für ihn von Natur aus Egoismus und Isolierung gut sind. Folglich kann es auch nicht heißen, dass der Sinn des menschlichen Daseins in der Beziehungslosigkeit zur Welt außerhalb des eigenen Ich erfüllt [II-014] werden kann. Wie schon viele Verfechter der humanistischen Ethik dargelegt haben, besteht in der Tat eines der Charakteristika der menschlichen Natur darin, dass der Mensch Erfüllung und Glück nur in der Bezogenheit auf seine Mitmenschen und in der Solidarität mit ihnen findet. Seinen Nächsten zu lieben ist jedoch kein Phänomen, das den Menschen transzendiert.[8] Es ist vielmehr etwas, das ihm innewohnt und von ihm seinen Ausgang nimmt. Liebe ist keine höhere Macht, die von oben zum Menschen hinuntersteigt. Sie ist auch keine Pflicht, die ihm auferlegt wird. Sie ist eine dem Menschen eigene Kraft, durch die er sich zur Welt in Beziehung setzt und durch die er die Welt zu seiner Welt macht.
b) Subjektivistische Ethik im Gegensatz zu objektivistischer Ethik
Wenn wir vom Prinzip einer humanistischen Ethik ausgehen, was können wir dann jenen antworten, die dem Menschen die Fähigkeit abstreiten, zu normativen Grundsätzen zu gelangen, die objektiv gültig sind? Eine Richtung innerhalb der humanistischen Ethik lässt diesen Einwand tatsächlich gelten. Sie anerkennt, dass Werturteile keinerlei objektive Gültigkeit beanspruchen können, da sich in ihnen nur willkürliche Neigungen und Abneigungen des Einzelnen ausdrücken. So gesehen umschreibt beispielsweise der Satz „Freiheit ist besser als Sklaverei“ nur einen Unterschied in der persönlichen Bevorzugung. Objektive Gültigkeit kommt ihm jedoch nicht zu. In diesem Sinne wird der Wert als „irgendein gewünschtes Gutes“ definiert. Der Wunsch rechtfertigt den Wert, nicht aber der Wert den Wunsch. Ein so radikaler Subjektivismus ist seinem Wesen nach absolut unvereinbar mit dem Gedanken, dass ethische Normen universal gültig und auf jeden anwendbar sein sollten. Wäre dieser Subjektivismus die einzige Möglichkeit humanistischer Ethik, dann bliebe uns tatsächlich nur die Wahl zwischen einem autoritären ethischen Denken und dem Verzicht auf jeglichen Anspruch auf allgemein gültige Normen.
Ethischer Hedonismus ist das erste Zugeständnis, das dem Prinzip der Objektivität gemacht wird. Geht man von der Annahme aus, dass Lust für den Menschen gut und Unlust böse ist, dann setzt dies ein Prinzip voraus, nach dem Wünsche bemessen werden können. Es sind dann solche Wünsche wertvoll, deren Erfüllung Lust verursacht, andere nicht. Aber trotz Herbert Spencers Behauptung, die Lust habe im biologischen Entwicklungsprozess eine objektive Funktion, kann Lust dennoch kein Wertkriterium sein. Denn es gibt Menschen, die an der Unterwerfung und nicht an der Freiheit Lust empfinden, für die nicht Liebe, sondern Hass, nicht produktive Arbeit, sondern Ausbeutung Lust bedeutet. Ein derartiges Lustgefühl an dem, was objektiv schädlich ist, kennzeichnet den neurotischen Charakter. Dieser ist von der Psychoanalyse gründlich erforscht worden. Bei unserer Erörterung der Charakterstruktur werden wir auf dieses Problem zurückkommen, ebenso in dem Kapitel über Glück und Lust.
Den entscheidenden Schritt zu einem objektiveren Wertkriterium hat Epikur mit einer Modifikation des ethischen Prinzips gemacht. Er versuchte die Schwierigkeit dadurch zu meistern, dass er zwischen „höheren“ und „niederen“ Freuden [II-015] unterschied. Wenn damit die eigentliche Schwäche des Hedonismus auch erkannt wurde, so blieb der Versuch in seinem Ergebnis doch abstrakt und dogmatisch. Nichtsdestoweniger kann der Hedonismus ein großes Verdienst für sich beanspruchen. Da er nämlich das eigene Lust- und Glücksempfinden des Menschen zum einzigen Wertkriterium machte, schloss er von vornherein alle Versuche aus, eine Autorität einzuführen, die von sich aus bestimmt, was das Beste für den Menschen ist, ohne dem Menschen die Möglichkeit einer eigenen Entscheidung zu belassen, ob er das als das Beste empfindet, was ihm als das angeblich Beste vorgestellt wird. Daher kann die Tatsache nicht überraschen, dass eine hedonistische Ethik von fortschrittlichen Denkern, die ehrlich und leidenschaftlich für das Glück des Menschen eintraten, sowohl in Griechenland und Rom als auch in den modernen europäischen und amerikanischen Kulturen vertreten wurde.
Trotz seiner Verdienste konnte der Hedonismus jedoch keine Grundlage für objektiv gültige ethische Urteile schaffen. Müssen wir deshalb auf den Anspruch der Objektivität verzichten, wenn wir uns für den Humanismus entscheiden? Oder ist es möglich, Verhaltensnormen und Werturteile zu finden, die für alle Menschen gültig sind und die doch vom Menschen selbst und nicht von einer ihn transzendierenden Autorität aufgestellt werden? Ich glaube, dass dies möglich ist, und werde nun versuchen, eine solche Möglichkeit darzulegen.
Zunächst dürfen wir nicht vergessen, dass „objektiv gültig“ nicht mit „absolut“ identisch ist. Eine Behauptung über Wahrscheinlichkeit oder annähernde Gültigkeit irgendeiner Hypothese kann beispielsweise gültig und zugleich „relativ“ sein, und zwar in dem Sinn, dass sie auf Grund begrenzt gültiger Evidenz aufgestellt wurde und späteren Berichtigungen unterworfen ist, sofern Tatsachen oder Verfahrensweisen dies erforderlich machen. Die ganze Vorstellung von „relativ“ und „absolut“ wurzelt im theologischen Denken, in dem ein göttlicher Bereich als das „Absolute“ von dem unvollkommenen menschlichen Bereich unterschieden wird. Von diesem theologischen Zusammenhang abgesehen ist der Begriff „absolut“ bedeutungslos. In der Ethik wie im allgemeinen wissenschaftlichen Denken ist für ihn kein Raum.
Aber selbst dann, wenn wir in diesem Punkt einig sind, muss der Haupteinwand gegen die Möglichkeit objektiv gültiger Urteile in der Ethik noch geklärt werden: der Einwand nämlich, dass „Tatsachen“ deutlich von Werten unterschieden werden müssten. Seit Kant ist es eine weitverbreitete Auffassung, dass objektiv gültige Urteile nur über Tatsachen und nicht über Werte selbst gefällt werden könnten und dass der Ausschluss von Werturteilen ein Beweis für wissenschaftliches Denken sei.
Im Bereich der Künste („Kunst“ hier im alten Wortsinne, wie etwa Schmiedekunst, Heilkunst verstanden) haben wir uns daran gewöhnt, objektiv gültige Normen aufzustellen, die mit Hilfe wissenschaftlicher Prinzipien abgeleitet wurden, welche ihrerseits auf Grund der Beobachtung der Wirklichkeit und/oder in umfassenden mathematisch-deduktiven Verfahren gefunden wurden. Die reinen oder „theoretischen“ Wissenschaften befassen sich mit der Entdeckung von Tatsachen und Prinzipien, obwohl sogar in die Physik oder in die Biologie ein normatives Element eintritt, das ihre Objektivität jedoch nicht beeinträchtigt. Die angewandten Wissenschaften befassen sich primär mit praktischen Normen, auf Grund derer etwas getan werden soll – wobei [II-016] das „Sollen“ durch wissenschaftliche Erkenntnis von Tatsachen und Prinzipien bestimmt wird. Sich in einer der Künste zu betätigen, setzt bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten voraus. Während einige Künste nur „Kenntnisse“ erfordern, über die ein gesunder Menschenverstand verfügt, erfordern andere, wie etwa die Kunst des Ingenieurs oder die Heilkunst ein umfassendes theoretisches Wissen. Wer zum Beispiel eine Eisenbahnlinie bauen möchte, muss sie so anlegen, dass die Bauweise mit bestimmten physikalischen Grundgesetzen übereinstimmt. In allen „Künsten“ bildet ein System objektiv gültiger Normen die theoretische Grundlage für die Praxis (der angewandten Wissenschaft). Dieses System gründet sich seinerseits auf die theoretischen Wissenschaften. Mag es auch verschiedene Wege geben, um in irgendeiner Kunst Hervorragendes zu leisten, so sind doch die Normen keineswegs willkürlich. Ihre Missachtung zeitigt schlechte Resultate oder sogar einen absoluten Misserfolg auf dem Weg zum angestrebten Ziel.
Aber nicht nur Medizin, Technik und Malerei sind Künste; das Leben selbst ist eine Kunst[9] – in Wirklichkeit die wichtigste und zugleich schwierigste und vielfältigste Kunst, die der Mensch ausüben kann. Ihr Gegenstand ist nicht diese oder jene spezielle Verrichtung, sondern die „Verrichtung“ des Lebens selbst, der Entwicklungsprozess auf das hin, was der Mensch potenziell ist. Bei der Kunst des Lebens ist der Mensch sowohl der Künstler als auch der Gegenstand seiner Kunst. Er ist der Bildhauer und der Stein, der Arzt und der Patient.
Für die humanistische Ethik ist „gut“ gleichbedeutend mit „gut für den Menschen“ und „böse“ gleichbedeutend mit „schlecht für den Menschen“. Um zu wissen, was für den Menschen gut ist, müssen wir seine Natur kennen. Humanistische Ethik ist die angewandte Wissenschaft von der „Kunst des Lebens“. Sie beruht auf der theoretischen „Wissenschaft vom Menschen“. Hier wie in anderen „Künsten“ gilt: Das Maß an Vortrefflichkeit der Bemühungen eines Menschen („Tugend“) verhält sich proportional zu seinen Kenntnissen in der Wissenschaft vom Menschen und zu seinem Können und Tun.
Man kann jedoch nur dann Normen von Theorien ableiten, wenn man eine bestimmte Tätigkeit gewählt hat und ein bestimmtes Ziel angestrebt wird. Die Voraussetzung der Medizin ist der Wunsch, Krankheit zu heilen und Leben zu verlängern. Wäre dies nicht so, dann wären alle Regeln der Medizin ohne Bedeutung. Jede angewandte Wissenschaft gründet sich auf ein Axiom, das die Folge einer Entscheidung ist: dass der Zweck des Tuns wünschenswert ist. Ein Unterschied besteht allerdings zwischen dem Axiom, das der Ethik zugrunde liegt, und dem anderer „Künste“. Hypothetisch können wir uns eine Kultur vorstellen, in der die Menschen keinen Wunsch nach Gemälden oder Brücken haben, wir können uns jedoch keine vorstellen, in der die Menschen nicht gerne leben. Der Trieb zu leben wohnt jedem Organismus inne. Der Mensch kann daher gar nicht anders entscheiden als leben zu wollen, unabhängig davon, was für Gedanken er sich über das Leben selbst macht. (Der Suizid als pathologisches Phänomen widerspricht diesem allgemeinen Prinzip nicht.) Die Wahl zwischen [II-017] Leben und Tod ist eher ein scheinbares Problem als ein reales. Des Menschen wirkliche Wahl ist die zwischen einem guten Leben und einem schlechten.
Es ist interessant hier die Frage zu stellen, warum unsere Zeit die Auffassung vom Leben als einer Kunst verloren hat. Der moderne Mensch scheint zu glauben, Lesen und Schreiben seien Künste, die man erlernen müsse. Es bedürfe zwar umfassender Studien, um Architekt, Ingenieur oder gelernter Arbeiter zu werden, das Leben selbst jedoch sei etwas so Einfaches, dass keine besondere Anstrengung nötig sei, um es zu erlernen. Weil jeder auf irgendeine Weise „lebt“, sieht man das Leben als etwas an, das jeden berechtigt, sich als Lebenskünstler zu bezeichnen. Doch nicht deswegen, weil der Mensch die Kunst des Lebens in hohem Maße beherrscht, ging ihm das Gespür für ihre Schwierigkeit verloren. Das häufige Fehlen von echter Freude und echtem Glück im Vollzug des Lebens schließt offensichtlich eine solche Erklärung aus. Die moderne Gesellschaft hat den Menschen trotz aller Betonung von Glück, Individualität und Selbstinteresse gelehrt, sich bewusst zu werden, dass nicht sein Glück (oder um den theologischen Terminus zu gebrauchen, sein Heil) das Ziel des Lebens sei, sondern die Erfüllung seiner Pflicht zu arbeiten oder sein Erfolg. Geld, Prestige und Macht sind Triebfedern und Daseinszweck geworden. Der Mensch handelt in der Illusion, seine Handlungen nützten seinem Selbstinteresse, obgleich er in Wirklichkeit allem anderen dient, nur nicht seinen eigenen wahren Interessen. Alles ist ihm wichtig, nur nicht das eigene Leben und die Kunst des Lebens. Für alles ist er zu haben, nur nicht für sich selbst.
Wenn die Ethik die Normen aufstellt, die uns befähigen, Vortreffliches in der Kunst des Lebens zu erreichen, dann müssen sich ihre allgemeinsten Prinzipien aus der Natur des Lebens im allgemeinen und aus der menschlichen Existenz im besonderen herleiten. Allgemein gesprochen: Die Natur alles Lebendigen ist die Erhaltung und Bejahung der eigenen Existenz. Allen Organismen wohnt die Tendenz inne, ihre Existenz zu erhalten. Von dieser Tatsache ausgehend, haben die Psychologen einen Selbsterhaltungstrieb angenommen. Danach besteht die erste „Pflicht“ eines Organismus darin, lebendig zu sein.
„Lebendig sein“ ist eine dynamische, keine statische Größe. Die Existenz und die Entfaltung der spezifischen Kräfte eines Organismus sind ein und dasselbe. Allen Organismen wohnt die Tendenz inne, die ihnen eigenen Möglichkeiten zu verwirklichen. Demzufolge muss man das Ziel des menschlichen Lebens in der Entfaltung der menschlichen Kräfte entsprechend den Gesetzen der Natur des Menschen sehen.
Allerdings existiert der Mensch nicht „im allgemeinen“. Wenn er auch den Kern der menschlichen Eigenschaften mit allen Mitgliedern seiner Spezies gemeinsam hat, so ist er doch stets ein Individuum, ein einmaliges Wesen, das sich von jedem anderen Individuum unterscheidet. Er unterscheidet sich ebenso durch die besondere Mischung von Charakter, Temperament, Talenten, Dispositionen, wie durch die Form seiner Finger. Die ihm eigentümlichen menschlichen Möglichkeiten kann er nur verwirklichen, wenn er seine Individualität verwirklicht. Die Aufgabe, lebendig zu sein, ist identisch mit der Aufgabe, er selbst zu werden, sich zu dem Individuum zu entwickeln, das er potenziell ist.
Fassen wir zusammen: Gut im Sinne der humanistischen Ethik bedeutet Bejahung des [II-018] Lebens, Entfaltung der menschlichen Kräfte; Tugend heißt, sich der eigenen Existenz gegenüber verantwortlich zu fühlen. Das Böse führt zur Lähmung der menschlichen Kräfte; Laster ist Verantwortungslosigkeit sich selbst gegenüber.
Dies sind die ersten Prinzipien einer objektiven humanistischen Ethik. Wir können sie hier nicht näher erläutern und werden daher im vierten Kapitel nochmals darauf zurückkommen. Zuvor müssen wir allerdings die Frage aufwerfen, ob eine „Wissenschaft vom Menschen“, und zwar als theoretische Grundlage der angewandten Wissenschaft Ethik, überhaupt möglich ist.
c) Die Wissenschaft vom Menschen[10]
Der Begriff einer Wissenschaft vom Menschen setzt voraus, dass ihr Gegenstand, der Mensch, existiert und dass es so etwas wie eine menschliche Natur gibt, die für die menschliche Spezies charakteristisch ist. In dieser Frage zeigt die Geschichte des Denkens ihre besondere Ironie und enthält eigenartige Widersprüche. Autoritäre Denker haben es sich leicht gemacht, indem sie die Existenz einer nach ihrer Meinung starren und unveränderlichen menschlichen Natur voraussetzten. Diese Annahme sollte beweisen, dass die auf dieser vorausgesetzten Natur des Menschen beruhenden ethischen Systeme und gesellschaftlichen Institutionen notwendig und unwandelbar seien. Ihre Ansicht über die menschliche Natur war jedoch nur die Widerspiegelung ihrer Normen – und Interessen –, nicht jedoch das Ergebnis objektiver Forschung. So ist es denn auch begreiflich, dass fortschrittliche Denker jene Forschungsergebnisse der Anthropologie und Psychologie begrüßten, welche im Gegensatz dazu die unbegrenzte Formbarkeit der menschlichen Natur nachzuweisen schienen. Denn Formbarkeit sollte bedeuten, dass Normen und Institutionen, die eher eine vorausgesetzte Ursache der menschlichen Natur als deren Wirkung sind, ebenfalls formbar sein können. Während sie so der irrigen Annahme entgegentraten, dass bestimmte geschichtlich gewachsene Verhaltensmuster der Ausdruck einer starren und ewigen menschlichen Natur seien, kamen dennoch die Verfechter einer Theorie der unbegrenzten Formbarkeit der menschlichen Natur zu einer ebenso unhaltbaren Position. Zunächst einmal führt die Auffassung der unbegrenzten Formbarkeit der menschlichen Natur leicht zu Folgerungen, die genauso wenig befriedigen wie jene Auffassung, die eine starre und unveränderliche Natur des Menschen annimmt. Wäre der Mensch nämlich unbegrenzt formbar, dann könnte er tatsächlich durch Normen und Institutionen, die seinem Wohlergehen entgegenstehen, für immer geformt werden, ohne dass es eine Möglichkeit gäbe, die der menschlichen Natur innewohnenden Kräfte zu mobilisieren, um eine Veränderung der Verhältnisse zu erreichen. In diesem Falle wäre der Mensch nur eine Marionette irgendwelcher gesellschaftlicher [II-019] Zustände und nicht – wie er im Laufe der Geschichte unter Beweis gestellt hat – ein tätiges Wesen, dessen innere Eigenschaften heftig reagieren, wenn sie durch ungünstige gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen unter Druck gesetzt werden. Wäre der Mensch nichts anderes als eine Widerspiegelung kultureller Verhältnisse, dann könnte keine Gesellschaftsordnung vom Standpunkt des menschlichen Wohlergehens aus kritisiert und beurteilt werden, weil es keine Vorstellungen vom Wesen „Mensch“ gäbe.
Ebenso wichtig wie die politischen und moralischen Rückwirkungen der Theorie von der Formbarkeit sind theoretische Folgerungen. Wenn wir annehmen, es gäbe keine andere menschliche Natur (als die in Begriffen grundlegender physiologischer Bedürfnisse definierte), dann wäre die einzig vertretbare Psychologie ein radikaler Behaviorismus, der lediglich unzählige Verhaltensweisen beschreibt, oder eine Psychologie, die nur quantitative Aspekte menschlichen Verhaltens misst. Psychologie und Anthropologie hätten keine andere Aufgabe, als die verschiedenen Arten zu beschreiben, in welcher gesellschaftliche Institutionen und kulturelle Verhältnisse den Menschen formen. Die besonderen Erscheinungsformen des Menschlichen wären nichts anderes als der Ausdruck davon, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse auf den Menschen eingewirkt haben. In diesem Falle könnte es nur noch eine einzige Wissenschaft vom Menschen geben, nämlich die vergleichende Soziologie. Wollen jedoch Psychologie und Anthropologie gültige Behauptungen über die Gesetze aufstellen, die das menschliche Verhalten bestimmen, dann müssen sie auch von der Voraussetzung ausgehen, dass etwas, nennen wir es X, auf Einflüsse seiner Umgebung in einer feststellbaren Weise reagiert, die sich aus der Eigenart von X herleitet. Da die Natur des Menschen nicht starr ist, kann auch die Kultur nicht als das Ergebnis unwandelbarer menschlicher Instinkte verstanden werden. Ebenso wenig ist die Kultur etwas Feststehendes, dem sich die menschliche Natur passiv und in vollem Umfang anpasst. Zwar kann sich der Mensch unzulänglichen Verhältnissen anpassen, aber in diesem Prozess entwickelt er bestimmte seelische und emotionale Reaktionen, die aus den besonderen Eigenheiten seiner Natur heraus entstehen.
Der Mensch kann sich der Sklaverei anpassen, doch reagiert er darauf mit dem Nachlassen seiner intellektuellen und moralischen Fähigkeiten. Ebenso kann er sich einer Kultur anpassen, die von gegenseitigem Misstrauen und Feindseligkeit erfüllt ist, aber seine Reaktion auf diese Anpassung besteht darin, dass er schwach und unschöpferisch wird. Der Mensch kann sich auch kulturellen Verhältnissen anpassen, die von ihm die Verdrängung seiner Sexualität verlangen, aber seine Anpassung hat die Entstehung neurotischer Symptome zur Folge, wie Freud aufgewiesen hat. Der Mensch kann sich fast allen kulturellen Verhältnissen anpassen; stehen diese aber im Widerspruch zu seiner Natur, dann stellen sich seelische und emotionale Störungen ein, die ihn allmählich zwingen, diese Verhältnisse zu ändern, da er seine Natur nicht ändern kann.
Der Mensch ist kein unbeschriebenes Blatt, auf das erst die Kultur ihren Text schreibt. Er ist ein Wesen, das mit Energien ausgestattet und in besonderer Weise strukturiert ist. Er passt sich an und reagiert dabei in spezifischer und feststellbarer Weise auf äußere Bedingungen. Hätte sich der Mensch, wie es das Tier tut, durch eine [II-020] Veränderung seiner eigenen Natur, gleichsam autoplastisch, äußeren Bedingungen angepasst, und könnte er ausschließlich unter solchen spezifischen Bedingungen leben, für die er eine besondere Anpassungsfähigkeit entwickelt hat, dann wäre er in die Sackgasse jener Spezialisierung geraten, die das Schicksal jeder Tiergattung ist, und eine geschichtliche Entwicklung wäre ausgeschlossen. Wenn sich der Mensch andererseits allen Bedingungen anpassen könnte, ohne dass er gegen solche ankämpfen müsste, die seiner Natur nicht entsprechen, dann hätte es ebenfalls keine Geschichte gegeben. Die Evolution des Menschen setzt seine Anpassungsfähigkeit, gleichzeitig aber auch bestimmte unzerstörbare Eigenschaften seiner Natur voraus, die ihn zwingen, unablässig solche Bedingungen zu suchen, die den allein ihm eigenen Bedürfnissen besser entsprechen.
Der Gegenstand der Wissenschaft vom Menschen ist die menschliche Natur. Diese Wissenschaft geht aber nicht von einem vollständigen und adäquaten Bild dessen, was die menschliche Natur ist, aus. Eine befriedigende Definition ihres Gegenstandes ist ihr Ziel, nicht ihr Ausgangspunkt. Ihre Methode besteht darin, die Reaktionen des Menschen auf verschiedene individuelle und gesellschaftliche Bedingungen zu beobachten, um dann aus der Beobachtung eben dieser Reaktionen zu Schlussfolgerungen über die Natur des Menschen zu kommen.[11] Geschichte und Kulturanthropologie erforschen die Reaktionen des Menschen auf solche kulturelle und gesellschaftliche Bedingungen, die sich von den unseren unterscheiden. Die Sozialpsychologie hingegen erforscht die Reaktionen der Menschen in verschiedenen gesellschaftlichen Konstellationen innerhalb unserer eigenen Kultur. Die Entwicklungspsychologie erforscht die Reaktionen des heranwachsenden Kindes auf verschiedene Situationen. Die Psychopathologie versucht, Aufschluss über die menschliche Natur zu finden, indem sie ihre Verzerrungen auf Grund von pathogenen Bedingungen untersucht. Man kann nicht die menschliche Natur als solche beobachten, sondern nur ihre spezifischen Manifestationen in spezifischen Situationen. Die menschliche Natur ist eine theoretische Konstruktion, die auf Grund der empirischen Erforschung des menschlichen Verhaltens erschlossen werden kann. In ihrem Bemühen, ein „Modell der menschlichen Natur“ zu konstruieren, unterscheidet sich die Wissenschaft vom Menschen in nichts von anderen Wissenschaften, die ebenso mit bestimmten Hypothesen operieren, welche nicht unmittelbar selbst beobachtet werden können, sondern sich aus beobachtbaren Daten erschließen lassen und sich an diesen bewahrheiten müssen. Trotz des umfangreichen Tatsachenmaterials, das Psychologie und Anthropologie liefern, haben wir nur ein unvollständiges und vorläufiges Bild von der Natur des Menschen. Wenn wir empirisch und objektiv feststellen wollen, was die menschliche Natur ausmacht, können wir noch immer von Shylock lernen und das im erweiterten Sinne für die ganze Menschheit gelten lassen, was er über Juden und Christen sagt: „Ich bin ein Jude. Hat nicht ein Jude Augen? Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen, Leidenschaften? Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt, gewärmt und gekältet von eben dem Winter und Sommer als ein Christ? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht [II-021] rächen? Sind wir euch in Dingen ähnlich, so wollen wir’s euch auch darin gleich tun.“ (William Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig, 3. Akt, 1. Szene.)
d) Die Tradition der humanistischen Ethik
In der Tradition der humanistischen Ethik herrscht die Ansicht vor, die Kenntnis des Menschen sei die Voraussetzung dafür, Normen und Werte aufstellen zu können. Die ethischen Abhandlungen von Aristoteles, Spinoza und Dewey – Denker, deren Ansichten wir in diesem Kapitel skizzieren wollen – sind deshalb gleichzeitig Abhandlungen zur Psychologie. Ich will im Folgenden keinen Überblick über die Geschichte der humanistischen Ethik geben, sondern lediglich eine Veranschaulichung ihrer Grundsätze, wie sie bei einigen ihrer bedeutendsten Vertreter zu finden sind.
Aristoteles baut seine Ethik auf der Wissenschaft vom Menschen auf. Seine Psychologie untersucht die Natur des Menschen; die Ethik ist demzufolge angewandte Psychologie. Wie der Staatsmann, so muss auch der Ethiker „in gewissem Umfang vom Seelischen Kenntnis haben, genauso wie der Arzt, der die Augen heilen will, den Körper als Ganzes kennen soll... In den Reihen der Ärzte bemühen sich übrigens häufig gerade die geistig hochstehenden um theoretische Kenntnis des Leibes“ (Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1102a). Von der Natur des Menschen deduziert Aristoteles die Norm, dass Tugend (Trefflichkeit) ein Tätigsein ist, womit er die Übung der Bestimmung und der Fähigkeit meint, die nur dem Menschen eigen ist. Glück, das Ziel des Menschen, ist die Folge von „Tätigsein“ und „Handeln“ und kein stiller Besitz oder ein Seelenzustand. Um seinen Begriff von Tätigsein zu erklären, gebraucht er die Olympischen Spiele als Analogie: „Wie bei den Festspielen von Olympia nicht die den Siegeskranz erringen, die am schönsten und stärksten aussehen, sondern die Kämpfer – denn aus ihren Reihen treten die Sieger –, so gelangen auch zu den Siegespreisen des Lebens nur die Menschen, die richtig handeln“ (a.a.O., 1099a). Der freie, vernünftige und tätige („kontemplative“) Mensch ist der gute und deshalb auch der glückliche Mensch. Wir haben hier also objektive Wertsätze, die auf den Menschen zentriert und humanistisch sind, und die gleichzeitig vom Verstehen der Natur und der Bestimmung des Menschen abgeleitet sind.
Wie Aristoteles, so fragt auch Spinoza nach der besonderen Bestimmung des Menschen. Er beginnt damit, dass er die Bestimmung und das Ziel von allem, was in der Natur ist, betrachtet und kommt zu dem Schluss: „Ein jedes Ding strebt, soviel an ihm liegt, in seinem Sein zu beharren“ (Ethik, Teil III, 6. Lehrsatz). Die Bestimmung und das Ziel des Menschen können keine anderen sein als diejenigen eines jeglichen anderen Dinges, nämlich sich selbst und sein Leben zu erhalten. „Unbedingt aus Tugend handeln ist nichts anderes in uns, als nach Anleitung der Vernunft handeln, leben, sein Sein erhalten – diese drei Ausdrücke bedeuten dasselbe –, und zwar aus dem Grunde des Suchens nach dem eigenen Nutzen“ (Ethik, Teil IV, 24. Lehrsatz).
In seinem Sein zu beharren bedeutet für Spinoza, das zu werden, was man potenziell ist. Das gilt für alle Dinge. „Ein Pferd“, sagt Spinoza, „hört auf, ein Pferd zu sein, [II-022] ob es sich nun in einen Menschen oder in ein Insekt verwandelte“ (Ethik, Teil IV, Vorwort). In Übereinstimmung mit Spinoza könnten wir hinzufügen: Ein Mensch würde aufhören, ein Mensch zu sein, wenn er zu einem Engel oder zu einem Pferd werden würde. Tugend bedeutet die Entfaltung der spezifischen Möglichkeiten eines Organismus. Für den Menschen ist dies jener Zustand, in dem er ganz menschlich ist. Unter gut versteht Spinoza konsequenterweise das, „wovon wir sicher wissen, dass es ein Mittel ist, sich dem Modell der menschlichen Natur, das wir uns vorsetzen, mehr und mehr zu nähern. Unter schlecht dagegen (verstehe ich) dasjenige, wovon wir sicher wissen, dass es uns hindert, diesem Modell zu entsprechen“ (a.a.O.). Tugend ist demzufolge identisch mit der Realisierung der menschlichen Natur; die Wissenschaft vom Menschen ist jene theoretische Wissenschaft, auf die sich die Ethik gründet.
Die Vernunft zeigt dem Menschen, was er zu tun hat, um wahrhaft er selbst zu sein. Sie lehrt ihn, was gut ist. Die Tugend selbst kann der Mensch nur durch den tätigen Gebrauch seiner Kräfte erlangen. Stärke (potency) ist daher gleichbedeutend mit Tugend, Ohnmacht (impotence) mit Laster. Glück ist kein Selbstzweck, sondern geht einher mit der Erfahrung des Wachsens der eigenen Kräfte, während Ohnmacht mit Niedergeschlagenheit einhergeht. Stärke und Ohnmacht beziehen sich auf alle Kräfte, die dem Menschen eigen sind. Werturteile sind deshalb nur auf den Menschen und auf seine Interessen anwendbar. Trotzdem sind solche Werturteile nicht bloß Behauptungen über die Neigungen oder Abneigungen einzelner Individuen, denn die Eigentümlichkeiten des Menschen sind der ganzen Gattung und folglich allen Menschen eigen. Die Objektivität von Spinozas Ethik beruht auf der Objektivität seines Modells der menschlichen Natur, das in seinem Kern, obwohl es mannigfaltige individuelle Abwandlungen zulässt, für alle Menschen dasselbe ist. Spinoza ist ein radikaler Gegner der autoritären Ethik. Für ihn ist der Mensch Selbstzweck und nicht Mittel zum Zweck einer ihn transzendierenden Autorität. Ein Wert kann nur in Beziehung zu den wahren Interessen des Menschen bestimmt werden, das heißt in Bezug auf seine Freiheit und auf den produktiven Gebrauch seiner Kräfte.[12] [II-023]
Der hervorragendste zeitgenössische Vertreter einer wissenschaftlichen Ethik ist John Dewey, dessen Ansichten im Gegensatz zu einer autoritären und zu einer relativistischen Ethik stehen. Hinsichtlich der autoritären Ethik kommt er zu dem Ergebnis, das gemeinsame Merkmal jeder Berufung auf Offenbarung, auf gottgewollte Gesetze, auf Anordnungen des Staates, auf Konvention, Tradition usw. sei „die Voraussetzung einer Autorität, die jede Nachprüfung ausschließt“ (J. Dewey und J. H. Tufts, 1932, S. 364). In Bezug auf den Relativismus vertritt Dewey die Auffassung, allein die Tatsache, an etwas Freude zu empfinden, enthalte noch „kein Urteil über den Wert dessen, woran man sich erfreut“ (J. Dewey, 1946, S. 254). Die Freude ist etwas fundamental Gegebenes, aber sie muss „durch evidente Tatsachen verifiziert“ werden (a.a.O., S. 254). Wie Spinoza postuliert er, dass objektiv gültige Wertsetzungen kraft menschlicher Vernunft erlangt werden können. Auch für ihn ist das Ziel des menschlichen Lebens Wachstum und Entfaltung des Menschen gemäß seiner Natur und auf Grund seiner Konstitution.
Die Ablehnung aller festgelegten Zwecke führt ihn jedoch dazu, Spinozas wichtige Setzung eines „Modells der menschlichen Natur“ als einer wissenschaftlichen Vorstellung preiszugeben. In Deweys Lehre liegt der Hauptakzent auf der Beziehung zwischen Mitteln und Zwecken (oder Folgen) als Erfahrungsgrundlage für die Gültigkeit von Normen. Nach ihm findet eine Bewertung „nur dann statt, wenn es sich um etwas Bedeutsames handelt; wenn also eine Störung abgestellt, ein Bedürfnis befriedigt, ein Mangel behoben, eine Entbehrung beseitigt oder ein bestimmter Konflikt zwischen Neigungen mittels einer Veränderung der bestehenden Bedingungen gelöst werden muss. Damit wurde bewiesen, dass hier ein in Frage kommender Faktor immer gemeint ist, wenn es sich um eine solche Bewertung handelt. Der vorschwebende Zweck wird in Aussicht genommen und gestaltet, sofern man so handelt, dass ein bestehendes Bedürfnis befriedigt oder ein Mangel behoben, bzw. ein vorhandener Konflikt gelöst wird“ (J. Dewey, 1939, S. 34).
Für Dewey ist der Zweck „nur eine Folge von Handlungen, betrachtet im späteren Stadium; das Mittel ist nur eine Folge, betrachtet im vorausgegangenen Stadium. Die Unterscheidung von Mitteln und Zwecken erfolgt durch Betrachtung des Verlaufs einer angenommenen Tätigkeitskurve in Zusammenhängen der Zeitfolge. Der ‘Zweck’ ist der letzte in Aussicht genommene Akt; die Mittel sind Tätigkeiten, die zeitlich vor diesem auszuführen sind... Mittel und Zwecke sind zwei Benennungen für die gleiche Wirklichkeit. Bezeichnet ist damit keine in der Wirklichkeit vollziehbare Trennung, sondern eine Unterscheidung im Urteil“ (J. Dewey, 1930, S. 34 f.).
Zweifellos ist Deweys Betonung der Wechselbeziehung zwischen Mitteln und Zwecken ein bedeutsamer Schritt für die Entwicklung der Theorie einer rationalen Ethik. Das gilt insbesondere für seine Warnung vor solchen Theorien, die Zwecke von Mitteln trennen und somit nutzlos werden. Und doch ist es allem Anschein nach unrichtig, dass wir „nicht wissen können, was wir in Wirklichkeit sind, ehe ein Tätigkeitsverlauf verstandesmäßig erfasst ist“ (J. Dewey, 1930, S. 36).
Zwecke können durch empirische Analyse des Gesamtphänomens „Mensch“ auch dann ermittelt werden, wenn wir die Mittel noch nicht kennen, um diese zu erreichen. Es gibt Zwecke, über die gültige Behauptungen aufgestellt werden können, obwohl [II-024] ihnen im Moment alles zu ihrer Verwirklichung fehlt. Die Wissenschaft vom Menschen ist in der Lage, uns einen Begriff vom „Modell der menschlichen Natur“ zu geben, von dem Zwecke abgeleitet werden können, noch bevor die Mittel gefunden worden sind, um diese Zwecke zu erreichen.[13]
e) Ethik und Psychoanalyse
Aus dem Vorhergehenden ergibt sich meiner Meinung nach eindeutig genug, dass die Entwicklung einer objektiven humanistischen Ethik als einer angewandten Wissenschaft von der Entwicklung der Psychologie als einer theoretischen Wissenschaft abhängt. Der Fortschritt von der aristotelischen Ethik zur Ethik Spinozas beruht weitgehend auf der Überlegenheit der dynamischen Psychologie Spinozas gegenüber der statischen des Aristoteles. Spinoza entdeckte die unbewusste Motivation, die Assoziationsgesetze und die Nachwirkung von Kindheitserfahrungen auf das ganze Leben. Sein Begriff der „Begierde“ ist ein dynamischer, und als solcher ist er dem aristotelischen Begriff der „Gewöhnung“ überlegen.[14] Wie jede andere Psychologie bis zum neunzehnten Jahrhundert blieb auch Spinozas Psychologie abstrakt. Sie entwickelte keine Methode, um ihre Theorien durch empirische Untersuchungen und Entdeckungen neuer Aussagen über den Menschen zu überprüfen.
In Deweys Ethik und Psychologie ist die empirische Forschung ein Schlüsselbegriff. Er anerkennt die unbewusste Motivation, und sein Begriff „habit“ unterscheidet sich von dem deskriptiven Habitus-Begriff des traditionellen Behaviorismus. Seine Behauptung, die moderne klinische Psychologie sei „wirklichkeitsnah, weil sie die tiefe Bedeutung unbewusster Kräfte betont, die nicht nur das sichtbare Verhalten bestimmen, sondern auch Wünsche und Urteile, den Glauben und die Entstehung von Ideen und Idealen“ (J. Dewey, 1930, S. 86), beweist, welche Bedeutung er allen unbewussten Faktoren beimisst, obwohl er in seiner ethischen Theorie noch längst nicht alle Möglichkeiten dieser neuen Methode ausschöpft.
Bisher sind nur wenige Versuche von philosophischer und psychologischer Seite unternommen worden, um die Ergebnisse der Psychoanalyse für die Ergebnisse einer ethischen Theorie auszuwerten.[15] Dies überrascht umso mehr, als gerade die psychoanalytische Theorie Beiträge geliefert hat, die besonders für eine ethische Theorie relevant sind. [II-025]
Als Wichtigstes muss wohl die Tatsache betrachtet werden, dass die Psychoanalyse als erstes modernes psychologisches System nicht voneinander isolierte Aspekte des Menschen, sondern seine ganze Persönlichkeit zum Gegenstand hat. Im Gegensatz zur Methode der herkömmlichen Psychologie, welche sich nur auf die Untersuchung solcher Phänomene beschränkt, die zu Zwecken der experimentellen Beobachtung hinlänglich voneinander isoliert werden können, entdeckte Freud eine neue Methode. Durch sie wurde es möglich, die Persönlichkeit als Ganzes zu erforschen. Gleichzeitig kann man verstehen, weshalb ein Mensch so und nicht anders handelt. Diese Methode, die Analyse von freien Assoziationen, von Träumen, Fehlleistungen und von Übertragungserscheinungen ist eine Beobachtungsweise, durch welche „private“ Daten, die nur der Selbstbeobachtung und Selbsterkenntnis zugänglich sind, in der Kommunikation zwischen Analysand und Analytiker „öffentlich“ gemacht und aufgewiesen werden können. Die psychoanalytische Methode hat hierdurch den Zugang zu solchen Phänomenen erschlossen, die bisher der Beobachtung unzugänglich waren. Zugleich enthüllte sie eine Fülle seelischer Inhalte, die nicht einmal durch Selbstbeobachtung erkannt werden konnten, weil sie verdrängt und vom Bewusstsein abgespalten waren. (Vgl. J. Dewey, 1946, S. 250-272, sowie Ph. B. Rice, 1935, S. 5-14 und 533-543.)
Während der Anfänge seiner Forschungen interessierte sich Freud hauptsächlich für neurotische Symptome. Je mehr die Psychoanalyse sich jedoch entwickelte, desto offensichtlicher wurde, dass ein neurotisches Symptom nur dann verstanden werden kann, wenn die Charakterstruktur, in die es eingebettet ist, verstanden wird. Statt des Symptoms wurde der neurotische Charakter zum wichtigsten Gegenstand der psychoanalytischen Theorie und Therapie. Im Verlauf der Erforschung des neurotischen Charakters schuf Freud die Basis für eine Wissenschaft vom Charakter (Charakterologie), die bis dahin Jahrhunderte lang von der Psychologie vernachlässigt und den Romanschriftstellern und Bühnenautoren überlassen worden war.
Obwohl die psychoanalytische Charakterologie noch in ihren Anfängen steckt, ist sie für die Entwicklung einer ethischen Theorie unentbehrlich. Die Begriffsbestimmung aller Tugenden und Laster muss in der herkömmlichen Ethik zweideutig bleiben, weil häufig genug mit dem gleichen Ausdruck verschiedene, ja zum Teil sogar gegensätzliche menschliche Haltungen bezeichnet werden. Ihre Zweideutigkeit verlieren diese Begriffe erst dann, wenn sie mit der Charakterstruktur derjenigen Person in Zusammenhang gebracht werden, der eine Tugend oder ein Laster zugeschrieben wird. Eine aus dem Zusammenhang mit dem Charakter herausgelöste „Tugend“ kann sich als etwas Nicht-Wertvolles herausstellen (so zum Beispiel „Demut“, wenn sie in Furcht oder in der Kompensierung unterdrückter Arroganz ihren Grund hat); ebenso kann auch ein „Laster“ in einem anderen Licht erscheinen, wenn es im Zusammenhang mit dem gesamten Charakter verstanden wird (so zum Beispiel „Arroganz“ als Ausdruck von Unsicherheit und Selbstunterschätzung). Für die Ethik ist eine solche Betrachtungsweise äußerst aufschlussreich. Es genügt nicht, und es ist irreführend, wenn man sich mit isolierten Tugenden und Lastern als Charakterzügen, die für sich betrachtet werden könnten, beschäftigt. Gegenstand der Ethik ist der Charakter, und nur in Bezug auf die Charakterstruktur als ganze können Wertsetzungen über [II-026] einzelne Charakterzüge oder Handlungen gemacht werden. Weit mehr als einzelne Tugenden oder Laster ist der tugendhafte oder lasterhafte Charakter der eigentliche Gegenstand der ethischen Forschung.
Nicht weniger aufschlussreich für die Ethik ist der psychoanalytische Begriff einer unbewussten Motivation. Dieser Begriff geht in seiner allgemeinen Form auf Leibniz und Spinoza zurück, doch Freud hat als erster die unbewussten Strebungen empirisch und bis ins einzelne untersucht. Er schuf damit die Grundlagen für eine Theorie der menschlichen Motivationen. Der Fortschritt des ethischen Denkens liegt in der Tatsache, dass nunmehr Werturteile über menschliche Verhaltensweisen hinsichtlich der Motivationen, die einer Handlung zugrunde liegen, gefällt werden konnten und nicht so sehr über die Handlung selbst. Das Verständnis für die unbewusste Motivation erschließt einen neuen Bereich der ethischen Forschung. Wie Freud bemerkt: „Nicht nur das Tiefste, auch das Höchste am Ich kann unbewusst sein“ (S. Freud, 1923b, S. 255) und zum ausschlaggebenden Motiv einer Handlung werden. Die ethische Forschung kann es sich nicht leisten, diese Tatsache zu übersehen.
Trotz vieler Möglichkeiten, welche die Psychoanalyse für die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Werten bietet, haben Freud und seine Schule diese Methode für die Erforschung ethischer Probleme nicht genutzt; vielmehr trugen sie noch wesentlich zur Verwirrung in ethischen Fragen bei. Diese Verwirrung hat ihren Ursprung in Freuds relativistischer Einstellung, derzufolge uns die Psychologie zwar helfen könne, die Motivation für Werturteile zu begreifen, doch sei sie außerstande, die Gültigkeit der Werturteile selbst zu begründen.
Freuds Relativismus zeigt sich am deutlichsten in seiner Lehre vom Über-Ich (Gewissen). Entsprechend seiner Lehre kann alles zum Inhalt des Gewissens werden, sofern es zufällig dem System von Verboten und Geboten angehört, die im väterlichen Über-Ich und in der kulturellen Überlieferung enthalten sind. In solcher Sicht ist das Gewissen nichts anderes als internalisierte Autorität. Freuds Analyse des Über-Ichs ist lediglich eine Analyse des „autoritären Gewissens“ (vgl. unten das Kapitel „Gewissen“).
Eine gute Illustration für eine solche relativistische Betrachtungsweise ist der Aufsatz Haltung eines amoralischen Psychologen von T. Schroeder (1944). Der Verfasser kommt zu dem Schluss, jede moralische Wertung sei „das Produkt einer emotionalen Morbidität, also starker sich widersprechender Impulse, die auf frühere emotionale Erfahrungen zurückgehen“. Zum anderen will der amoralische Psychiater „moralische Maßstäbe, Werte und Urteile durch eine psychiatrische und psycho-evolutionäre Klassifizierung der Impulse und der intellektuellen Methoden des moralisch Wertenden ersetzen“. Der Autor stellt schließlich die konfuse Behauptung auf, „amoralisch evolutionäre Psychologen haben keine absoluten oder ewigen Regeln für das, was recht oder unrecht sei“. Es könnte danach den Anschein haben, als ob die Wissenschaft „absolute und ewig gültige“ Behauptungen aufstellen wollte.
Seine Auffassung, Moral sei im wesentlichen eine Reaktionsbildung gegen das dem Menschen innewohnende Böse, unterscheidet sich kaum von Freuds Theorie des Über-Ichs. Freud behauptete, das Sexualstreben des Kindes sei dem Elternteil zugewandt, der dem anderen Geschlecht angehöre. Demzufolge hasse das Kind den [II-027] gleichgeschlechtlichen elterlichen Rivalen, und Feindseligkeit, Angst und Schuldgefühl entstünden daher notwendig schon in dieser frühen Phase (Ödipus-Komplex). Diese Theorie ist die säkularisierte Version der Erbsündenlehre. Freud folgerte: Da diese inzestuösen und mörderischen Impulse integrierende Bestandteile der menschlichen Natur seien, müsste der Mensch ethische Normen entwickeln, um überhaupt ein gesellschaftliches Leben möglich zu machen. Der Mensch stelle Normen für sein soziales Verhalten auf, um den Einzelnen und die Gruppe vor den Gefahren solcher Triebe zu schützen. Der Mensch tue dies zunächst in einem System von Tabus, später in komplizierten ethischen Systemen.
Freuds Auffassung ist jedoch keineswegs durchgehend relativistisch. Er glaubt leidenschaftlich an die Wahrheit. Sie ist das Ziel, dem der Mensch zustreben muss. Der Mensch besitze die Fähigkeiten hierzu, weil er von Natur aus vernunftbegabt sei. Diese anti-relativistische Einstellung zeigt sich deutlich in Freuds Ausführungen zur Frage der „Weltanschauung“ (S. Freud, 1933a, S. 188-192). Er tritt hier jener Theorie entgegen, wonach Wahrheit „nur das Produkt unserer eigenen Bedürfnisse, wie sie sich unter den wechselnden äußeren Bedingungen äußern müssen“, sei (a.a.O., S. 190). Eine solche „anarchistische“ Theorie „versagt beim ersten Schritt ins praktische Leben“ (a.a.O., S. 191). Sein Glaube an die Kraft der Vernunft und ihre Fähigkeit, die Menschheit zu einen und aus den Fesseln des Aberglaubens zu befreien, ist von dem gleichen Pathos getragen wie die Philosophie der Aufklärung. Dieser Glaube an die Wahrheit liegt auch der Auffassung seiner psychoanalytischen Heilmethode zugrunde. Danach ist Psychoanalyse der Versuch, die Wahrheit über sich selbst aufzudecken. So gesehen, setzt Freud jene Tradition des Denkens fort, die seit Buddha und Sokrates an die Wahrheit als diejenige Kraft glaubt, die den Menschen tugendhaft und frei oder – um in Freuds Terminologie zu sprechen – „gesund“ macht. Das Ziel der analytischen Behandlung ist, das Irrationale. (das Es) durch Vernunft (das Ich) zu ersetzen. Unter solchen Voraussetzungen kann die analytische Situation als eine Situation definiert werden, in der zwei Personen, nämlich der Analytiker und der Patient, die Wahrheit erforschen wollen. Ziel der Behandlung ist die Wiederherstellung der Gesundheit, die Heilmittel sind Wahrheit und Vernunft. Eine Situation gefordert zu haben, die auf radikaler Ehrlichkeit basiert, ist in einer Kultur, in der solche Offenheit Seltenheitswert hat, vielleicht das bedeutendste Zeugnis für Freuds Größe.
Auch in seiner Charakterologie vertritt Freud, wenn auch nicht ausdrücklich, eine nicht-relativistische Position. Er nimmt an, dass sich die Libido vom oralen über das anale zum genitalen Stadium entwickelt und dass im gesunden Menschen die genitale Orientierung dominant wird. Obwohl sich Freud nicht ausdrücklich auf ethische Werte bezieht, gibt es doch eine indirekte Verbindung: Die prägenitalen Orientierungen, für die eine abhängige, gierige und geizige Einstellung charakteristisch sind, sind gegenüber dem genitalen, das heißt dem produktiven, reifen Charakter ethisch minderwertig. Damit ist angedeutet, dass „Tugend“ das natürliche Ziel der menschlichen Entwicklung ist. Diese Entwicklung kann durch besondere, meist äußere Umstände blockiert werden, so dass es zur Bildung des neurotischen Charakters kommt. Unter normalen Bedingungen entwickelt sich jedoch der reife, unabhängige und produktive [II-028] Charakter, der zu Liebe und Arbeit fähig ist: Letzten Endes sind Tugend und Gesundheit für Freud ein und dasselbe.
Dieser Zusammenhang von Charakter und Ethik ist jedoch bei Freud nicht deutlich ausgesprochen. Er musste unklar bleiben, zum Teil wegen des Widerspruchs zwischen Freuds Relativismus und der stillschweigenden Anerkennung humanistischer ethischer Werte, zum Teil auch deshalb, weil Freud sich hauptsächlich mit dem neurotischen Charakter beschäftigte und der Analyse und Beschreibung des genitalen und reifen Charakters kaum Beachtung schenkte.
Das folgende Kapitel zielt nach einer kritischen Betrachtung der „Situation des Menschen“ und deren Bedeutung für die Charakterbildung auf eine detaillierte Analyse dessen, was dem genitalen Charakter bei Freud entspricht: die „produktive Orientierung“.
3. Die Natur des Menschen und sein Charakter
Dass ich ein Mensch bin,
teile ich mit andern Menschen.
Dass ich sehe und höre,
dass ich esse und trinke,
haben alle Tiere mit mir gemein.
Aber dass ich bin, ist nur mir eigen
und gehört nur mir
und niemandem sonst;
keinem anderen Menschen,
keinem Engel und auch nicht Gott –
außer insofern,
als ich eins bin mit Ihm.
(Meister Eckhart, Fragmente)
a) Die Situation des Menschen
Der einzelne Mensch repräsentiert die ganze Menschheit. Er ist ein spezifisches Exemplar der Gattung Mensch. Er ist „er“, er ist aber auch „alle“. Er ist ein Individuum mit seinen Besonderheiten und in diesem Sinne einmalig. Zugleich repräsentiert er alle Eigenarten der Menschheit. Seine individuelle Persönlichkeit wird zwangsläufig durch jene Eigentümlichkeiten der menschlichen Existenz bestimmt, die allen Menschen gemeinsam sind. Aus diesem Grunde muss die Erörterung der Situation des Menschen der Erörterung seiner Persönlichkeit vorausgehen.
1. Die biologische Schwäche des Menschen
Was das menschliche Dasein vom tierischen unterscheidet, ist zunächst etwas Negatives: Die instinktive Regulation beim Prozess der Anpassung an die ihn umgebende [II-030] Welt ist beim Menschen relativ schwach. Die Art und Weise, in der sich das Tier seiner Umwelt anpasst, bleibt stets gleich. Reicht das, was es an Instinkt hat, nicht aus, um sich der wechselnden Umwelt gegenüber zu behaupten, so stirbt die Gattung aus. Das Tier kann sich wechselnden Bedingungen anpassen, indem es sich selbst ändert, also auf autoplastische Weise; es kann sich aber nicht anpassen, indem es seine Umwelt verändert, also auf alloplastische Weise. Es lebt harmonisch, aber nicht in dem Sinn, dass es keinen Kampf kennt, sondern in dem Sinn, dass die angeborene Ausstattung es zu einem festen, unveränderlichen Teil der Welt macht. Es passt sich an, oder es stirbt aus.
Je unvollständiger und schwächer die instinktive Ausstattung des Tieres ist, desto entwickelter ist das Gehirn und demzufolge auch die Lernfähigkeit. Der Mensch tritt an der Stelle im Evolutionsprozess auf, an der das instinktive Anpassungsvermögen sein Minimum erreichte. Aber der Mensch erscheint mit neuen Eigenschaften, die ihn vom Tier unterscheiden. Er ist sich seiner selbst als eines eigenständigen Wesens bewusst, er hat die Fähigkeit, sich an Vergangenes zu erinnern und kann sich Zukünftiges vorstellen; er kann Gegenstände und Handlungen mit Symbolen belegen, seine Vernunft kann die Welt erfassen und verstehen, und mit seinem Vorstellungsvermögen kann er die Grenze seiner Sinne überschreiten. Der Mensch ist das hilfloseste aller Tiere. Diese biologische Schwäche ist aber zugleich die Basis für seine Stärke, denn sie ist primär die Ursache für die Ausbildung seiner spezifischen menschlichen Qualitäten.
2. Die existenziellen und historischen Dichotomien im Menschen
Bewusstsein seiner selbst, Vernunftbegabung und Vorstellungsvermögen haben jene „Harmonie“ zerrissen, die für das tierische Dasein charakteristisch ist. Ihr Auftreten hat den Menschen zu einer Abnormität gemacht, zu einer Laune des Universums. Er ist ein Teil der Natur, ist ihren physikalischen Gesetzen unterworfen und kann diese Gesetze nicht ändern; dennoch transzendiert er die übrige Natur. Er ist von der Natur abgeteilt, und zugleich ein Teil von ihr; er ist heimatlos und ist trotzdem an die gleiche Heimat gebunden, die er mit allen Geschöpfen gemeinsam hat. An einem zufälligen Ort und zu einem zufälligen Zeitpunkt wird er in die Welt geworfen, ebenso zufällig wird er aus ihr vertrieben. Wenn er sich seiner selbst bewusst wird, erkennt er die eigene Ohnmacht und die Grenzen seiner Existenz. Er sieht sein Ende voraus: den Tod. Nie kann er sich von der Dichotomie der eigenen Existenz freimachen. Er kann sich nicht von seiner Geistigkeit befreien, auch wenn er es wollte; er kann nicht von seinem Körper frei werden, solange er lebt – und sein Körper veranlasst ihn, leben zu wollen.
Die Vernunftbegabung, des Menschen Segen, ist auch sein Fluch. Sie zwingt ihn, sich unablässig mit der Lösung seiner an sich unlösbaren Dichotomie zu beschäftigen. Darin unterscheidet sich die menschliche Existenz von der aller übrigen Organismen. Sie befindet sich in einem Zustand ständiger und unvermeidlicher Unausgeglichenheit. Das Leben des Menschen kann nicht gelebt werden, indem die [II-031] Verhaltensmuster der Gattung einfach nur wiederholt werden; jeder einzelne muss es selbst leben. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich langweilt, unzufrieden ist und sich aus dem Paradies ausgeschlossen glaubt. Die eigene Existenz ist ihm zu einem Problem geworden, das er lösen muss und dem er nicht entfliehen kann. Er kann nicht auf einen vormaligen Zustand der Harmonie mit der Natur regredieren; er muss vorwärtsschreitend seine Vernunft entwickeln, bis er selbst zum Herrn über die Natur und zum Herrn über sich selbst geworden ist.
Das Aufkommen der Vernunftbegabung hat eine Dichotomie im Menschen geschaffen, die ihn zwingt, unablässig nach neuen Lösungen zu suchen. Die Dynamik seiner Geschichte ist mit der Existenz der Vernunft unlösbar verknüpft. Sie veranlasst ihn, sich zu entwickeln und dadurch die ihm eigene Welt zu schaffen, in der er sich mit sich selbst und seinen Mitmenschen zu Hause fühlen kann. Jede Stufe, die er erreicht, lässt ihn unbefriedigt und verwirrt ihn. Und diese Verwirrung zwingt ihn, neue Lösungen anzustreben. Einen angeborenen „Fortschrittstrieb“ gibt es beim Menschen nicht. Es ist der Widerspruch der eigenen Existenz, der den Menschen auf der begonnenen Bahn fortschreiten lässt. Da er das Paradies – die Einheit mit der Natur – verloren hat, wurde er zum ewigen Wanderer (Odysseus, Ödipus, Abraham, Faust). Er ist gezwungen, vorwärtszugehen und muss mit andauernder Anstrengung das Unbekannte zu erkennen suchen, indem er die Lücken seines Wissens mit Antworten ausfüllt. Über sich und den Sinn der eigenen Existenz muss er sich selbst Rechenschaft geben. Um diesen inneren Zwiespalt zu überwinden, drängt es ihn – getrieben von einem Willen nach „Absolutheit“ – eine andere Art von Harmonie zu finden, die den Fluch von ihm nimmt, durch den er von der Natur, seinen Mitmenschen und sich selbst getrennt wurde.
Diese Spaltung in der Natur des Menschen führt zu Dichotomien, die ich „existenzielle“[16] nenne, weil sie in der Existenz des Menschen selbst wurzeln. Es sind Widersprüche, die der Mensch nicht aufheben, auf die er aber entsprechend seinem Charakter und seiner Kultur verschieden reagieren kann.
Der grundlegende existenzielle Widerspruch ist der von Leben und Tod. Die Tatsache, dass wir sterben müssen, ist unabwendbar. Der Mensch ist sich dessen bewusst, und dieses Bewusstsein beeinflusst sein Leben entscheidend. Der Tod aber ist der absolute Gegensatz zum Leben. Er ist etwas ihm grundsätzlich Fremdes, das sich mit keiner Erfahrung von Leben vereinen lässt. Gleichgültig, was wir über den Tod wissen, es ändert nichts an der Tatsache, dass der Tod für das Leben selbst keine Bedeutung hat und dass uns nichts anderes übrigbleibt, als ihn als Tatsache anzunehmen, und das heißt – aus der Sicht des Lebens – als Niederlage. Für sein Leben gibt der Mensch alles, was er hat. „Der freie Mensch denkt über nichts weniger nach als über den Tod“ (Spinoza, Ethik, Teil IV, 67. Lehrsatz). Der Mensch hat immer wieder [II-032] versucht, diese Dichotomie mit Hilfe von Ideologien zu leugnen. Wenn das Christentum eine unsterbliche Seele fordert, dann leugnet es die tragische Tatsache, dass des Menschen Leben mit dem Tod endet.
Aus der Tatsache, dass der Mensch sterblich ist, folgt ein weiterer Widerspruch. Zwar trägt jedes menschliche Wesen die Fülle der menschlichen Möglichkeiten in sich, jedoch erlaubt seine kurze Lebensspanne auch unter den günstigsten Bedingungen nicht ihre volle Verwirklichung. Erst dann, wenn die Lebensspanne des Einzelnen mit derjenigen der Menschheit identisch wäre, könnte er auch an der menschlichen Entwicklung teilhaben, die sich im Gesamtprozess der Geschichte vollzieht. Da das Leben eines Menschen an einem zufälligen Punkt im Entwicklungsprozess der Menschheit beginnt und endet, gerät es in einen tragischen Konflikt mit dem Anspruch jedes Einzelnen, all seine Möglichkeiten verwirklichen zu können. Was ein Mensch verwirklichen könnte, und was er tatsächlich verwirklicht – diesen Widerspruch ahnt er zumindest. Aber auch hier versuchen Ideologien, den Widerspruch aufzulösen oder zu verleugnen, indem sie behaupten, die Erfüllung des Lebens erfolge erst nach dem Tod, oder aber die eigene geschichtliche Periode sei die letzte und der krönende Abschluss der Menschheitsentwicklung. Eine andere Ideologie sieht den Sinn des Lebens nicht in seiner vollsten Entfaltung, sondern im Dienst an der Gesellschaft und in gesellschaftlichen Pflichten. Entwicklung, Freiheit und Glück des Einzelnen sind hier untergeordnet oder werden als bedeutungslos betrachtet im Vergleich mit dem Wohl des Staates, der Gemeinschaft oder wie auch immer diese ewige Macht symbolisiert wird, die das Individuum transzendiert.
Der Mensch ist allein und zugleich steht er in Beziehung. Er ist insofern allein, als er ein einmaliges Wesen ist, das mit keinem anderen identisch ist und das sich seiner selbst als einer selbständigen Größe bewusst ist. Er muss allein sein, wenn er ausschließlich kraft seiner Vernunft Urteile fällen oder Entscheidungen treffen soll. Und doch kann er es nicht ertragen, allein zu sein und ohne Beziehung zu seinen Nächsten. Sein Glück hängt von der Solidarität ab, die er mit seinen Mitmenschen, mit vergangenen und zukünftigen Generationen empfindet.
Existenzielle Widersprüche unterscheiden sich grundsätzlich von den vielen historischen Widersprüchen im Leben des Einzelnen und der Gesellschaft. Historische Dichotomien gehören nicht notwendig zur menschlichen Existenz. Der Mensch hat sie geschaffen, er kann sie sogleich oder zu einem späteren Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte lösen. So ist auch der gegenwärtige Widerspruch zwischen dem Überfluss technischer Möglichkeiten zur Befriedigung materieller Bedürfnisse und der Unfähigkeit, diese Möglichkeiten ausschließlich für friedliche Zwecke und zum Wohle der Menschen zu nutzen, lösbar. Es ist kein notwendiger Widerspruch; vielmehr ist er auf einen Mangel an Mut und Einsicht zurückzuführen. Ein weiteres Beispiel für einen scheinbar unlösbaren Widerspruch ist die Einrichtung der Sklaverei im alten Griechenland. Ihre Abschaffung wurde erst zu dem geschichtlichen Zeitpunkt möglich, als die materielle Basis für die Gleichberechtigung aller Menschen erreicht war.
Die Unterscheidung zwischen existenziellen und historischen Widersprüchen ist äußerst wichtig, da ihre Verwechslung weitreichende Folgen hat. Diejenigen, die am Fortbestehen historischer Widersprüche interessiert waren, suchten zu beweisen, dass [II-033] es sich hier um existenzielle und demzufolge um unabänderliche Widersprüche handle. Sie wollten die Menschen überzeugen, dass das, „was nicht sein darf, auch nicht sein kann“; folglich müsse sich der Mensch mit seinem tragischen Schicksal abfinden. Aber trotz der Vermischung dieser beiden Arten von Widersprüchen suchte der Mensch für beide eine Lösung. Es ist eine der seltsamen Eigenschaften des menschlichen Geistes, dass er sich nicht passiv verhalten kann, sobald er einem Widerspruch gegenübersteht. Er will jeden Widerspruch überwinden. Dieser Tatsache entspringt der gesamte menschliche Fortschritt. Will man den Menschen daran hindern, handelnd auf das Wahrnehmen von Widersprüchen zu reagieren, so muss das Vorhandensein der Widersprüche selbst bestritten werden. Widersprüche zu harmonisieren und auf diese Weise zu leugnen, ist die Funktion der Rationalisierungen im Leben des Einzelnen und die Funktion der Ideologien (der gesellschaftlich geformten Rationalisierungen) im Leben der Gesellschaft. Wenn jedoch der menschliche Geist nur durch rationale Antworten, nur durch die Wahrheit allein befriedigt werden könnte, so würden diese Ideologien wirkungslos bleiben. Aber es gehört zu seinen Eigentümlichkeiten, das als Wahrheit hinzunehmen, was in seinem Kulturkreis von der Mehrheit gedacht oder von mächtigen Autoritäten gefordert wird. Sobald die harmonisierenden Ideologien durch den Konsens einer Mehrheit oder durch eine Autorität gestützt werden, wird der menschliche Geist zwar beschwichtigt, jedoch der Mensch selbst ist nicht vollkommen zufrieden.
Der Mensch kann auf historische Widersprüche reagieren, indem er sie durch sein eigenes Handeln auflöst. Existenzielle Dichotomien dagegen kann er nicht auflösen, sondern nur in verschiedener Weise auf sie reagieren. Er kann sie durch beruhigende und beschönigende Ideologien beschwichtigen. Er kann seiner Ruhelosigkeit durch rastlosen Aktivismus, sei es in Vergnügungen oder in der Arbeit, zu entfliehen suchen. Er kann seine Freiheit aufzugeben suchen, indem er sich zu einem Instrument außer ihm liegender Mächte macht und sein Selbst in diesen aufgehen lässt.
Trotzdem bleibt er unzufrieden, angsterfüllt und ruhelos. Es gibt nur eine Lösung: der Wahrheit ins Auge zu sehen und sein fundamentales Alleinsein und seine Einsamkeit in einem Universum, das dem menschlichen Schicksal gegenüber gleichgültig ist, anzuerkennen und zu erkennen, dass es keine den Menschen transzendierende Macht gibt, die sein Problem für ihn lösen kann. Der Mensch muss die Verantwortung für sich selbst akzeptieren und sich damit abfinden, dass er seinem Leben nur durch die Entfaltung seiner eigenen Kräfte Sinn geben kann. Aber dieser Sinn bedeutet nicht Gewissheit; das Suchen nach einem Sinn wird durch den Wunsch nach Gewissheit sogar erschwert. Ungewissheit ist gerade die Bedingung, die den Menschen zur Entfaltung seiner Kräfte zwingt. Sieht er der Wahrheit furchtlos ins Auge, dann erfasst er, dass sein Leben nur den Sinn hat, den er selbst ihm gibt, indem er seine Kräfte entfaltet: indem er produktiv lebt. Nicht nur ständige Wachsamkeit, Tätigsein, und unermüdliches Bemühen bewahren uns davor, in der wesentlichen Aufgabe zu versagen: in der Aufgabe nämlich, unsere Kräfte innerhalb der Grenzen, die durch die Gesetze unserer Existenz gezogen sind, voll zu entwickeln. Der Mensch wird nie aufhören, immer wieder verwirrt zu sein, sich zu wundern und neue Fragen zu stellen. Nur wenn er die Situation des Menschen, die seiner Existenz innewohnenden Widersprüche und [II-034] seine Fähigkeit zur Entfaltung seiner Kräfte erfasst, kann er seine Aufgabe lösen: er selbst und um seiner selbst willen zu sein und glücklich zu werden durch die volle Verwirklichung der ihm eigenen Möglichkeiten – seiner Vernunft, seiner Liebe und produktiven Arbeit.
Nachdem wir die Widersprüche erörtert haben, die der menschlichen Existenz innewohnen, können wir uns der am Anfang dieses Kapitels aufgestellten Behauptung zuwenden, die Erörterung der Situation des Menschen müsse der Erörterung seiner Persönlichkeit vorangehen. Der genauere Sinn dieser Behauptung kann mit der Aussage verdeutlicht werden, dass sich die Psychologie auf eine philosophisch-anthropologische Anschauung der menschlichen Existenz gründen muss.
Das Erstaunlichste am menschlichen Verhalten ist die ungeheure Intensität der Leidenschaften und Strebungen. Freud erkannte dies schärfer als andere und versuchte es mit den Begriffen des mechanistisch-naturalistischen Denkens seiner Zeit zu erklären. Er nahm an, dass auch jene Leidenschaften, die nicht direkt als Ausdruck des Selbsterhaltungstriebes und des Sexualtriebes (später formulierte er: des Eros und des Todestriebes) zu erkennen wären, doch nur indirekte und verwickelte Manifestationen dieser instinktiven biologischen Triebe seien. So bestechend seine Annahmen auch waren, so überzeugen sie jedoch nicht, wenn die Tatsache geleugnet wird, dass ein großer Teil der leidenschaftlichen Strebungen des Menschen nicht mit der Kraft seiner Triebe erklärt werden kann. Selbst wenn Hunger, Durst und Sexualtrieb vollkommen befriedigt sind, so ist doch der Mensch selbst nicht befriedigt. Im Gegensatz zum Tier sind seine dringendsten Probleme dann noch nicht gelöst, sondern sie beginnen erst. Er strebt nach Macht oder nach Liebe oder nach Zerstörung, er setzt sein Leben für religiöse, politische, humanistische Ideale ein, und diese Bestrebungen begründen und charakterisieren das Besondere des menschlichen Lebens. Der Mensch lebt tatsächlich „nicht vom Brot allein“.
Im Unterschied zu Freuds mechanistisch-naturalistischer Erklärung wurde diese Tatsache auch in dem Sinn interpretiert, dass der Mensch ein ihm innewohnendes religiöses Bedürfnis habe, das nicht durch seine natürliche Existenz bedingt sei, sondern durch etwas, das ihn transzendiere und das von übernatürlichen Mächten herrühre. Letztere Annahme ist jedoch unnötig, da das volle Verständnis der Situation des Menschen genügt, um dieses Phänomen zu erklären.
Die Disharmonie der Existenz des Menschen erzeugt Bedürfnisse, die weit über jene hinausgehen, die in seinem animalischen Ursprung begründet liegen.[17] Diese Bedürfnisse bewirken einen drängenden Wunsch, die Einheit und das Gleichgewicht zwischen sich und der übrigen Natur wiederherzustellen. Der Mensch macht den Versuch, diese Einheit und dieses Gleichgewicht vor allem gedanklich wieder zu erreichen. Er konstruiert ein umfassendes Weltbild, das ihm als Bezugsrahmen dient, von dem er eine Antwort auf die Fragen nach seinem Platz in der Welt und seinen Aufgaben ableiten kann. Derartige Gedankensysteme sind jedoch nicht ausreichend. Wenn der Mensch nur körperloser Intellekt wäre, könnte er sein Ziel durch ein umfassendes Gedankensystem erreichen. Da er aber ein Wesen ist, das sowohl Körper wie Geist besitzt, muss er auf die Widersprüche seiner Existenz nicht nur denkend reagieren, sondern auch im Lebensvollzug, in seinem Fühlen und Handeln. Er muss [II-035] danach streben, Einheit und Einssein auf allen Ebenen seines Seins zu erfahren, um so ein neues Gleichgewicht zu finden. Deshalb erfordert ein befriedigendes Orientierungssystem nicht nur intellektuelle Elemente, sondern auch solche des Gespürs und des Gefühls, die in allen Bereichen des menschlichen Lebens aktiv zu verwirklichen sind. Die Hingabe an ein Ziel, an eine Idee oder an eine Macht, die den Menschen transzendiert, wie zum Beispiel Gott, ist der Ausdruck dieses Bedürfnisses nach Ganzheitlichkeit im Lebensvollzug.[18]
Die Antworten auf das menschliche Bedürfnis nach einer Orientierung und nach Hingabe[19] unterscheiden sich dem Inhalt und der Form nach weitgehend. Es gibt primitive Systeme, wie etwa den Animismus und Totemismus, bei denen Naturgegenstände und Ahnen die Antworten für den nach Sinn Suchenden sind. Es gibt nicht-theistische Systeme, wie den Buddhismus, die zumeist als religiös bezeichnet werden, obwohl ihre ursprüngliche Form keinen Gottesbegriff enthält. Es gibt philosophische Systeme wie die Stoa, und es gibt monotheistische Religionen, die sich auf eine Gottesvorstellung berufen. Die Untersuchung dieser verschiedenen Systeme wird durch eine terminologische Schwierigkeit behindert. Man könnte alle diese Systeme als „religiös“ bezeichnen, wenn dieses Wort nicht aus historischen Gründen mit einem theistischen System gleichgesetzt würde, einem System, das Gott zum Mittelpunkt hat. Es gibt in unserer Sprache kein Wort, um das Gemeinsame der theistischen und der nicht-theistischen Systeme zu bezeichnen – das Gemeinsame aller Denksysteme, die auf die menschliche Frage nach Sinn und auf den menschlichen Versuch, dem Leben Sinn zu geben, antworten wollen. In Ermangelung eines besseren Wortes nenne ich solche Systeme hier „Rahmen der Orientierung und Hingabe“.[20]
Vor allem möchte ich betonen, dass es noch viele andere Strebungen gibt, die zwar als völlig weltlich angesehen werden, nichtsdestoweniger aber in dem gleichen Bedürfnis wurzeln, aus dem religiöse und philosophische Systeme erwachsen. Betrachten wir unsere gegenwärtige Zeit: Es gibt in unserem eigenen Kulturraum Millionen Menschen, die sich dem Streben nach Erfolg und Prestige hingegeben haben. In anderen Kulturräumen sahen und sehen wir eine fanatische Hingabe an diktatorische Systeme, die auf Eroberung und Beherrschung hinzielen. Erstaunlich ist die Intensität dieser Leidenschaften, die oft sogar stärker ist als der Selbsterhaltungstrieb. Oft täuschen die weltlichen Inhalte dieser Ziele, so dass wir sie als Folgen sexueller oder anderer quasi-biologischer Strebungen erklären. Ist es jedoch nicht auffällig, dass diese weltlichen Ziele mit der gleichen Intensität und dem gleichen Fanatismus verfolgt werden, wie wir es in den Religionen beobachten können; dass also zwar die Inhalte dieser weltlichen Systeme der Orientierung und Hingabe verschieden sind, nicht aber das ihnen zugrunde liegende Bedürfnis, auf das sie Antwort zu geben versuchen? In unserem Kulturraum täuscht das Bild besonders, weil die meisten Menschen sich zum Monotheismus „bekennen“, während ihre tatsächliche Hingabe Systemen gilt, die dem Totemismus oder der Götzenanbetung näherstehen als irgendeiner Form des Christentums.
Aber wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Das Verständnis der „religiösen“ Natur dieser kulturell bedingten weltlichen Strebungen ist der Schlüssel zum Verständnis der Neurosen und irrationalen Strebungen. Die letzteren haben wir als [II-036] Antworten – individuelle Antworten – auf das menschliche Suchen nach Orientierung und Hingabe zu betrachten. Ein Mensch, dessen Erfahrung durch seine Fixierung an seine Familie bestimmt ist, huldigt in Wahrheit einem primitiven Ahnenkult. Der einzige Unterschied zwischen ihm und Millionen von Ahnenanbetern besteht darin, dass sein System privaten Charakter hat und nicht kulturell bedingt ist. Freud erkannte den Zusammenhang zwischen Religion und Neurose und erklärte die Religion als eine Form der Neurose. Demgegenüber folgern wir, dass eine Neurose als eine besondere Form der Religion erklärt werden kann, die sich von dieser vor allem dadurch unterscheidet, dass sie individuell ist und keine vorgeprägten Merkmale hat. Wir kommen daher in Bezug auf das allgemeine Problem der menschlichen Motivation zu dem Ergebnis, dass zwar das Bedürfnis nach einem System der Orientierung und Hingabe allen Menschen gemeinsam ist, dass aber die Inhalte der Systeme, welche diesem Bedürfnis entgegenkommen, verschieden sind. Diese Unterschiede sind Unterschiede im Wert. Der reife, produktive, vernünftige Mensch wird sich für ein System entscheiden, das ihm erlaubt, reif, produktiv und vernünftig zu sein. Der in seiner Entwicklung Gehemmte muss auf primitive und irrationale Systeme zurückgreifen, die seine Abhängigkeit und Irrationalität verfestigen. Er bleibt auf einer Stufe stehen, die die besten Repräsentanten bereits vor Tausenden von Jahren überwunden hatten.
Da das Bedürfnis nach einem System der Orientierung und Hingabe einen wesentlichen Bestandteil des menschlichen Daseins ausmacht, ist die Intensität dieses Bedürfnisses zu verstehen. Tatsächlich gibt es keine stärkere Energiequelle im Menschen. Der Mensch kann nicht frei entscheiden, ob er „Ideale“ haben will oder nicht, aber er hat die freie Wahl zwischen verschiedenen Arten von Idealen, zwischen der Möglichkeit, Macht und Destruktion zu verehren oder sich Vernunft und Liebe hinzugeben. Alle Menschen sind „Idealisten“ und suchen etwas, das über die Befriedigung des rein Körperlichen hinausgeht. Sie unterscheiden sich nur in den Idealen, an die sie glauben. Sowohl die höchsten wie auch die ganz teuflischen Manifestationen des menschlichen Geistes sind nicht Ausdruck des Fleisches, sondern des Geistes, das heißt, dieses „Idealismus“. Gefährlich und irreführend ist deshalb die relativistische Auffassung, das bloße Vorhandensein eines Ideals oder eines religiösen Gefühls sei an sich schon wertvoll. Wir müssen alle Ideale, einschließlich derjenigen, die in weltlichen Ideologien in Erscheinung treten, als Ausdruck desselben menschlichen Bedürfnisses betrachten und sie danach beurteilen, wieviel Wahrheit sie enthalten, in welchem Maße sie der Entfaltung menschlicher Kräfte dienen und bis zu welchem Grade sie dem menschlichen Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und Harmonie in seiner Welt tatsächlich entgegenkommen. Abschließend sei wiederholt, dass die Beweggründe menschlichen Handelns nur aus der Situation des Menschen verstanden werden können.
b) Die Persönlichkeit
Alle Menschen sind gleich, da sie alle in der gleichen „menschlichen Situation“ mit den ihr innewohnenden existenziellen Dichotomien stehen. Jeder unterscheidet sich [II-037] vom anderen durch die Art und Weise, in der er sein menschliches Problem löst. Charakteristisch für die menschliche Existenz ist die unbegrenzte Verschiedenheit der Persönlichkeiten.
Unter Persönlichkeit verstehe ich die Totalität ererbter und erworbener psychischer Eigenschaften, die den Einzelnen charakterisieren und das Einmalige dieses Einzelnen ausmachen. Der Unterschied zwischen ererbten und erworbenen Eigenschaften entspricht im Großen und Ganzen dem Unterschied zwischen Temperament, Begabung und allen konstitutionellen psychischen Eigenschaften einerseits und dem Charakter andererseits. Während Temperamentsunterschiede für die Ethik bedeutungslos sind, bilden Charakterunterschiede das eigentliche Problem der Ethik. Sie zeigen den Grad an, bis zu welchem der einzelne in der Kunst des Lebens erfolgreich war. Um Missverständnisse hinsichtlich des Begriffs „Temperament“ und „Charakter“ auszuschließen, beginnen wir einleitend mit einer kurzen Erörterung des Begriffs „Temperament“.
1. Das Temperament
Hippokrates unterschied vier Temperamente: das cholerische, sanguinische, melancholische und phlegmatische. Das sanguinische und das cholerische Temperament sind Reaktionsweisen, die durch leichte Erregbarkeit und schnellen Interessenwandel gekennzeichnet sind. Das Interesse ist beim Sanguiniker schwach, beim Choleriker stark. Im Gegensatz hierzu zeichnet sich das phlegmatische und das melancholische Temperament durch eine zwar beharrliche, jedoch langsame Erregbarkeit des Interesses aus; es ist beim Phlegmatiker schwach, beim Melancholiker stark.[21] Hippokrates sah diese verschiedenen Reaktionsweisen als Ausdruck verschiedener somatischer Quellen. (Interessanterweise haben sich im populären Gebrauch nur die negativen Aspekte dieser Temperamente erhalten: Cholerisch heißt soviel wie leicht verärgert, melancholisch soviel wie niedergeschlagen, sanguinisch soviel wie leichtsinnig und phlegmatisch soviel wie träge.) Diese Einteilung der Temperamente wurde bis zur Zeit von Wundt von den meisten Erforschern der Temperamente übernommen. Die wichtigsten modernen Darstellungen der verschiedenen Temperamente sind jene von Jung, Kretschmer und Sheldon (vgl. auch Charles William Morris’ Anwendung der Temperamente auf kulturelle Größen in Ch. W. Morris, 1942).
Über die Wichtigkeit weiterer Forschungen auf diesem Gebiet kann kein Zweifel bestehen, insbesondere hinsichtlich der Wechselbeziehung zwischen Temperament und somatischen Prozessen. Unbedingt notwendig ist jedoch eine klare Unterscheidung zwischen Charakter und Temperament, denn die Verwechslung der beiden Begriffe hat sowohl auf dem Gebiet der Charakterologie als auch auf dem der Temperamentforschung weitere Erkenntnisse verhindert. [II-038]
Das Temperament bezieht sich auf die Art und Weise einer Reaktion; es ist konstitutionell und nicht änderbar. Der Charakter dagegen ist wesentlich durch die Erfahrungen geprägt, besonders durch solche aus der Kindheit; er ist bis zu einem gewissen Grade durch neue Einsichten und neue Arten von Erfahrungen änderbar. Hat jemand zum Beispiel ein cholerisches Temperament, dann wird die Art und Weise seiner Reaktion „schnell und stark“ sein. Auf was er jedoch schnell und stark reagiert, hängt von seiner Art der Bezogenheit, von seinem Charakter ab. Ist er ein produktiver, gerechter, liebender Mensch, dann wird er schnell und stark reagieren, wenn er liebt, wenn er durch eine Ungerechtigkeit erzürnt oder wenn er von einer neuen Idee beeindruckt wird. Ist er aber ein destruktiver oder sadistischer Charakter, wird er in seiner Destruktivität oder in seiner Grausamkeit schnell und stark reagieren.
Die Verwechslung von Temperament und Charakter hat für die ethische Theorie schwerwiegende Folgen. Die Vorliebe für ein bestimmtes Temperament ist eine Frage des Geschmacks, der Charakter hingegen ist ethisch gesehen von größter Wichtigkeit. Ein Beispiel mag helfen, dies zu klären: Göring und Himmler waren Menschen verschiedenen Temperaments; Göring war zyklothym, Himmler schizothym. Vom Standpunkt des persönlichen Geschmacks mochte jemand, der sich durch ein zyklothymes Temperament angezogen fühlte, Göring „sympathischer“ finden als Himmler und umgekehrt. Vom Charakter her beurteilt hatten beide Männer eine Eigenschaft gemeinsam: Sie waren ehrgeizige Sadisten. Deshalb waren beide ethisch gesehen gleich böse. Umgekehrt könnte jemand unter Menschen mit produktiven Charakteren ein cholerisches Temperament dem sanguinischen vorziehen; aber ein solches Urteil könnte kein Werturteil über diese beiden Menschen sein.[22]
Bei der Anwendung von C. G. Jungs Temperamentsbegriffen des „Introvertierten“ und „Extrovertierten“ beobachten wir häufig die gleiche Verwechslung. Diejenigen, die dem Extrovertierten den Vorzug geben, beschreiben den Introvertierten als gehemmt und neurotisch; die anderen, die den Introvertierten vorziehen, beschreiben den Extrovertierten als oberflächlich, flach und unstetig. Der Fehler liegt darin, dass [II-039] man einen „guten“ Menschen des einen Temperaments mit einem „schlechten“ des anderen vergleicht und den Wertunterschied dem Temperamentsunterschied zuschreibt.
Es ist offensichtlich, dass die Verwechslung von Temperament und Charakter die Ethik beeinflussen musste. Sie verdammte ganze Rassen, deren Temperament sich von dem unsrigen unterscheidet; sie hat andererseits den Relativismus gefördert, indem sie annahm, dass der Charakter ebenso Geschmackssache sei wie das Temperament.
Bevor wir die ethische Theorie erörtern, wollen wir uns dem Charakterbegriff zuwenden. Er ist zugleich Gegenstand der ethischen Beurteilung wie auch der ethischen Entwicklung des Menschen. Wir müssen uns aber auch hier erst von althergebrachten Verwechslungen freimachen, die sich in diesem Falle auf die Unterschiede zwischen einem dynamischen und einem behavioristischen Charakterbegriff konzentrieren.
2. Der Charakter
Der dynamische Charakterbegriff
Charakterzüge wurden und werden von behavioristisch orientierten Psychologen so angesehen, als seien sie dasselbe wie Verhaltensweisen. Charakter wird folglich definiert als „die Art und Weise des Verhaltens, die ein bestimmtes Individuum charakterisiert“ (L. E. Hinsie und J. Shatzky, 1940), während andere Autoren, wie W. McDougall, R. G. Gordon und E. Kretschmer, den Akzent auf das dynamische und zielstrebige Element der Charakterzüge legen.
Freud entwickelte nicht nur die erste, sondern auch die konsequenteste und umfassendste Charaktertheorie. Für ihn ist Charakter ein System von Strebungen, die das Verhalten bestimmen, mit ihm jedoch nicht identisch sind. Um Freuds dynamischen Charakterbegriff zu würdigen, ist ein Vergleich zwischen Verhaltensweisen und Charakterzügen hilfreich. Verhaltensweisen sind Handlungen, die von einem Dritten beobachtet werden können. So wurde beispielsweise die Verhaltensweise „Mutigsein“ als ein Verhalten definiert, das auf ein Ziel gerichtet ist, dies erreichen will und sich nicht durch Gefahren abschrecken lässt, die der eigenen Bequemlichkeit, der Freiheit oder auch dem eigenen Leben erwachsen könnten. Sparsamkeit – ein weiteres Beispiel – wurde als Verhaltensweise definiert, die darauf hinzielt, Geld oder andere materielle Werte zu sparen. Fragt man jedoch nach der Motivation, insbesondere nach der unbewussten Motivation solcher Verhaltensweisen, so kommt man zu dem Schluss, dass einer bestimmten Verhaltensweise zahlreiche und von Grund auf verschiedene Charakterzüge zugrunde liegen können. Mutiges Verhalten kann durch Ehrgeiz motiviert sein, so dass jemand in bestimmten Situationen sein Leben aufs Spiel setzt, nur um sein Verlangen nach Bewunderung zu befriedigen. Mutiges Verhalten kann durch selbstmörderische Impulse ausgelöst werden, die jemanden dazu bringen, sich einer Gefahr auszusetzen, weil ihm bewusst oder unbewusst nichts an seinem Leben liegt und er sich selbst zerstören will. Ferner kann das völlige Fehlen von Einschätzungsfähigkeit die eigentliche Ursache sein, so dass einer mutig handelt, weil [II-040] er sich die Gefahren nicht vorstellen kann, die ihn erwarten. Und schließlich kann Mutigsein ein Verhalten sein, das auf einer tiefen Hingabe an eine Idee oder ein Ziel beruht, für die sich ein Mensch einsetzt. Diese Motivation wird meistens als Grund eines mutigen Verhaltens angenommen. Oberflächlich betrachtet ist das Verhalten trotz der Verschiedenartigkeit der Motivationen in allen Fällen das gleiche. Wie gesagt, nur „oberflächlich“! Wer das Verhalten genauer beobachtet, wird feststellen, dass der Unterschied in der Motivation auch feine Unterschiede im Verhalten bedingt. Ein Offizier z. B. wird in der Schlacht anders handeln, je nachdem, ob sein Mut durch die Hingabe an eine Idee oder durch seinen Ehrgeiz motiviert ist: Im ersteren Fall würde er nicht angreifen, wenn das Risiko in keinem Verhältnis zum erreichbaren taktischen Ziel steht. Ist er aber von Ehrgeiz getrieben, dann kann ihn diese Leidenschaft allen Gefahren gegenüber blind machen, die ihm und seinen Soldaten drohen. In diesem Fall hätte sein mutiges Verhalten offensichtlich etwas recht Zweideutiges an sich. Als zweites Beispiel nannte ich „Sparsamkeit“. Jemand kann sparsam sein, weil seine wirtschaftlichen Verhältnisse es erfordern; oder er kann sparsam sein, weil er einen geizigen Charakter hat, wobei dann das Sparen ungeachtet seiner Notwendigkeit zum Selbstzweck wird. Auch hier würde die Motivation verschiedene Verhaltensweisen bewirken. Im ersten Fall wäre der Betreffende durchaus fähig, eine Situation, in der Sparen notwendig ist, von einer anderen zu unterscheiden, in der es klüger ist, Geld auszugeben; im letzteren wird er ungeachtet der objektiven Notwendigkeit sparen. Ein weiterer Faktor, der durch die Verschiedenheit der Motivation bestimmt wird, zeigt sich in der Möglichkeit, ein Verhalten vorauszusagen. Von einem „mutigen“ Soldaten, der ehrgeizig ist, können wir annehmen, dass er nur dann mutig sein wird, wenn sein Mut Anerkennung finden wird. Von einem Soldaten, der aus Hingabe an eine Sache mutig ist, können wir voraussagen, dass die Frage, ob sein Mut anerkannt wird oder nicht, sein Verhalten kaum beeinflusst.
Mit dem Freudschen Begriff der unbewussten Motivation eng verwandt ist seine Lehre von der triebhaften Natur der Charakterzüge. Freud sah, was große Romanciers und Dramatiker seit jeher wussten: dass man es nämlich – wie Balzac es formulierte – bei der Erforschung des Charakters „mit Kräften zu tun hat, die für den Menschen bestimmend sind“. Die Art und Weise, wie jemand denkt, fühlt und handelt, ist nicht nur das Ergebnis vernunftbestimmter Antworten auf die Realität, sondern wird weitgehend durch die Eigenart seines Charakters bestimmt: „Des Menschen Schicksal ist sein Charakter.“ Freud erkannte die dynamische Qualität der Charakterzüge, und dass die Charakterstruktur eines Menschen die besondere Richtung anzeigt, in die seine Energie im Vollzug des Lebens gelenkt wird.
Diese dynamische Eigenart der Charakterzüge suchte Freud zu erklären, indem er seine Charakterologie mit seiner Libido-Theorie verband. Die in den Naturwissenschaften des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts vorherrschende materialistische Denkweise setzte voraus, dass bei Natur- und psychischen Phänomenen die Energie als eine Substanz und nicht als eine Beziehungsgröße aufzufassen sei. Im Einklang mit dieser Auffassung hielt Freud den Sexualtrieb für die Energiequelle des Charakters. Die verschiedenen Charakterzüge erklärte er mit Hilfe einiger komplizierter und geistreicher Hypothesen als „Sublimierungen“ des Sexualtriebs, oder als [II-041] „Reaktionsbildungen“ gegen die verschiedenen Formen des Sexualtriebs. Er interpretierte die dynamische Natur der Charakterzüge als Ausdruck ihrer libidinösen Quelle. Entsprechend der neuen Erkenntnisse der Natur- und Sozialwissenschaften kam die Psychoanalyse zu einer Auffassung, die nicht mehr von der Vorstellung eines primär isolierten Individuums ausging, sondern von der Beziehung des Menschen zu seinen Mitmenschen, zur Natur und zu sich selbst. Man nahm an, dass gerade diese Beziehung die Energien lenkt und leitet, die sich in den leidenschaftlichen Strebungen des Menschen manifestieren. H. S. Sullivan, einer der Pioniere dieser neuen Sicht, definierte die Psychoanalyse dementsprechend als „Erforschung der zwischenmenschlichen Beziehungen“.
Die auf den folgenden Seiten entwickelte Theorie folgt Freuds Charakterologie in wesentlichen Punkten. Zunächst in der Annahme, dass jedem Verhalten Charakterzüge zugrunde liegen, die aus eben diesem Verhalten gefolgert werden müssen. Ferner, dass dies Kräfte sind, deren sich der Betreffende – seien sie auch noch so stark – nicht bewusst zu sein braucht. Meine Theorie folgt Freud auch darin, dass nicht der einzelne Charakterzug das ist, was den Charakter bestimmt, sondern die gesamte Charakterorganisation, von der die einzelnen Charakterzüge sich herleiten lassen. Diese Charakterzüge müssen als ein Syndrom aufgefasst werden, das aus einer spezifischen Organisation oder, wie ich es nenne, aus einer spezifischen Orientierung des Charakters folgt. Ich werde mich nur mit einigen wenigen Charakterzügen beschäftigen, die sich unmittelbar aus der ihnen zugrunde liegenden Orientierung herleiten lassen. Andere Charakterzüge könnte man ähnlich behandeln. Es würde sich zeigen, dass auch sie unmittelbare Ergebnisse von Grundorientierungen oder von Mischungen solcher primärer Charakterzüge mit Zügen des Temperaments sind. Bei vielen anderen, die man gemeinhin ebenfalls als Charakterzüge bezeichnet, würde sich jedoch zeigen, dass sie keine Charakterzüge in unserem Sinne sind, sondern reine Temperamentszüge oder bloße Verhaltensweisen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsjahr
- 2015
- ISBN (ePUB)
- 9783959120296
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (März)
- Schlagworte
- Charakterlehre Persönlichkeitstheorie Charakter-Orientierung